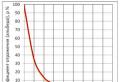Was sind die stilistischen Möglichkeiten von Sprachmitteln? Die Hauptsprache bedeutet in der russischen Sprache. Sprache bedeutet: Definition und Gebrauch. Phonetische Ausdrucksmittel
Die sprachliche Aussagekraft von Aussagen entsteht nicht nur durch die expressiv-stilistische und wertend-stilistische Bedeutungskomponente, sondern auch dadurch, dass Wörter und ihre Kombinationen bildliche Bedeutungen erlangen können, d.h.
B. zu Tropen werden oder Teil von Stilfiguren sein, die die Schaffung von bildlicher Bedeutung provozieren.
Der Lehrpfad basiert auf der Übertragung des traditionellen Namens auf einen anderen Themenbereich. Die wichtigsten Tropen sind Metapher, Metamorphose, Metonymie, Synekdoche (eine Art Metonymie), Übertreibung, Litote. Zu den Stilfiguren gehören Vergleich, Epitheton, Oxymoron. Zusammen bilden sie die sogenannten Umdenkfiguren, die zu bestimmten Gruppen zusammengefasst werden. So bilden Vergleich, Metapher und Metamorphose Figuren des Umdenkens, die auf Analogie beruhen.
VV Vinogradov schrieb, dass die Stilistik drei Studienkreise umfasst, die sich gegenseitig berühren und überschneiden:
1) der Stil der Sprache;
2) Redestil;
3) der Stil der Fiktion (individueller Stil).
Einer der Begründer der Stilistik als Wissenschaft, S. Bally, sprach ebenfalls von drei Stilistiken, aber auf ganz andere Weise: Er hob die „allgemeine Stilistik“ hervor, die die stilistischen Probleme der Sprechtätigkeit im Allgemeinen untersucht; „Private Stilistik“, die sich mit der Stilistik einer bestimmten Landessprache befasst; und "individuelle Stilistik", die die Ausdrucksmerkmale der Sprache einzelner Personen berücksichtigt.
Wie wir sehen, beschäftigt sich jede Stilistik mit integralen Sprachbildungen und geht auf die Ebene des Textes, wird so zur Stilistik des Textes und schließt sich einer solchen linguistischen Disziplin wie der Theorie (oder Linguistik) des Textes an.
Wenn es eine Stilistik einer bestimmten Landessprache gibt, dann kann diese mit der Stilistik einer anderen Sprache verglichen werden. Wir können also von vergleichender Stilistik sprechen, die praktische und theoretische Aspekte hat. Die praktische Stilistik untersucht die Entscheidungen und Präferenzen, die ein Sprecher treffen muss, wenn er beim Unterrichten oder Übersetzen von einer Sprache in eine andere wechselt. Beobachtungen zur Wahl einzelner Formen führen zu Verallgemeinerungen, die als Regeln der Stilistik formuliert werden: Sie werden von der theoretischen Stilistik untersucht.
Im System der Sprachmittel spielt das Wort eine wichtige Rolle. Russische Schriftsteller, die die Schönheit, Stärke und den Reichtum der russischen Sprache bewunderten, bemerkten vor allem die Vielfalt ihres Wortschatzes, der unerschöpfliche Möglichkeiten zur Vermittlung einer Vielzahl von Bedeutungen enthält. S. Ya. Marshak schrieb: „Der Mensch hat Worte für alles gefunden, was er im Universum entdeckt hat. Aber das ist nicht genug. Er benannte jede Handlung und jeden Zustand. Er definierte in Worten die Eigenschaften und Qualitäten von allem, was ihn umgibt.
Das Wörterbuch spiegelt alle Veränderungen wider, die in der Welt stattfinden. Er hat die Erfahrung und Weisheit von Jahrhunderten eingefangen und begleitet das Leben, die Entwicklung von Technik, Wissenschaft und Kunst, ohne zurückzubleiben. Er kann alles benennen und hat die Mittel, die abstraktesten und verallgemeinerndsten Ideen und Konzepte auszudrücken.
Die führende Rolle des Wortes im System der Sprachmittel bestimmt seinen Platz im Sprachstil: Das Wort ist die zentrale Stileinheit. Die lexikalische Stilistik untersucht die korrelativen lexikalischen Mittel einer Sprache, bewertet den Gebrauch eines Wortes in einer bestimmten Sprechsituation und entwickelt Empfehlungen für den normativen Wortgebrauch in verschiedenen funktionalen Stilen.
Mit den Errungenschaften der modernen Semasiologie untersucht die lexikalische Stilistik das Wort in der ganzen Vielfalt systemischer Zusammenhänge, die in der Sprache existieren. Dieser Ansatz hebt das Studium von Synonymen, Antonyme, mehrdeutigen Wörtern und Paronymen hervor, die als Mittel zur möglichst genauen Übermittlung von Informationen dienen. Gleichzeitig macht die Stilistik auf Phänomene wie Homonymie und Paronomasie aufmerksam, die manchmal die korrekte Sprachwahrnehmung beeinträchtigen. Schwerpunkte der lexikalischen Stilistik sind die stilistische Schichtung des Wortschatzes, die Bewertung von Archaismen und Neologismen, Wörtern begrenzten Gebrauchs, die Analyse von Verwendungsmustern stilistisch bedeutsamer lexikalischer Mittel in verschiedenen Bereichen der Kommunikation.
Der stilistische Aspekt des Wortschatzstudiums erfordert eine durchdachte Einschätzung des Wortes hinsichtlich seiner Motivation im Kontext. Die Stilistik wendet sich sowohl gegen die Verwendung überflüssiger Wörter als auch gegen das ungerechtfertigte Auslassen von Wörtern und betrachtet verschiedene Erscheinungsformen von Sprachredundanz und Sprachinsuffizienz.
Das Wort wird in der Stilistik nicht nur im Nominativ, sondern auch in der ästhetischen Funktion untersucht. Gegenstand des besonderen Interesses der lexikalischen Stilistik sind die lexikalischen Bildmittel der Sprache - Tropen.
Die Probleme der lexikalischen Stilistik hängen eng mit den Problemen der Sprachkultur zusammen. Die Stilistik, die den Gebrauch bestimmter lexikalischer Mittel der Sprache in der Rede charakterisiert, wacht über den korrekten Wortgebrauch. Der normativ-stilistische Ansatz zum Lernen des Wortschatzes beinhaltet die Analyse häufig gemachter Sprachfehler: die Verwendung eines Wortes ohne Berücksichtigung seiner Semantik; Verletzungen der lexikalischen Kompatibilität; falsche Wahl von Synonymen; falsche Verwendung von Antonyme, polysemantischen Wörtern, Homonymen; Verwechslung von Paronymen; unmotivierte Assoziation stilistisch inkompatibler lexikalischer Mittel usw. Die Beseitigung lexikalischer und stilistischer Fehler in der Rede, die Wahl der optimalen Variante des Gedankenausdrucks sind von herausragender Bedeutung bei der literarischen Bearbeitung von Texten.
Am Ursprung der modernen Stilistik stehen antike und vergleichende Poetik und Rhetorik. Poetik wurde als Wissenschaft der Poesie und Rhetorik als Wissenschaft der Rede verstanden. Die Rhetorik umfasste die Lehre vom verbalen Ausdruck, einschließlich der Auswahl von Wörtern und ihrer Kombination, das Studium von Redewendungen
In den Werken von M. V. Lomonosov wurden die Grundlagen der Stilistik der russischen Sprache als Lehre von den Ausdrucksmitteln der Sprache, der korrekten Rede, der Eloquenz als Kunst, schön und überzeugend zu sprechen und die Zuhörer mit der eigenen Meinung zu verbinden, gelegt. Die Doktrin der korrekten und guten Rede entwickelt sich zur Doktrin der stilistischen Ressourcen der russischen Sprache, der Fähigkeit, sie zu verwenden, was sich im Inhalt von Handbüchern widerspiegelt, die im Stil der russischen Sprache für Bildungszwecke erstellt wurden.
Lomonosov legte nicht nur die Grundlagen der Stilistik, sondern skizzierte auch die Perspektiven für ihre weitere Entwicklung. Der Begriff „Stilistik“ selbst tauchte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Werken deutscher Romantiker im Zusammenhang mit der Entstehung neuer, für die damalige Zeit entstandener Konzepte der Individualität eines kreativen Menschen auf.
Da die Stilistik die Lehre vom „Sprachgebrauch“ ist, haben viele Linguisten versucht, sie zur allgemeinsten philologischen Disziplin zu machen, in die die Linguistik als Privatwissenschaft aufgenommen würde. Diese Herangehensweise wird bei den deutschen romantischen Philologen Brüdern A. W. und F. von Schlegel (Anfang des 19. Jahrhunderts) in Richtung des ästhetischen Idealismus von C. Vossler beobachtet.
1) Das engste Verständnis von Stilistik (historisch nicht das erste) war charakteristisch für die amerikanische beschreibende Linguistik (40–50 Jahre des 20. Jahrhunderts). Das Studium der Struktur von Einheiten, die größer als ein Satz sind, fiel in das Sichtfeld der Stilistik - das Anordnen von Sätzen, das Gruppieren in Absätze usw. Dieser Ansatz wird als deskriptive Stilistik bezeichnet.
2) Ein breiteres stilistisches Verständnis ist charakteristisch für die überwiegend englische Sprachwissenschaft des Textes. Was Deskriptivisten als stilistische Variabilität bezeichneten, also den Aufbau eines Textes über längere Segmente als einen Satz, charakterisiert die Textlinguistik als Manifestation allgemeiner Muster des Textaufbaus. Der Stil wird mit der Grammatik des Textes identifiziert, da der Begriff der freien Wahl der Techniken und Ausdrucksformen des Autors stark eingeschränkt ist. In gewisser Weise kann dieser Ansatz jedoch als textuelle Stilistik bezeichnet werden.
3) Sprachwissenschaftler der Prager Sprachschule in den 30er–40er Jahren. XXArt.-Nr. entwickelte eine Stilistik, die über die Grenzen des Textes hinausgeht, als Lehre vom Verhältnis des Textes zu den außertextlichen Teilsystemen der Sprache - Stile. Der Text erscheint als Ergebnis der Sprachwahl des Sprechers aus den von der Sprache vorgegebenen Möglichkeiten: phonetisch, lexikalisch, grammatikalisch und als deren Kombination in einem Sprechakt, je nach Zweck („Funktion“). Dieser Ansatz basiert auf dem Konzept eines funktionalen Sprachstils und kann als funktionale Stilistik bezeichnet werden. Diese Richtung steht der Soziolinguistik nahe.
Im weiteren Sinne wird Stilistik durch die folgenden 2 Ansätze interpretiert:
4) Im Gegensatz zur sich entwickelnden Lehre vom Aufbau der Sprache formiert sich die Stilistik als allgemeine Lehre vom Sprachgebrauch (G. O. Vinokur). Dazu gehören das Studium der „Sprache in Aktion“ (über die E. Benveniste in den 1950er Jahren schrieb), der Sprachgebrauch von Sprechern in bestimmten Situationen, die Voraussetzungen für die erfolgreiche Ausführung von Sprechakten usw. Wir können also darüber sprechen pragmatischer Stil.
Andererseits seit den 1930er Jahren 20. Jahrhundert Die synchrone Stilistik der modernen Sprache wurde als Etappe in der Geschichte der Literatursprache betrachtet (im Stilkonzept von V. V. Vinogradov). Es hat sich ein historischer Stil gebildet.
5) Seit den 20er Jahren. XXArt.-Nr. Der Stil der Landessprache wird in Verbindung mit der Sprache der Belletristik und dem Werk prominenter Schriftsteller betrachtet. Dieser Ansatz ist im Konzept von VV Vinogradov, L. Spitzer im Westen definiert. Die Stilistik der Fiktionssprache erschien, die eng mit der Poetik verwandt ist.
All diese Ansätze bilden eine sprachliche Stilistik im weitesten Sinne des Wortes. Gleichzeitig werden der 3. und 4. Ansatz im Sprachunterricht verwendet und gelten als praktische Stilistik, deren Zweck es ist, die Normen der Muttersprache zu lehren.
Im Zentrum der theoretischen Stilistik steht das Problem des Sprechaktes und des Textes als Ergebnis des sprachschöpferischen Prozesses.
Hinzu kommt eine vergleichende Stilistik, die die stilistischen Phänomene der Muttersprache im Vergleich zu anderen Sprachen untersucht.
Die Breite und Verwischung der Grenzen des Fachs Stilistik resultierte aus der Tatsache, dass sich die Wissenschaftler im Prozess der Bildung der Stilistik als Wissenschaft auf verschiedene Aspekte des Studiums der Sprache konzentrierten. Die Herausbildung eines einheitlichen Standpunktes wurde auch durch die mehrdeutige Interpretation so grundlegender Begriffe wie „Sprache-Sprache“, „Text“, Status und Grenzen des Sprachlichen und Außersprachlichen in der Sprachstilistik erschwert.
Oft zwingen Sie die Situation, die Situation, in der Sie sich befinden, der Gesprächspartner oder das Gesprächsthema dazu, Ihre Gedanken nicht mit den üblichen, umgangssprachlichen Alltagswörtern auszudrücken, sondern mit einem gehobenen, prätentiösen Stil, amtlichen Geschäfts- oder Wissenschaftsvokabular oder umgekehrt - Jargon, obszöne Wörter, d. h. reduzierter Wortschatz.
Das ist stilistische Färbung.
Ist die Rede stilistisch gefärbt, lässt sich auch ohne Vertiefung in die Bedeutung feststellen, wer, zu wem und in welchem Umfeld diese Worte spricht oder schreibt, sowie die Beziehung zwischen Absender und Empfänger.
Wenn wir sehen: "... Unter Berücksichtigung aller oben genannten Tatsachen können wir schlussfolgern, dass die Behinderung von Personen auf ihre nachlässige Haltung gegenüber der Erfüllung bürgerlicher Pflichten und menschlicher Pflichten zurückzuführen ist ..." - dann können wir ohne zu zögern schließen dass dieser Satz ein Auszug aus irgendeinem oder einem offiziellen Dokument ist, da jedes Wort förmlich nach seiner Zugehörigkeit zum administrativen Umfeld und dementsprechend zum offiziellen Geschäftsvokabular schreit.
Ein weiteres markantes Beispiel stilistischer Färbung ist die poetische Sprache. „Zart sind die Gräser, weiß sind die Platten, / und die Kupferringe siegreich…“. Die Färbung manifestiert sich nicht nur im Wortsinn, sondern auch in der Wortform (kurze Adjektive: sanft, weiß) und in der Konzentration ähnlicher syntaktischer Konstruktionen (Zarte Kräuter, weiße Teller) in einem Satz und in der Wortstellung (Rückseite - Kupferringe).
Die wissenschaftliche Sprache ist reich an verschiedenen Begriffen, umständlichen Wörtern und Sätzen.
Jeder Stil hat seine eigenen charakteristischen Merkmale und Merkmale, Formen und Ausdrucksmittel (ihre Abwesenheit ist auch ein Mittel).
Manchmal muss man dem Bild des grauen Alltags nur leuchtende Farben der Poesie hinzufügen. Und ein stilistisch gefärbtes Wort oder eine Phrase, die sich aus dem Kontext abhebt, verleiht dem Gesagten eine komische Konnotation und charakterisiert den Sprecher in gewisser Weise (diese Technik wird in der Belletristik oft verwendet, um einer Situation einen komischen Effekt zu verleihen). Aber denken Sie daran: Nicht alle Farben sind mischbar und harmonieren miteinander.
Mehr zum Thema Sprachstilmittel und ihre Verwendung.:
- 14 Phraseologische Einheiten, ihre Typen und Hauptmerkmale. Stilistische Färbung von Ausdruckseinheiten. Die stilistische Rolle von Ф und Methoden ihrer Verwendung. Anwendungsfehler F. Wörterbücher F.
Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation
Bundeslandesautonomes Bildungswesen
Institution der Höheren Berufsbildung
„KASAN (WOLGA) BUNDESUNIVERSITÄT“
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN, GESCHICHTE UND ORIENTALISCHE STUDIEN
ABTEILUNG FÜR ÜBERSETZUNG UND WELTKULTURERBE
LEHRSTUHL FÜR THEORIE UND PRAXIS DER ÜBERSETZUNG
Leitung: 037500.62 - Linguistik
KURSARBEIT
MERKMALE DER ÜBERTRAGUNG DER STILMITTEL VON "ALICE IM WUNDERLAND" IN DIE RUSSISCHE SPRACHE VON V. V. NABOKOV
Arbeit erledigt:
Student im 3. Jahr
Gruppe 04.4-202
"___" _____________ 2014 N. T. Manyurova
Das Werk ist zum Schutz zugelassen:
Wissenschaftlicher Leiter
Alter Dozent"___"______2014 ________ G.M. Nurtdinova
Abteilungsleiterin
Dok. philol. Naturwissenschaften, außerordentlicher Professor"___"______2014 ________ S.S. Tachtarowa
Kasan - 2014
Kapitel I. …………………………………………...... 6
1.1 …………………………………….. 6
1.2 ……………………………........ 12
Schlussfolgerungen
Kapitel II. ……………………………....... achtzehn
2.1 ……………………………………………………………… 18
2.2 ………21
Schlussfolgerungen
Fazit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Literatur ……………………………………………….. 36
Einführung
Der 4. Juli 1862 ist ein bedeutender Tag in der Geschichte der Weltliteratur. An diesem Tag erzählte der Oxford-Lehrer Charles Dodgson seinen jungen Begleitern, den Schwestern Lorine, Alice und Edith Liddell, während einer Bootsfahrt auf der Themse eine faszinierende Geschichte, die später zu einem der meistgelesenen Märchen der Welt wurde. Die Geschichte der Reise eines kleinen Mädchens in die Welt ihrer eigenen Fantasie wurde 1865 unter dem Titel Alice's Adventures in Wonderland veröffentlicht, und ihr Autor wurde unter einem neuen Namen - Lewis Carroll - berühmt. Lewis Carrolls Märchen „Alice im Wunderland“ (in der russischen Übersetzung traditionell „Alice im Wunderland“ genannt) ist zweifellos ein Meisterwerk der Weltliteratur. Die buchstäblich „unterwegs“ geschriebene Geschichte hatte zu Lebzeiten des Autors eine beeindruckende Auflage, wurde Gegenstand von Hunderten von Studien und Essays, wurde von vielen Künstlern (darunter Arthur Rackham und Salvador Dali) illustriert und wurde zu einer der am häufigsten geschriebenen übersetzte Werke. Heute gibt es mehr als hundert Übersetzungen von „Alice“, etwa zwanzig russische Versionen (die allererste bekannte stammt aus dem Jahr 1879). Die kreativen Ressourcen eines Märchens sind unerschöpflich.
Alice im Wunderland eliminiert die Möglichkeit eines traditionellen Ansatzes zur literarischen Übersetzung. Die Fülle des Paradoxen und Unerklärlichen in der Arbeit erinnert den Übersetzer daran: Die übliche Logik gilt nur in einer Welt, in der alles so und nichts anderes passiert. Aber was passiert, wenn die umgebende Welt mit ihren Gesetzen und Regeln „auf den Kopf gestellt“ wird? Boris Zakhoder, dessen Nacherzählung von „Alice“ 1971 veröffentlicht wurde, gestand den Lesern im Vorwort, dass er lange über die Übersetzung von Carroll nachgedacht habe Buch unmöglich: „Vielleicht wird es einfacher ... England zu transportieren!
Die erste russische Übersetzung, die von einem anonymen Übersetzer angefertigt wurde, wurde 1879 in der Druckerei von A. I. Mamontov in Moskau gedruckt und hieß "Sonja im Königreich der Diva".
1923 wurde in Berlin die russische Übersetzung von "Alice" von Vladimir Vladimirovich Nabokov (Pseudonym V. Sirin) angefertigt. Die Übersetzung hieß „Anya im Wunderland“ und wurde vom Gamayun-Verlag herausgegeben. In der UdSSR wurde die Übersetzung von V.V. Nabokov erstmals 1989 vom Verlag "Children's Literature" mit Illustrationen des Künstlers A.B. Gennadiev. 1967 erschien eine neue Märchenübersetzung von H.M. Demurova In den letzten Jahrzehnten wurde "Alisa" unter der Marke der zentralen und vieler peripherer Verlage des Landes in Übersetzungen von B.V. veröffentlicht. Zakhoder, A. A. Shcherbakov und V. E. Orel. Von der „Alice“ des letzten Jahrzehnts haben die Übersetzungen von Yuri Nesterenko, Nikolai Starilov und Andrey Kononenko die weiteste Verbreitung gefunden.
Das Buch „Alice im Wunderland“ von L. Carroll ist seit vielen Jahren eines der beliebtesten auf der ganzen Welt. In den englischsprachigen Ländern nimmt „Alice“ einen der ersten Plätze in Bezug auf die Anzahl der Erwähnungen, Zitate und Referenzen ein, aber gleichzeitig wirft diese Geschichte viele Fragen auf.
Natürlich gibt es einige Übersetzungen von Alice im Wunderland ins Russische, aber wir werden die berühmtesten sowie die von besonderem Interesse in der Analyse berücksichtigen.
Relevanz der Arbeit: liegt im Studium der Stilmittel des Autors von Nabokov, der die Strategie der Domestizierung wählte.
Studienobjekt:Übersetzung des Werkes „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll in der Version von Vladimir Nabokov.
Gegenstand der Studie: Stilistische Änderungen, die Vladimir Nabokov an seiner Übersetzung von Alice im Wunderland vorgenommen hat.
Zweck dieser Arbeit: Der Zweck Diese Arbeit ist eine Analyse der Übersetzung von "Alice im Wunderland" von Vladimir Nabokov und die Identifizierung der Merkmale der Übertragung von Stilmitteln des Werkes ins Russische.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende Aufgaben gelöst werden:
1) Beschreiben Sie die am häufigsten verwendeten Stilmittel in Kunstwerken;
2) Vergleichen Sie V. Nabokovs Übersetzung mit einer anderen klassischen Übersetzung von „Alice im Wunderland“;
3) Identifizierung der Merkmale der Übertragung von Stilmitteln von "Alice im Wunderland" in der Übersetzung von V. Nabokov;
Die theoretische Grundlage dieser Kursarbeit war Werke in- und ausländischer Literaturkritiker auf dem Gebiet der Übersetzung.
NAMEN DER WISSENSCHAFTLER
In der Arbeit verwendete Forschungsmethoden: Vergleichende Lektüre des Originals und verschiedener Übersetzungen des Werkes, Analyse verschiedener Übersetzungsversionen aus dem Englischen ins Russische sowie Analyse von Wörterbuchdefinitionen.
Diese Kursarbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Kapiteln, einem Schluss und einem Literaturverzeichnis.
Billigung: ARTIKEL, was ist wo.
Kapitel 1 „Stilmittel und Probleme ihrer Übersetzung ins Russische“
Schreiben Sie, warum Kunstwerke entstehen und warum Schriftsteller Stilfiguren, also Tropen, verwenden.
In einem Kunstwerk trägt das Wort nicht nur bestimmte Informationen, sondern dient auch dazu, den Leser mit Hilfe künstlerischer Bilder ästhetisch zu beeinflussen. Je heller und wahrhaftiger das Bild, desto stärker wirkt es auf den Leser.
Die Emotionalität des künstlerischen Stils unterscheidet sich deutlich von der Emotionalität des umgangssprachlichen und journalistischen Stils. Es erfüllt eine ästhetische Funktion. Der künstlerische Stil beinhaltet eine Vorauswahl der Sprachmittel; Alle Sprachmittel werden verwendet, um Bilder zu erzeugen. Eine Besonderheit des künstlerischen Sprachstils ist die Verwendung spezieller Redewendungen, die der Erzählfarbe die Kraft verleihen, die Realität darzustellen.
Die künstlerischen Ausdrucksmittel sind vielfältig und zahlreich. Dies sind Tropen: Vergleiche, Personifikationen, Allegorie, Metapher, Metonymie, Synekdoche usw. Und Stilfiguren: Epitheton, Hyperbel, Litote, Anapher, Epiphora, Gradation, Parallelismus, rhetorische Frage, Schweigen usw.
Redewendung- ein Begriff der Rhetorik und Stilistik, der verschiedene Redewendungen bezeichnet, die ihm stilistische Bedeutung, Bildsprache und Ausdruckskraft verleihen, seine emotionale Färbung verändern. Redewendungen dienen dazu, eine Stimmung zu vermitteln oder die Wirkung eines Satzes zu verstärken, der sowohl in der Poesie als auch in der Prosa häufig für künstlerische Zwecke verwendet wird.
Redewendungen werden in Tropen und Figuren im engeren Sinne des Wortes eingeteilt. Wenn Tropen als Verwendung von Wörtern oder Phrasen in einem unangemessenen, bildlichen Sinne, Allegorie, verstanden werden, dann sind die Figuren Methoden zur Kombination von Wörtern, syntaktische (syntagmatische) Organisation der Sprache. Gleichzeitig ist die Unterscheidung nicht immer eindeutig, bei manchen Redewendungen (wie Epitheton, Vergleich, Paraphrase, Übertreibung, Litotes) bestehen Zweifel: sie Figuren im engeren Sinne zuzuordnen bzw Pfade. M. L. Gasparov betrachtet Trails als eine Art Figuren – „Figuren des Umdenkens“.
Trope ist ein Wort oder Ausdruck, der bildlich verwendet wird, um zu erschaffen künstlerisches Bild und eine größere Ausdruckskraft erreichen. Pathways umfassen Techniken wie z Epitheton, Vergleich, Personifikation, Metapher, Metonymie, manchmal bezeichnet als Hyperbeln und Litoten. Kein Kunstwerk ist vollständig ohne Tropen. Das künstlerische Wort ist polysemantisch; Der Schriftsteller schafft Bilder, spielt mit den Bedeutungen und Kombinationen von Wörtern, nutzt die Umgebung des Wortes im Text und seinen Klang - all dies macht die künstlerischen Möglichkeiten des Wortes aus, das das einzige Werkzeug des Schriftstellers oder Dichters ist.
Stilmittel.
Verschiedene Forscher haben eine Klassifikation von Art erstellt. bedeutet, ... Der Wissenschaftler Galperin teilt Stilmittel wie folgt ein:
1. Phonetische Ausdrucksmittel.
2. Lexikalische Ausdrucksmittel
3. Syntaktische Ausdrucksmittel
Phonetische Ausdrucksmittel sind:
1. Onomatopoeia - Mit Hilfe von Lauten und Wörtern eine genauere Vorstellung davon schaffen, was in diesem Text gesagt wird;
(Klangauswahl [w] und die Konvergenz von zwei gleitenden aspirierten [X] Rauschen wiedergegeben:
Leicht hörbar, leise rauschendes Schilf ...
(K. Balmont))
2. Phonetische Anapher - Wiederholung von Anlauten;
(Ruhm! Glanz, unsere sonnige Gemeinde! (V. Mayakovsky));
3. Phonetische Epiphora - Wiederholung von Schlusslauten;
(Ich bin ein freier Wind, ich blase immer,
Ich winke den Wellen, ich streichle die Weiden...
In den Zweigen seufze ich, seufze, stumm,
Ich schätze das Gras, ich schätze die Felder (K. Balmont)).
4. Alliteration - Wiederholung von Konsonanten;
(Donner grollt, grollt)
5. Assonanz - Wiederholung von Vokalen;
(Wir langweilen uns, wenn wir den Herbststurm hören ... (A. Nekrasov))
6. Intonation - eine rhythmisch-melodische Struktur der Sprache, abhängig vom Anstieg und Abfall des Tons während der Aussprache. Intonation ist: fragend, ausrufend, erzählend.
Lexikalische Ausdrucksmittel sind:
1. Metapher - die Verwendung eines Wortes im übertragenen Sinne, basierend auf der Ähnlichkeit in irgendeiner Hinsicht von zwei Objekten oder Phänomenen:
- in Form (Zwiebelkopf, Knoblauchzehe, Gartenring);
- nach Qualität (seidene Wimpern, feines Gehör, schwarze Gedanken);
· - nach Ort (unser Auto steht am Ende des Zuges);
- durch die Ähnlichkeit der ausgeübten Funktion - Funktionsübertragung (Autowischer, ein Stift mit goldener Spitze);
2. Antonomasie - ein Trope, ausgedrückt in der Ersetzung eines Namens oder Namens durch Angabe eines wesentlichen Merkmals eines Objekts oder seiner Beziehung zu etwas;
3. Personifizierung - die Zuordnung eines Zeichens oder einer Handlung eines Lebewesens (Person) zu Objekten, Naturphänomenen, abstrakten Begriffen;
(Der Wind ist wütend; das Meer lachte und weinte)
4. Metonymie - die Verwendung des Namens eines Objekts anstelle des Namens eines anderen auf der Grundlage einer externen oder internen Verbindung zwischen ihnen:
zwischen dem Objekt und dem Material, aus dem das Objekt besteht (Kristall liegt bereits auf dem Tisch);
zwischen Inhalt und Inhalt (Nun, iss noch einen Teller!);
· zwischen der Handlung und ihrem Ergebnis, Ort oder Objekt (Sie hat "fünf" für das Diktat bekommen; die Morgenpost wurde bereits gebracht);
zwischen der Aktion und dem Instrument dieser Aktion (die Posaune rief zu einer Kampagne auf);
zwischen einem gesellschaftlichen Ereignis, einer Veranstaltung und ihren Teilnehmern (beschloss der Kongress ...);
Zwischen dem Ort und den Menschen an diesem Ort (das Publikum war laut; das ganze Haus ergoss sich auf die Straße);
Zwischen dem emotionalen Zustand und seiner Ursache (Meine Freude ist noch in der Schule).
5. Figurativer Vergleich - ein offener detaillierter Vergleich einer Tatsache der Realität mit einer anderen (bezeichnet und bezeichnend) gemäß einem oder mehreren benannten oder unbenannten Zeichen, die zusätzliche Informationen enthält und dazu beiträgt, die Gedanken des Autors möglichst vollständig offenzulegen und einen neuen Blick auf die zu werfen alt, bekannt. Vergleichsteile sind verlinkt mit:
· - vergleichende Gewerkschaften (als, genau, als ob, als ob, als usw.): Unmoral tötet wie Strahlung ständig die Gesellschaft (A. Tuleev);
- Fachwörter (ähnlich, ähnlich, erinnernd usw.): Ein Zigeunermädchen ging vorbei und sah aus wie ein Besen (Yu. Olesha);
· - Formen des Instrumentalkastens, der das Wort bezeichnet: Rauch kräuselte sich über ihn;
· - Formen der Vergleichsgrade von Adjektiven und Adverbien: Wer in der Welt ist süßer als alle, alle erröten und weißer? (A. Puschkin).
6. Übertreibung - Übertreibung von Größe, Stärke, Wert, Stärkung eines Zeichens, Eigenschaft zu solchen Größen, die für ein Objekt normalerweise nicht charakteristisch sind, Phänomen;
(Ich habe es Ihnen schon hundertmal gesagt; Ein seltener Vogel wird in die Mitte des Dnjepr (N. Gogol) fliegen.)
7. Epitheton - eine künstlerische, bildliche Definition, die auf der Grundlage der Bedeutungsübertragung durch Ähnlichkeit entsteht und in Kombination mit dem zu definierenden Wort entsteht;
(Spiegelfläche von Wasser; giftiger Blick)
8. Oxymoron - eine Kombination von Wörtern, die zwei widersprüchliche, sich gegenseitig ausschließende Konzepte bezeichnen, sich aber ergänzen, um die Komplexität und Widersprüchlichkeit eines Phänomens widerzuspiegeln, das auf den ersten Blick einfach und eindeutig erscheint, um seine dialektische Essenz zu offenbaren in semantischer Komplikation und Aktualisierung des Eindrucks;
(... Schmerzlich glücklich (A. Puschkin); Sie ist glücklich, traurig zu sein (A. Akhmatova))
9. Zeugma - eine Redewendung, die darin besteht, dass ein Wort, das mit anderen Wörtern in einem Satz die gleiche Art syntaktischer Kombinationen bildet, nur in einer dieser Kombinationen verwendet wird, während es in anderen weggelassen wird;
(Der Edelmann wird hinter den Gitterstäben seines Turms geehrt, der Kaufmann in seinem Laden (Puschkin, „Szenen aus Ritterzeiten“) – das Wort geehrt kommt hier nur einmal vor, beim zweiten Mal ist es impliziert).
10. Wortspiel (Wortspiel) - eine Figur, die auf der Inkompatibilität von Konzepten basiert, die durch identisch klingende Wörter bezeichnet werden, oder auf "einer absichtlichen Kombination von zwei Bedeutungen desselben Wortes in einem Kontext". Ein Wortspiel basiert auf einer Unterbrechung der Verbindung zwischen Wörtern: auf einer Kollision von Homonymen, Paronymen, unterschiedlichen Bedeutungen eines polysemantischen Wortes;
(Und sie werden überall lachen. - Stimmt, - sagen die Leute. - Da die Straßenbahn nicht fahren will, / ist schon klar, es hat kein Glück (B. Zakhoder))
11. Anspielung - ein Hinweis auf eine mythologische, kulturelle, historische, literarische Tatsache ohne direkte Angabe der Quelle, eine Art verstecktes Zitat, das auf der kulturellen und historischen Erfahrung des Sprechers und des Adressaten basiert;
(Ehre sei Herostratos).
12. Sprechende Namen sind eine Art Trope, bis zu einem gewissen Grad gleichbedeutend mit Metapher und Vergleich, und werden zu stilistischen Zwecken verwendet, um eine Figur zu charakterisieren;
(„Undergrowth“ von Fonvizin – ein satirisches Stück konnte nicht ohne Vor- und Nachnamen auskommen. Der Name des Protagonisten ist Mitrofan, was auf Griechisch „Manifestation der Mutter“ bedeutet. Der Name kann auch mit „seiner Mutter ähnlich“ übersetzt werden.) .
Zu den syntaktischen Ausdrücken gehören:
1. Antithese - eine Redewendung, die aus einer scharfen Opposition verglichener Konzepte, Gedanken und Bilder besteht, die auf Antonyme und syntaktischem Parallelismus basiert und dazu dient, die Ausdruckskraft der Sprache zu verbessern;
(Lernen ist Licht und Unwissenheit ist Dunkelheit; Ein Kluger wird lehren, ein Narr wird sich langweilen)
2. Parallelität - eine Redewendung, die in der Identität der syntaktischen Struktur von zwei oder mehr benachbarten Textsegmenten besteht;
(In welchem Jahr - zählen Sie, / in welchem Land - raten Sie. (A. Nekrasov))
3. Abstufung - (Erhöhung) eine Figur, die aus zwei oder mehr signifikanten Einheiten besteht, die in zunehmender Intensität angeordnet sind;
(Ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich)
4. Wiederholung - (Wiederholung, Verdopplung) vollständige oder teilweise Wiederholung der Wurzel, des Wortstamms oder des ganzen Wortes, beschreibende Formen, sprachliche Einheiten Ein besonderes Stilmittel, um beispielsweise Details in der Beschreibung hervorzuheben und eine ausdrucksstarke Farbgebung zu erzeugen;
(Ein schöner, sauberer, höflicher Taxifahrer fuhr ihn vorbei an den schönen, höflichen, sauberen Polizisten entlang des schönen, sauberen, gewaschenen Bürgersteigs, vorbei an den schönen, sauberen Häusern ... (L. Tolstoi))
5. Inversion - eine Neuanordnung von Wörtern - Komponenten eines Satzes, die gegen ihre übliche Reihenfolge verstoßen, sodass Sie sich auf diese Komponente konzentrieren können, was zu einer semantischen oder emotionalen Hervorhebung von Wörtern führt.
(Aber unser offenes Biwak war ruhig ... (M. Lermontov))
6. Ironie – „ein Tropus, der in der Verwendung eines Wortes oder Ausdrucks im umgekehrten Sinn des Wörtlichen besteht, mit dem Ziel, sich lächerlich zu machen.
(Halt dich zurück, clever Bist du im Delirium, Kopf? (Krylov) (in Bezug auf den Esel))
7. Rhetorische Figuren - syntaktische Konstruktionen, die nicht nur die Ausdruckskraft, sondern auch die logische Bedeutung der Sprache verbessern. Diese beinhalten:
· Der rhetorische Reiz liegt darin, dass die Aussage an ein unbelebtes Objekt, einen abstrakten Begriff, eine abwesende Person gerichtet ist: Wind, Wind, du bist mächtig, du treibst Wolkenschwärme ... (A. Puschkin); Träume Träume! Wo ist deine Süße? (A. Puschkin).
Rhetorische Frage - eine Redewendung, die eine Bestätigung oder Verneinung in einer Frageform einer Aussage enthält, auf die keine direkte Antwort erwartet (nicht erwartet) wird (Wen betrifft Schönheit nicht?).
Rhetorischer Ausruf - ein Ausdruck des entstehenden emotionalen Zustands des Autors mit Hilfe der Intonation, der den Adressaten auch ohne besondere lexikalische, syntaktische Mittel aktiv beeinflusst und der Aussage Lebendigkeit und Leichtigkeit verleiht, beispielsweise beim Erzählen: Heute (Hurra!) I Ich gehe ins Freie.
· Rhetorische Antwort – eine Stilfigur, die darin besteht, dass der Autor sich Fragen stellt und diese selbst beantwortet: Also, was machen wir jetzt? Lassen Sie uns dieses einfache Problem lösen, sollen wir? Nein, zuerst werden wir essen, uns ausruhen und dann - zur Arbeit
8. Paraphrase - ein Ausdruck, der eine beschreibende Übertragung der Bedeutung eines anderen Ausdrucks oder Wortes ist, das Ersetzen eines Ein-Wort-Namens einer Person, eines Objekts oder eines Phänomens durch eine Beschreibung seiner wesentlichen Merkmale, eine Angabe charakteristischer Merkmale;
(König der Bestien (statt „Löwe“), Schöpfer von Macbeth (Shakespeare))
9. Schweigen - eine absichtlich unvollständige Aussage, das Auslassen von etwas Bedeutendem und Mehrdeutigem (signifikantes Auslassen), mit dessen Hilfe das Ungesagte eine größere Bedeutung erlangt, als wenn es offen ausgesprochen würde;
(Ich werde meine Prüfungen bestehen und...)
Galperin I.R. Stilistik. 1997
Galperin I.R. Essays über Stil, 1998
II.2.3. I. R. Galperins Klassifikation von Ausdrucksmitteln und Stilmitteln
Russisch. Enzyklopädie, 1979: 107):
(Rosenthal D. E., Telelenkova M. A., 1976: 271);
©2015-2019 Seite
Alle Rechte liegen bei ihren Autoren. Diese Website erhebt keinen Anspruch auf Urheberschaft, sondern bietet eine kostenlose Nutzung.
Erstellungsdatum der Seite: 2016-04-26
Stilmittel
- Spracheinheiten, Tropen und Redewendungen sowie Stilmittel, Sprechstrategien und Ausdruckstaktiken Stil(cm.).
Traditionell S. mit. Nennen Sie nur solche sprachlichen Einheiten, die außerkontextuell sind stilistische Konnotationen(cm.). Dies liegt daran, dass im Sprachstil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. dominierte das Stilverständnis als eine bestimmte Menge einheitlich gefärbter Spracheinheiten, d.h. als Teil der sprachlichen Struktur. Mit dieser Interpretation von S. s. ihre wichtigste Quelle ist die Synonymie (neben den Mitteln der verbalen Bildsprache). Heiraten vielfältige stilistische Konnotationen in Synonymreihen, zum Beispiel: besoffen, beschwipst, spree, schräg, betrunken, unter dampf, unter einer fliege, schreibt mit den füßen ein monogramm, macht mit den füßen eine brezel, bewegt die zunge nicht, strickt keinen bast, kann vater-mutter nicht sagen usw.
S. s. werden auf allen Ebenen der Sprachstruktur präsentiert, am reichsten - auf der lexikalischen Ebene. Sie bilden derzeit keine stabilen, relativ geschlossenen Stilsysteme, sondern sind nur Aneinanderreihungen (Schichten) von Wörtern, Formen und Konstruktionen.
Im üblichen Stil (siehe Werke T. G. Brenner) Hauptuntersuchungsgegenstand ist die Aussage (der Akt der Sprechkommunikation). S. s. - Dies sind Spracheinheiten, die stilistische Konnotationen in der Aussage erwerben oder modifizieren, wenn sie eine expressive Aufgabe ausführen und einen bestimmten stilistischen Effekt erzielen. Der Weg zum Aktualisieren der Aufgabe ist Stilmittel(siehe), gebildet mit S.'s Beteiligung von Seite.
Der Begriff S. mit wird anders interpretiert. in Funktion Stil, der mit der Interpretation von Funkts zusammenhängt. Stil als eigentümlicher Charakter der Sprache der einen oder anderen sozialen Variante davon, geschaffen - unter dem Einfluss eines Komplexes grundlegender außersprachlicher Faktoren - durch spezifische Auswahl, Wiederholung, Kombination, Platzierung, Transformation von mehrstufigen Spracheinheiten. Der Ausdruck von Stil beinhaltet nicht nur und weniger konnotativ gefärbte Sprachmittel, sondern die sogenannten neutralen. Letztere verwirklichen jedoch in vielen Fällen aufgrund einer einzelnen kommunikativen Aufgabe der einen oder anderen Kommunikationssphäre spezifische Funktionsbedeutungen, wodurch eine gewisse Makro-Färbung des Stils entsteht.
Im Stil des Textes, der eine der Richtungen der func ist. Stilistik wird ein breiteres Verständnis von Stil als Möglichkeit zur Durchführung textueller Aktivitäten akzeptiert (eine integrale Art, ein Sprachwerk zu konstruieren). Dementsprechend wird das Konzept von S. mit am breitesten. Nach diesem Konzept sind also nicht nur sprachliche, sondern auch thematische und tektonische Mittel in den Stilausdruck eingebunden – Stilmittel, Strategien und Taktiken zum Aufbau eines Textes (Texttypus).
Mit einer Änderung der Stilinterpretation und der Herangehensweise an seine Untersuchung ändert sich daher auch der Inhalt des Konzepts von "S. with.".
Zündete.: Vinogradov V.V. Ergebnisse der Diskussion von Stilfragen. - Vja. - 1955. - Nr. 1; Sein eigenes: . Theorie der poetischen Sprache. Poetik. - M, 1963; Gvozdev A. N. Essays über den Stil der russischen Sprache. - M, 1965; Gauzenblas K. Zur Klärung des Begriffs „Stil“ und zur Frage nach dem Umfang der Stilforschung. - Vja. - 1967. - Nr. 5; Stilistische Forschung. - M, 1972; Kozhina M. N. Zum Zusammenhang von stilistischer Farbgebung, Stilmittel und Stil // Studien zur Stilistik. - Dauerwelle, 1974. Ausgabe. vier; Her: Stilistik der russischen Sprache. -M., 1993; Vinokur T.G. Muster der stilistischen Verwendung von Spracheinheiten. - M, 1980; Odinzow V. V. Textstil. - M, 1980; Skovorodnikov A.P. Expressive syntaktische Konstruktionen der modernen russischen Literatursprache. – Tomsk, 1981; Petrishcheva E.F. Stilistisch gefärbter Wortschatz der russischen Sprache. -M., 1984.
V.A. Salimowski
Stilistisches Lexikon der russischen Sprache. - M:. "Flint", "Wissenschaft". Bearbeitet von M. N. Kozhina. 2003 .
Sehen Sie in anderen Wörterbüchern nach, was "stilistische Mittel" bedeutet:
- - stilistische Möglichkeiten von Syntaxmitteln, ihre Rolle bei der Generierung stilistisch geprägter Aussagen; die Fähigkeit syntaktischer Einheiten, als expressive Stilmittel zu fungieren, d.h. verbunden mit der Leistung ... ...
- - 1) ein Abschnitt der Sprachstilistik, der sich auf die Beschreibung der Stilmittel der Moderne konzentriert. Russisch zündete. Sprache auf der lexikalischen Ebene der Sprachstruktur (siehe die Werke von L.V. Shcherba, G.O. Vinokur, A.N. Gvozdev, A.M. Efimov, D.I. Rozental, D.N. ... ... Stilistisches Lexikon der russischen Sprache
- (grammatische Stilistik) ist 1) ein Mittel der Morphologie und Wortbildung, das dem Sprecher die Möglichkeit gibt, die am besten geeignete Auswahl und Verwendung von morphologischen und wortbildenden Synonymen und Varianten in Übereinstimmung mit den Zielen zu treffen und ... ... Stilistisches Lexikon der russischen Sprache
Stilmittel- Ein subjektiver sprachlicher Faktor der Textbildung, der eine besondere Art der Textorganisation widerspiegelt, die der Autor gewählt hat, um seine Sicht der Welt und der beschriebenen Situation am angemessensten widerzuspiegeln. Stilmittel, die aufwerten ... ...
Stilmittel- Ein subjektiver sprachlicher Faktor der Textbildung, der eine besondere Art der Textorganisation widerspiegelt, die der Autor gewählt hat, um seine Sicht der Welt und der beschriebenen Situation am angemessensten widerzuspiegeln. Stiltechniken verstärken ... ...
Von allen funktionalen Stilen der russischen Sprache wurden die auffälligsten Veränderungen in den letzten anderthalb Jahrzehnten in den Medien verzeichnet, was angesichts der globalen politischen und sozialen Veränderungen, die in Russland seit 1985 stattgefunden haben, natürlich und logisch ist. . ... Stilistisches Lexikon der russischen Sprache
- - ein Begriff, der in der Fachliteratur aufgrund der mehrdeutigen Interpretation der Kategorie der Ausdrucksstärke (siehe: Ausdrucksstärke der Sprache) unterschiedlich definiert wird. In den Arbeiten einiger Forscher V. s. werden mit Stilfiguren identifiziert (siehe zum Beispiel ... Stilistisches Lexikon der russischen Sprache
regulatorische Mittel- 1) sprachlich: rhythmisch-klanglich, lexikalisch, morphologisch, abgeleitet, syntaktisch, stilistisch; 2) außersprachlich: kompositorisch, logisch, graphisch Nach der Art des Folgenden im Text werden sie unterschieden: 1) ... ... Wörterbuch der sprachlichen Begriffe T.V. Fohlen
regulatorische Mittel- 1) sprachlich: rhythmisch-klanglich, lexikalisch, morphologisch, abgeleitet, syntaktisch, stilistisch; 2) außersprachlich: kompositorisch, logisch, graphisch. Nach Art des Textes wird unterschieden: ... ... Methoden der Recherche und Textanalyse. Wörterbuch-Referenz
stilistische Figuren- Redewendungen, die zu künstlerischen Zwecken gegen die übliche Zusammensetzung von Wörtern in syntaktischen Konstruktionen verstoßen. Die Auswahl und Verwendung bestimmter Figuren durch den Autor prägt den Stil seines Autors mit Individualität. Zahlenunterricht ... ... Literarische Enzyklopädie
Bücher
- Großes erklärendes Wörterbuch der korrekten russischen Sprache, Skvortsov Lev Ivanovich. Zum ersten Mal wird in der russischen Lexikographie ein vollständiges erklärendes Wörterbuch normativ-stilistischer Art erstellt. Das Wörterbuch umfasst orthoepische, lexikalische, phraseologische, grammatikalische und ...
Stilmittel und Ausdrucksmittel
Stilmittel und Ausdrucksmittel
In der Linguistik werden häufig folgende Begriffe verwendet: Ausdrucksmittel der Sprache, Ausdrucksmittel der Sprache, Stilmittel, Stilmittel. Diese Begriffe werden oft synonym verwendet, haben aber manchmal unterschiedliche Bedeutungen.
Es ist nicht einfach, eine klare Grenze zwischen den Ausdrucksmitteln der Sprache und den Stilmitteln der Sprache zu ziehen, obwohl es immer noch Unterschiede zwischen ihnen gibt.
Unter Ausdrucksmittel der Sprache wir werden solche morphologischen, syntaktischen und abgeleiteten Formen der Sprache verstehen, die dazu dienen, Sprache emotional oder logisch zu verstärken. Diese Sprachformen wurden von der gesellschaftlichen Praxis herausgearbeitet, unter dem Gesichtspunkt ihres funktionalen Zwecks verstanden und in Grammatiken und Wörterbüchern festgehalten. Ihre Verwendung normalisiert sich allmählich. Es werden Regeln für den Gebrauch solcher Ausdrucksmittel der Sprache entwickelt.
Was versteht man unter Stilmittel? Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir versuchen, die charakteristischen Merkmale dieses Konzepts zu definieren. Stilmittel wird durch die bewußte literarische Verarbeitung des sprachlichen Tatbestandes von den Ausdrucksmitteln unterschieden und damit entgegengesetzt. Diese bewußte literarische Verarbeitung sprachlicher Tatsachen, einschließlich derer, die wir sprachliche Ausdrucksmittel genannt haben, hat ihre eigene Geschichte. Sogar A. A. Potebnya schrieb: „Ausgehend von den alten Griechen und Römern und mit wenigen Ausnahmen bis zu unserer Zeit ist die Definition einer Wortfigur im Allgemeinen (ohne Unterscheidung zwischen einem Pfad und einer Figur) (d.h. was in der Begriff der Stilmittel ) verzichtet nicht darauf, einfache Rede, in der eigenen verwendet, zu widersprechen, natürlich, ursprüngliche Bedeutung und Sprache dekoriert, bildlich. eines
Die bewusste Verarbeitung der Fakten einer Sprache wurde oft als Abweichung von allgemein anerkannten Normen sprachlicher Kommunikation verstanden. So schreibt A. Ben: „Die Redewendung ist die Abweichung von der üblichen Ausdrucksweise, um den Eindruck zu verstärken.“ 2
In diesem Zusammenhang ist es interessant, die folgende Aussage von Vandries zu zitieren: „Künstlerischer Stil ist immer eine Reaktion gegen eine gemeinsame Sprache; gewissermaßen ist es Slang, literarischer Slang, der verschiedene Varianten haben kann ... "
Ein ähnlicher Gedanke wird von Sainsbury geäußert: "Das wahre Geheimnis des Stils liegt in der Verletzung oder Vernachlässigung der Regeln, nach denen Phrasen, Sätze und Absätze aufgebaut sind." (Unsere Übersetzung. ICH G)
Es versteht sich von selbst, dass das Wesen eines Stilmittels nicht in einer Abweichung von gängigen Normen liegen kann, da in diesem Fall das Stilmittel eigentlich der sprachlichen Norm entgegenstehen würde. In der Tat verwenden Stilmittel die Norm der Sprache, aber im Prozess ihrer Verwendung übernehmen sie die charakteristischsten Merkmale dieser Norm, sie verdichten sie, verallgemeinern und typisieren sie. Daher ist ein Stilmittel ein verallgemeinertes,
1 Potebnya A. A. Aus Anmerkungen zur Literaturtheorie. Charkow, 1905, S. 201.
2 Ben A. Stilistik und Theorie der mündlichen und schriftlichen Rede M., 1886, S. 8
typisierte Wiedergabe von neutralen und expressiven Tatsachen der Sprache in verschiedenen literarischen Sprachstilen. Lassen Sie uns dies anhand von Beispielen erläutern.
Es gibt ein Stilmittel, das als bekannt ist Maximen. Das Wesen dieser Technik liegt in der Wiedergabe der charakteristischen, typischen Merkmale eines Volkssprichwortes, insbesondere seiner strukturellen und semantischen Eigenschaften. Aussage - Maxime hat einen Rhythmus, Reim, manchmal Alliteration; Maxime - bildlich und epigrammatisch, d.h. drückt in prägnanter Form jeden verallgemeinerten Gedanken aus.
So werden Maxime und Sprichwort als Allgemeines und Individuelles einander zugeordnet. Dieses Individuum orientiert sich am Allgemeinen, nimmt das Charakteristischste, was für dieses Allgemeine charakteristisch ist, und auf dieser Grundlage wird ein bestimmtes Stilmittel geschaffen.
Das Stilmittel als Verallgemeinerung, Typisierung und Verdichtung sprachlich objektiv vorhandener Mittel ist keine naturalistische Wiedergabe dieser Mittel, sondern transformiert sie qualitativ. So ist beispielsweise die unangemessen direkte Rede (su) als Stilmittel eine Verallgemeinerung und Typisierung der charakteristischen Merkmale der inneren Sprache. Diese Technik transformiert jedoch die innere Sprache qualitativ. Letztere hat bekanntlich keine kommunikative Funktion; unrichtig direkte (dargestellte) Rede hat diese Funktion.
Es ist zu unterscheiden zwischen der Verwendung sprachlicher Fakten (sowohl neutral als auch expressiv) für stilistische Zwecke und dem bereits herauskristallisierten Stilmittel. Nicht jede stilistische Verwendung von Sprachmitteln schafft ein Stilmittel. So wiederholt der Autor beispielsweise in den obigen Beispielen aus Norris' Roman die Worte Ich und Du, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Aber diese Wiederholung, die im Mund der Helden des Romans möglich ist, gibt nur ihren emotionalen Zustand wieder.
Mit anderen Worten, bei emotional erregter Sprache ist die Wiederholung von Wörtern, die einen bestimmten mentalen Zustand des Sprechers ausdrücken, nicht auf Wirkung ausgelegt. Die Wiederholung von Wörtern in der Rede des Autors ist keine Folge einer solchen mentalen Verfassung des Sprechers und zielt auf eine bestimmte stilistische Wirkung ab. Es ist ein emotionales Stilmittel
Die Stilistik befasst sich mit einigen Spezialbegriffen, die nichts mit der rein sprachlichen Interpretation sprachlicher Kategorien zu tun haben.
Ausdrucksmittel sind phonetische Mittel, grammatikalische Formen, morphologische Formen, Wortbildungsmittel, lexikalische, phraseologische und syntaktische Formen, die in der Sprache zur emotionalen Steigerung der Äußerung fungieren.
Ausdrucksmittel werden verwendet, um die Aussagekraft der Aussage zu erhöhen, sie sind nicht mit den bildlichen Bedeutungen des Wortes verbunden.
Ausdrucksmittel = Wiederholungen, Parallelismen, Antithesen, phonetische Mittel, Verwendung von Archaismen, Neologismen usw.
Ein Stilmittel ist ein gezielter Einsatz sprachlicher Phänomene, einschließlich Ausdrucksmittel.
Ausdrucksmittel haben eine höhere Berechenbarkeit als Stilmittel.
Die Stilistik befasst sich mit Ausdrucksmitteln und Stilmitteln, deren Wesen, Funktionen, Einordnung und möglichen Interpretationen.
Klassifikation der Ausdrucksmittel (Urve Lehtsaalu):
lexikalische Gruppe (poetische Wörter, Archaismen, Dialektismen, Neologismen)
phonetische Gruppe (Rhythmus, Wohlklang (Wohlklang)
Grammatikgruppe (Umkehrung, elliptische Sätze, Wiederholung, Ausruf)
Beiname- Definition am Wort, die die Wahrnehmung des Autors ausdrückt:
silbernes Lachen
eine spannende Geschichte
ein scharfes Lächeln
Ein Epitheton hat immer eine emotionale Konnotation. Er charakterisiert das Objekt auf eine bestimmte künstlerische Weise, legt seine Eigenschaften offen.
ein Holztisch (Holztisch) - nur eine Beschreibung, ausgedrückt in einem Hinweis auf das Material, aus dem der Tisch besteht;
ein durchdringender Blick (durchdringender Blick) - ein Beiname.
Vergleich- ein Mittel zur Assimilation eines Objekts an ein anderes auf beliebiger Grundlage, um Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen ihnen festzustellen.
Der Junge scheint schlau zu sein wie seine Mutter. Der Junge scheint so schlau zu sein wie seine Mutter.
Ironie- ein Stilmittel, bei dem der Inhalt der Aussage eine andere Bedeutung hat als die direkte Bedeutung dieser Aussage. Der Hauptzweck der Ironie besteht darin, eine humorvolle Einstellung des Lesers zu den beschriebenen Tatsachen und Phänomenen hervorzurufen.
Sie drehte sich mit dem süßen Lächeln eines Alligators um. Sie drehte sich mit einem süßen Alligatorlächeln um.
Aber Ironie ist nicht immer lustig, sie kann grausam und beleidigend sein.
Wie schlau du bist! Du bist so schlau! (Die umgekehrte Bedeutung ist impliziert - dumm.)
Übertreibung (Übertreibung)- eine Übertreibung, die darauf abzielt, die Bedeutung und Emotionalität der Aussage zu verstärken.
Ich habe es dir schon tausendmal gesagt. Das habe ich dir schon tausendmal gesagt.
Litota/Understatement (Litotes/
Untertreibung)
- Untertreibung der Größe oder des Wertes eines Objekts. Litota ist das Gegenteil von Übertreibung.
ein katzengroßes Pferd
Ihr Gesicht ist nicht schlecht, sie hat ein gutes Gesicht (anstelle von „gut“ oder „schön“).
Periphrase / Paraphrase / Periphrase (Umschreibung)- ein indirekter Ausdruck eines Begriffs mit Hilfe eines anderen, dessen Erwähnung nicht durch direkte Benennung, sondern durch Beschreibung erfolgt.
Der große Mann oben hört deine Gebete. Der große Mann oben hört Ihre Gebete (der „große Mann“ bedeutet Gott).
Euphemismus- ein neutrales Ausdrucksmittel, das verwendet wird, um unkultivierte und unhöfliche Wörter in der Sprache durch weichere zu ersetzen.
Toilette → Toilette/Klo
Oxymoron (Oxymoron)- Erstellen eines Widerspruchs durch Kombinieren von Wörtern mit entgegengesetzter Bedeutung. Das Leiden war süß! Das Leiden war süß!
Zeugma (Zeugma)- Weglassen von wiederholten Wörtern in der gleichen Art von syntaktischen Konstruktionen, um einen humorvollen Effekt zu erzielen.
Sie verlor ihre Tasche und ihren Verstand. Sie verlor ihre Tasche und ihren Verstand.
Metapher- Übertragung des Namens und der Eigenschaften eines Objekts auf ein anderes nach dem Prinzip ihrer Ähnlichkeit.
Fluten von Tränen
ein Sturm der Empörung
ein Schatten eines Lächelns
Pfannkuchen/Kugel → die Sonne
Metonymie- Umbenennung; ein Wort durch ein anderes ersetzen.
Hinweis: Metonymie sollte von Metapher unterschieden werden. Metonymie basiert auf Kontiguität, auf der Assoziation von Objekten. Metapher basiert auf Ähnlichkeit.
Beispiele für Metonymie:
Der Saal applaudierte. Der Saal begrüßt (mit „Saal“ ist nicht der Raum gemeint, sondern das Publikum im Saal).
Der Eimer ist umgekippt. Der Eimer spritzte (nicht der Eimer selbst, sondern das Wasser darin).
Synekdoche (Synekdoche)- ein Sonderfall der Metonymie; Benennen des Ganzen durch seinen Teil und umgekehrt.
Der Käufer wählt die Qualitätsprodukte. Der Käufer entscheidet sich für Qualitätsware (mit „Käufer“ sind allgemein alle Käufer gemeint).
Antonomasie (Antonomasie)- eine Art Metonymie. Anstelle eines Eigennamens wird ein beschreibender Ausdruck gesetzt.
Die eiserne Frau
Casanova Casanova
Herr. Allwissender Herr Allwissender
Umkehrung- eine vollständige oder teilweise Änderung der direkten Reihenfolge von Wörtern in einem Satz. Inversion erzeugt logische Spannung und schafft emotionale Färbung.
Unhöflich bin ich in meiner Rede. Ich bin unhöflich in meiner Rede.
Wiederholung- Ausdrucksmittel, die der Sprecher in einem Zustand emotionaler Anspannung, Stress verwendet. Sie drückt sich in der Wiederholung semantischer Wörter aus.
Halt! Sag es mir nicht, ich will das nicht hören! Ich will nicht hören, warum Sie gekommen sind. Hör auf! Erzähl es mir nicht! Ich will das nicht hören! Ich will nicht hören, warum du zurückgekommen bist.
Anadiplose (Anadiplose)- Verwenden Sie die letzten Wörter des vorherigen Satzes als Anfangswörter des nächsten.
Ich stieg auf den Turm und die Treppe zitterte. Und die Treppe zitterte unter meinen Füßen. Ich stieg auf den Turm, und die Stufen zitterten. Und die Schritte zitterten unter meinen Füßen.
Epiphora (Epiphora)- die Verwendung desselben Wortes oder derselben Wortgruppe am Ende mehrerer Sätze.
Kraft gibt mir das Schicksal. Das Glück ist mir vom Schicksal geschenkt. Und Misserfolge sind vom Schicksal gegeben. Alles auf dieser Welt ist vom Schicksal gegeben. Kräfte sind mir vom Schicksal gegeben. Das Glück ist mir vom Schicksal geschenkt. Und das Scheitern ist mir vom Schicksal gegeben. Alles auf der Welt wird vom Schicksal bestimmt.
Anaphora / Monogamie (Anaphora)- Wiederholung von Lauten, Wörtern oder Wortgruppen zu Beginn jeder Sprechpassage.
Was ist der Hammer? Was ist die Kette? Wem war der Hammer, wessen Ketten,
In welchem Ofen war dein Gehirn? Um deine Träume zu halten?
Was ist der Amboss? Was für ein schrecklicher Griff
Darf es sein tödlicher Schrecken umklammern? Haben Sie Todesangst?
(„Der Tiger“ von William Blake; Übersetzung von Balmont)
Polysydeton / Polyunion (Polysyndeton)- eine absichtliche Erhöhung der Anzahl von Gewerkschaften in einem Satz, normalerweise zwischen homogenen Mitgliedern. Dieses Stilmittel betont die Bedeutung jedes Wortes und steigert die Ausdruckskraft der Sprache.
Ich werde entweder auf die Party gehen oder lernen oder fernsehen oder schlafen. Ich werde entweder auf eine Party gehen oder für eine Prüfung lernen oder fernsehen oder ins Bett gehen.
Antithese/Kontraposition (Antithese/Kontraposition)- Vergleich von Bildern und Konzepten mit entgegengesetzter Bedeutung oder entgegengesetzten Emotionen, Gefühlen und Erfahrungen des Helden oder Autors.
Jugend ist schön, Alter ist einsam, Jugend ist feurig, Alter ist frostig. Jugend ist schön, Alter ist einsam, Jugend ist feurig, Alter ist frostig.
Wichtig: Antithesis und Antithesis sind zwei unterschiedliche Konzepte, aber im Englischen werden sie mit dem gleichen Wort antithesis [æn „t???s?s] bezeichnet. Eine These ist ein von einer Person aufgestelltes Urteil, das sie in irgendeiner Begründung beweist , und Antithese - ein Satz gegenüber der These.
Ellipse- absichtliches Auslassen von Wörtern, die den Sinn der Aussage nicht beeinträchtigen.
Manche Leute gehen zu Priestern; andere zur Poesie; Ich zu meinen Freunden. Manche Leute gehen zu Priestern, andere zur Poesie, ich gehe zu Freunden.
Aposiopese (Aposiopese])- ein plötzlicher Sprachstillstand, der es unvollendet macht; einen Satz abbrechen und einen neuen beginnen.
Ich, wenn ich nur könnte ... Aber jetzt ist nicht die Zeit, es zu sagen. Wenn ich nur könnte, ich... Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen (anstelle von Auslassungspunkten kann im Englischen ein Bindestrich verwendet werden. Weitere Informationen über Satzzeichen finden Sie im Material „Satzzeichen“).
Rhetorische Frage (Rhetorik / rhetorische Fragen)- eine Frage, die keiner Antwort bedarf, da sie bereits im Voraus bekannt ist. Eine rhetorische Frage wird verwendet, um die Bedeutung der Aussage zu verstärken, ihr größere Bedeutung zu verleihen.
Hast du gerade etwas gesagt? Hast du was gesagt? (Wie eine Frage, die von einer Person gestellt wird, die die Worte einer anderen Person nicht gehört hat. Diese Frage wird nicht gestellt, um herauszufinden, ob die Person überhaupt etwas gesagt hat oder nicht, da dies bereits bekannt ist, sondern um genau herauszufinden, was sie gesagt hat sagte.
Wortspiel/Wortspiel (Wortspiel)- Witze und Rätsel, die ein Wortspiel enthalten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schulmeister und einem Lokführer?
(Einer schult den Geist und der andere kümmert sich um den Zug.)
Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Maschinisten?
(Einer führt unsere Gedanken, der andere weiß, wie man einen Zug fährt).
Zwischenruf- ein Wort, das dazu dient, Gefühle, Empfindungen, Geisteszustände usw. auszudrücken, sie aber nicht benennt.
Oh! Oh! Ah! Ö! Oh! Autsch! Oh!
Aha! (Aha!)
Puh! Pfui! Puh! Pfui!
Meine Güte! Verdammt! Oh Scheiße!
Stille! Ruhig! Pssst! Stille!
Bußgeld! Gut!
Yah! Ach was?
Gnädiges Ich! Gnädig! Väter!
Christus! Jesus! Jesus Christus! Ach du meine Güte! Gute Güte! Du lieber Himmel! Ach du lieber Gott!
Klischee/Stempel (Klischee)- ein Ausdruck, der banal und abgedroschen geworden ist.
Lebe und lerne. Lebe und lerne.
SprichwörterundSprüche(Sprichwörter und Redensarten).
Ein geschlossener Mund fängt keine Fliegen. In einem geschlossenen Mund fliegt eine Fliege nicht.
Idiom / Floskel (Idiom / Floskel)- ein Satz, dessen Bedeutung nicht durch die Bedeutung der darin enthaltenen Wörter für sich genommen bestimmt wird. Dadurch, dass die Redewendung nicht wörtlich übersetzt werden kann (Bedeutung geht verloren), kommt es häufig zu Übersetzungs- und Verständnisschwierigkeiten. Andererseits verleihen solche sprachlichen Einheiten der Sprache eine helle emotionale Färbung.
Egal
Wolke Stirnrunzeln
Stilbildend werden mit aktivem Stilverständnis alle sprachlichen Mittel und Mittel, die darauf abzielen, die sinnvolle Originalität des Textes in seiner sprachlichen Gestaltung wiederzugeben: im Verhältnis kommunikationsspezifischer Texteinheiten, in der Komposition etc.
Mittels subjektiver (ausdrucks-emotional-bewertender) und funktionaler Eigenschaften, die die fachlogischen und grammatikalischen Bedeutungen einer Spracheinheit ergänzen, kann die sinnstiftende Originalität des Textes betont, verstärkt, intensiviert werden. Die Idee der Komplementarität, d.h. sekundäre ™, die subjektive Komponente der Semantik einer sprachlichen Einheit, ist durchaus umstritten. Beobachtungen der russischen Sprache zeigen, dass sachlogische und emotionale Komponenten in unterschiedlichen Anteilen im Inhalt von Spracheinheiten kombiniert werden. Wenn wir die semantischen Merkmale von Wörtern vergleichen Dunce, blutig, Satrap in denen emotional-bewertende Informationen deutlich dominieren, und Zwischenrufe, die Gefühle ausdrücken (gut gut, oh, ja du), wenn er eindeutig ist, stellen wir sicher, dass alle Komponenten des Werts als potenziell gleich angesehen werden können.
Stilistische Färbung ist jede Färbung einer Spracheinheit, also fachlich, gattungsmäßig, landesspezifisch, sowie gesellschaftspolitisch, moralisch und ethisch etc.
Alle stilistischen Nuancen offenbaren sich auf dem Foyer in neutraler stilistischer Farbgebung. Neutrale Einheiten sind solche, die in allen Kommunikationsbereichen und in allen Genres verwendet werden, keine stilistischen Schattierungen in sie einbringen und keine emotional ausdrucksstarke Farbgebung haben. Zum Beispiel in einem Satz Jakob hat einen Fisch gefangen Einstellung zum Thema Rede wird nicht ausgedrückt, sondern im Satz Jakob hat einen großen Fisch gefangen eine solche Haltung wird ausgedrückt.
Jede Art von stilistischer Färbung wird als Manifestation des subjektiven Prinzips gebildet. Arten der stilistischen Färbung sind unterschiedlicher Natur. In der russischen Sprache werden vor dem Hintergrund neutraler Sprachmittel die Mittel der buchschriftlichen und der mündlich-umgangssprachlichen Rede unterschieden.
Sprachmittel, die vor allem im Bereich des geschriebenen Buches verwendet werden, sind in Wörterbüchern als „bookish“ gekennzeichnet, ein Hinweis auf ihre stilistische Färbung. Als „umgangssprachlich“ werden Mittel bezeichnet, die der Rede einen umgangssprachlichen Charakter verleihen. Die stilistische Färbung des Buch- und Umgangswortschatzes zeigt sich vor dem Hintergrund des neutralen Wortschatzes beispielsweise in einer Reihe von Synonymen: Dinge(neutral) - Eigentum(neutral) - Besitz; Bestrafung(neutral) - kara - aufholen. Die Einführung eines umgangssprachlichen Anfangs in die Buchsprache verkompliziert ihr stilistisches Muster und führt verschiedene Farben ein - ironisch, intim usw. Siehe zum Beispiel in einem Interview: Kulturpolitik könnte darin bestehen, das örtliche Museum für Gurke, Maus, Wodka oder was auch immer zu fördern.(Funke. 15.07.2013). Die Umgangssprache wiederum kann den sogenannten Schatten der Bücherei erhalten. Vergleichen Sie zum Beispiel den Ausdruck von Ironie im alltäglichen Dialog: „Na, wie gefällt Ihnen die Ausstellung?“ - « Weißt du, ich bin überhaupt nicht auf dieses Kunstkonzept von ihnen gekommen.“
Vor dem Hintergrund neutraler Mittel hebt sich eine breite Palette von Mitteln mit einer stabilen emotionalen und expressiven Färbung ab: ironisch, missbilligend, verächtlich, liebevoll, feierlich optimistisch usw. Diese Färbung ist durch die Präsenz im Sinne des Wortes bewertend ™ gegeben - Einstellung zum Thema Sprache, die ihre Benennungsfunktion stark erschwert (oft durch Emotionalität): Stümper, Chaot, Nörgler, Müßiggänger, Muff, Hysterie, Lord, Gabe, Allmächtiger usw. Auch im übertragenen Sinne erhält das Wort eine wertende und expressive Färbung: ein Spielzeug(Missbilligung einer Person, die blind nach dem Willen eines anderen handelt), auftauchen(über etwas Negatives, unerwartet manifestiertes), Mantel(scherzhaft über ungeschickte Kleidung), weiches Gesicht nach dem Kampf(hier die geschätzte Bedeutung des Wortes weich gekocht - verächtlich oder missbilligend - hängt von der Einstellung des Redners zu den Kampfteilnehmern ab). Emotionalität, Ausdruckskraft und allgemein stilistische Konnotationen werden Wörtern auch durch Anfügungen (vor allem Suffixe) verliehen: Mama, Zuhause, Oma, Hände, Licht usw.
Wertung und Ausdruckskraft können sich nicht in der Bedeutung des Wortes (zunächst jedenfalls) manifestieren, sondern in der Tradition des Gebrauchs, die dessen Bedeutung transformiert oder reflektiert.
Das Vorhandensein einer stilistischen Konnotation in solchen Worten - Erhabenheit, Feierlichkeit, Rhetorik usw. durch die Tradition ihrer Verwendung in Texten bestimmt. In der Regel haben diese Wörter eine Bedeutung von Intensität positiver Qualität: Orgie('Lautsprecher'), Übertragung(„sprechen, verkünden“), Schrei('die Anschrift'), antizipieren, gut(„gut, lobenswert“), Wagen('verfolgen'). Manchmal verleiht die Tradition des Gebrauchs dem Wort Ausdruckskraft, aber es werden keine semantischen Änderungen darin beobachtet: oratay('Pflüger'), Akkordeon(„Sänger, Dichter“), künstlich, Ruder, Armee, Kohorte usw.
Es gibt zwei Arten emotional ausdrucksstarker Färbung: mit positiver (meliorativer) und mit negativer (pejorativer) Bewertung. Zu den verbessernden Schattierungen gehören solche wie feierlich, erhaben, rhetorisch, erhaben poetisch, zustimmend, verspielt usw. In der russischen Sprache gibt es eine außergewöhnliche Vielfalt abwertender Schattierungen, die sich als missbilligend, verächtlich, vorwurfsvoll, abweisend-vertraut, beleidigend usw. qualifizieren.
Bewertende Schattierungen werden in emotional-bewertende unterschieden: groß, schlaksig, faul, charmant, kriminell, feurig, Krieger, Mitarbeiter, von nun an usw. - und rational-wertend: ungünstig, nützlich, mangelhaft, gesund, wirksam, unglücklich usw.
Die funktionale und stilistische Färbung sprachlicher Mittel ergibt sich aus ihrer traditionellen Bindung an eine bestimmte Sprachsphäre. Die Mittel der Buchstile sind unterteilt in wissenschaftliche, amtliche, journalistische, religiöse, künstlerische. So zeichnen sich Einheiten des wissenschaftlichen Stils durch Neutralität, „Trockenheit“, unterstrichen durch Sachlichkeit aus. Diese Merkmale verleihen der Sprache die für diesen Stil charakteristische Abstraktion und Verallgemeinerung. Besondere „Trockenheit“ in emotionaler und expressiver Hinsicht zeichnet sich durch offiziellen Geschäftsstil aus.
Mittel mit emotional expressiver Färbung sind systemisch, da sie durch den Umfang ihrer Verwendung normativ begrenzt sind.
Die Frage der funktionalen und stilistischen Färbung künstlerischer Redemittel ist nicht einfach zu lösen, da in künstlerischen Texten das gesamte Arsenal sprachlicher Mittel aktiv eingesetzt wird. Dennoch lassen sich sprachliche Mittel herausgreifen, die spezifisch für die künstlerische Sprache sind, insbesondere für Texte der klassischen Literatur. Solche Mittel sind zum Beispiel poetisches Vokabular: Krone, Wangen, Mund, Gesicht oder volkspoetischem Vokabular, das aus der Sprache der mündlichen Volkspoesie stammt: rotes Mädchen, guter Kerl, wildes Köpfchen, grüne Eiche usw.
Der religiöse Stil ist geprägt von Pathos, Feierlichkeit, die durch die Verwendung von Mitteln mit der entsprechenden Farbe entsteht: der vom Himmel herabsteigt, der Weg der Prüfungen und Erwartungen, wirklich, glaube ich, die Durchführung eines Gebetsgottesdienstes usw.
Die Existenz spezifischer journalistischer Stilmittel, wie etwa des Vokabulars, wird manchmal bestritten. Bei der Analyse von spezifischem Material wurden jedoch journalistisches Vokabular und Phraseologie identifiziert, journalistische Mittel anderer Sprachniveaus identifiziert. Dadurch, dass die Rolle der Massenmedien bei der Gestaltung des „Stilbildes der Zeit“ stark zugenommen hat, bilden sich solche journalistischen Mittel heraus, die sich durch eine eigentümliche Kombination von Ausdruck und Anspruch auszeichnen. Eine expressiv-emotionale Färbung haben beispielsweise gesellschaftliche und politische Terminologien, die in Medientexten rege verwendet werden: Populismus, Aggression, Korruption, Bürokratie usw.
Bei der Untersuchung der kommunikativ sinnvollen Gestaltung von Sprachvarietäten werden all diejenigen Sprachmittel und Merkmale ihres Gebrauchs als stilistisch bedeutsam angesehen, die zur effektivsten Umsetzung der kommunikativen Aufgaben eines bestimmten Bereichs beitragen.
In jeder Sprachvarietät werden stilistische Farben geschaffen und aktiviert, die durch den Bereich und die Bedingungen der Kommunikation, die Zweckmäßigkeit des Sprechakts bestimmt werden. Die verstärkte Verwendung funktionalstilspezifischer Einheiten erzeugt eine spezifische Makro-Färbung des Stils.
Stilistische Farben werden in der Sprache in Interaktion verwendet und tragen zum Ausdruck der kommunikativen Haltung des Autors bei - Intentionalität.
Unter modernen Bedingungen dringt das umgangssprachliche Vokabular intensiv in die Buch- und Schriftmediensprache ein, Sprachmittel emotionaler und rationaler Bewertungsschichten wirken darin zusammen. Nur durch den gekonnten Einsatz verschiedenster stilistisch gefärbter Vokabeln wird ein Profi seine Kommunikationsziele erreichen können.
Bei der Verwendung stilistisch gefärbter Mittel ist es wichtig zu verstehen, dass dasselbe Wort mehrere stilistische Schattierungen haben kann. Ja, das Wort Doppelhändler wird in Wörterbüchern von den Markierungen "buchstäblich", "journalistisch", "verächtlich" und dem Wort begleitet Bauer -„umgangssprachlich“ und „missbräuchlich“. Zudem kann ein expressiv-emotional gefärbtes Wort je nach Kontext seine stilistische Konnotation modifizieren.
Vergleichen Sie zum Beispiel die Verwendung des Wortes inspiriert(in Wörterbüchern mit "hoch"): Sie ging nicht hinaus – sie flog hinaus auf die Bühne, so war die glühende Liebe zum Tanzen, und dieser inspirierende Flug machte Ballettaufführungen mit ihrer Teilnahme unvergesslich(Komsomol. Wahrheit. 24.12.2008); Dieser inspirierende Monolog wurde durch die Bitte des Schaffners ausgelöst, das Fahrgeld zu bezahlen.(Komsomol. Wahrheit. 16.07.2008) - wenn im ersten Beispiel inspiriert seine gewohnten stilistischen Merkmale behält, dann wird es im zweiten ironisch eingesetzt.
Spracheinheiten, die keine stabile stilistische Färbung haben, haben ein konnotatives Potential, das genutzt werden kann, um die verschiedenen Intentionen des Sprechers zu realisieren, meist unter Verwendung von Tropen und Redewendungen.
- Kozhina M. N. Duskaeva L. R., Salimovsky V. A. Stilistik der russischen Sprache. S. 86.
- Einzelheiten dazu siehe: Solganik G. Ya.Vokabular der Zeitung (funktionaler Aspekt). M., 1981.