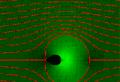Feudales Lehen im fränkischen Staat. Organisation des Großgrundbesitzes im fränkischen Staat. Feudales Anwesen. Die Stellung der abhängigen Bauernschaft
Senden Sie Ihre gute Arbeit in die Wissensdatenbank ist einfach. Verwenden Sie das untenstehende Formular
Studenten, Doktoranden, junge Wissenschaftler, die die Wissensbasis in ihrem Studium und ihrer Arbeit nutzen, werden Ihnen sehr dankbar sein.
Einführung
Mittelalter als Epoche und Feudalismus als Gesellschaftsformation deckten sich nicht vollständig, sondern nur allgemein. Dies erklärt sich vor allem aus der Ungleichmäßigkeit der historischen Entwicklung, ihrer Asynchronität nicht nur in verschiedenen Regionen und Ländern, sondern oft sogar in verschiedenen Regionen desselben Landes.
Zu Beginn des Mittelalters und des Feudalismus in Europa gab es wirklich zwei Gesellschaftssysteme, zwei verschiedene Welten. Die erste ist uralt, sklavenhaltend, bereits christlich und für ihre Zeit hoch entwickelt; zusätzlich zu den Griechen und Römern wurden die Kelten Galliens, die Bewohner der Iberischen Halbinsel und bis zu einem gewissen Grad die Stämme des Nordbalkans und Britanniens hineingezogen. Eine andere, umfangreichere war die Welt der Barbaren: Stammesangehörige, Heiden, mit ihrem eigenen einzigartigen Aussehen, die das Klassensystem noch nicht kannten. Die kulturelle Kluft zwischen ihnen war riesig, scheinbar unüberwindbar. Aber im Mittelalter, als die Entstehung und Entwicklung des Feudalismus den gesamten Kontinent erfasste, als Verbindungen geknüpft und gefestigt wurden, der gegenseitige Einfluss verschiedener ethnischer Gruppen, Ereignisse, Phänomene und Institutionen zunahm, glätteten sich diese Unterschiede allmählich.
Im Mittelalter betraten die Völker unseres Kontinents als unabhängige politische Kräfte die gesamteuropäische Arena. Der Raum Europas wurde im Vergleich zur Antike immer "gesättigter": Die Bevölkerung wuchs, neue Staatsformationen entstanden, die Kommunikation zwischen ihnen wurde vielfältiger. Und Europa verwandelte sich in eine qualitativ neue Zivilisation.
Europäische feudale Gesellschaften waren nicht nur dynamischer als alte Gesellschaften, sondern auch zeitgenössische in anderen Teilen der Welt. Im Vergleich zu späteren Epochen verlief die gesellschaftliche Entwicklung des Mittelalters in Europa jedoch langsam. Manuelle Produktion, die direkte Übertragung von Produktions- und Haushaltsfertigkeiten, die Unterentwicklung des Handels begrenzt die Arbeitsproduktivität. Die Primitivität der Kommunikationsmittel erschwerte die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch. Das niedrige Niveau an Technologie und Wissen machte einen Menschen abhängig von den natürlichen Lebensbedingungen: der natürlichen Umwelt und ihren Launen, demografischen Katastrophen. Krankheiten von Menschen und Vieh, Ernteausfälle, häufige Hungersnöte und Kriege reduzierten drastisch den materiellen Reichtum und das Leben der Menschen. Die Requisitionen der Grundbesitzer, des Staates und der Kirche verschärften die Schwierigkeiten für die Mehrheit der Bevölkerung. Die Stärke der Tradition, der dogmatische Zwang des Denkens erschwerten Innovationen in allen Lebensbereichen.
Die Organisation des Großgrundbesitzes im Feudalbesitz der Karolingerzeit ist eine der Hauptetappen in der weiteren historischen Entwicklung Europas.
1.FRang Zustand. Karolinger
Die Franken sind eine Stammesunion, die sich im 3. Jahrhundert n. Chr. entwickelte. aus der deutschen Bevölkerung des Unterlaufs des Rheins und der nächstgelegenen Nordseeküste. Die bekannte Interpretation des Ethnonyms Frank – „frei“ – entstand später und wurde zunächst als „schnell“, „ungezügelt“ verstanden. Die erste römische Erwähnung von Franci stammt aus dem Jahr 275.
Ab dem 4. Jahrhundert begannen die Franken allmählich in das nordwestliche Gallien einzudringen. Ihre Entwicklung von ganz Gallien dauerte mehrere Jahrhunderte. Bis zur Mitte des 5. Jh. nicht mehr als 200.000 Franken wurden dort abgerechnet. Die Vorherrschaft der Deutschen ist seit dem 7. Jahrhundert und ihre Entwicklung zur führenden Volksgruppe seit dem 9. Jahrhundert zu verzeichnen. Doch zunächst ließen sich die Barbaren unter ihren gewohnten Bedingungen nieder – in feuchten Flusstälern, während die lokale Bevölkerung, die die Brandrodung längst vergessen hatte und eine geregelte Fruchtfolge kannte, auf trockenen und fruchtbaren Küstenterrassen lebte. Als Minderheit vermischten sich die Deutschen zunächst nicht mit der indigenen Bevölkerung, sondern lebten in ihren blutsverwandten Gruppen und Gemeinschaften.
Noch während der Herrschaft der Westgoten in Italien vereinigte das kriegerische Chlodion (ca. 427-447) die salischen Franken, unterwarf das gesamte Gebiet des heutigen Belgiens, erreichte die Somme, kollidierte dann aber mit den Römern, wurde von Aetius und den Die Franken wurden Föderierte der Römer und fassten im nordwestlichen Gallien Fuß. Chlodions Nachfolger war Merovei (447-456), der der Dynastie den Namen gab. Der Sohn und Nachfolger von Merovei - Childeric I (456-481) zeichnete sich der Legende nach durch Ausschweifungen aus, verführte die Töchter freier Franken, wofür er von Untertanen vertrieben wurde, die sich unter der Schirmherrschaft des Oberhauptes der Gallo- Römischer Staat Egidius. Childerich floh über den Rhein zu den Thüringern, verführte dort Königin Basina, mit der er, von Egidien desillusioniert, auf Ruf der Franken in sein Reich zurückkehrte. Bazina wurde die Mutter des fränkischen Staatsgründers Clovis.
Das wichtigste Ereignis der weiteren Regentschaft Chlodwigs war die Taufe, der seine Heirat mit der burgundischen Prinzessin Clotilde, einer frommen Katholikin, vorausging. Unter dem Einfluss seiner Frau und nach dem Sieg über die Alemannen, um den er Christus bat, wurde Chlodwig am 25. Dezember 496 mit seinem dreitausendköpfigen Gefolge in Reims getauft.
Als Enkel des Adligen Frank Merovei gründete Chlodwig die merowingische Dynastie, die bis 687 bestand.
Die fränkische Gemeinde ist zu einer territorialen Organisation geworden, die benachbarte Landnutzer vereint. Eine solche Gemeinschaft, die völlig unabhängige Landbesitzer-Allodisten vereinte, wurde als Marke bezeichnet. Gleichzeitig gab es kein unbedingtes Privateigentum im modernen Sinne. Das Eigentum des Gemeindemitglieds waren nur die Grundstücke, in die Arbeit investiert wurde. In anderen Fällen war das Eigentum nicht das Grundstück, sondern nur das, was sich darauf befand. Aber die Rechte an markierten Bäumen im Gemeindewald blieben nur für 1 Jahr bestehen.
Die Franken, wie auch andere Deutsche, fühlten sich der Allod noch stärker verpflichtet als die Römer dem Privateigentum, denn nur die Anwesenheit der Allod war ein Beweis für persönliche Freiheit und öffentliche Vollrechte. Daher in den V-VII Jahrhunderten. Allod wurde nicht so sehr als Eigentum wahrgenommen, sondern als Erbe, das untrennbar mit der Familie verbunden war. In dieser Form entstand Allod unter römischem Einfluss bei den Franken in Gallien. In den Gemeinden lebten neben vollwertigen Franken auch unvollständige - Litas und sogar Sklaven (Leibeigene). Wahrscheinlich dienten sie den Adligen. Denken Sie daran, dass die Deutschen Adelsfamilien betrachteten, aus denen Militärführer, Älteste und andere Beamte ausgewählt wurden. Mit der Bildung der königlichen Macht werden die Kommunalspitzen zur untersten Schicht der damals noch nicht so zahlreichen königlichen Verwaltung. Die Allod mit dem Recht auf Verwandtschaftsverzicht trug zum Austritt dieser Schicht aus der Markengemeinschaft und letztlich zur Isolierung des Adels mit seinem Landbesitz von der einfachen Bevölkerung bei. Darüber hinaus erhielt die Königsgewalt als oberste Gewalt das Verfügungsrecht über unbesetzte, freie Gemeindeländereien. Auf diesen Ländereien haben die Könige ihr Volk angesiedelt, auch auf die Rechte der Allodisten. Für ihre Ansiedlung war die Zustimmung der Gemeindemitglieder nicht mehr erforderlich.
Im 6. Jahrhundert gab es jedoch noch örtliche Gerichtsassessoren – Rakhinburgs, die vom Volk gewählt wurden. Die Einmischung der Grafen in ihre Angelegenheiten wurde mit der Todesstrafe geahndet, was von der langsamen Auflösung der Stammesinstitutionen unter den Merowingern zeugte. Obwohl die Grafen, die in ihren Grafschaften fast die volle Macht hatten, allmählich so stark wurden und zu Großgrundbesitzern wurden, dass sie mit den Königen um eine unabhängige Existenz von ihnen kämpften. Herzöge und andere Adlige verhielten sich später ähnlich.
Der soziale Differenzierungsprozess der fränkischen Gesellschaft führte zur Bildung eines besonderen Verwaltungsapparates, des sogenannten Staates. Unter den Merowingern war es schwach, amorph. Die Macht in der Person des Königs und des Adels hatte noch nicht in die Grundrechte der freien Franken eingegriffen, die Allods besaßen, sich an der Miliz und den Wahlen der lokalen Regierungen beteiligten und hauptsächlich durch die Ausbeutung der Unterlegenen in ihrem Besitz existierten - Sklaven und Litas. Daher können Staat und Gesellschaft in dieser Epoche als vor- oder protofeudal bezeichnet werden.
Zeugnis der Festigung der fränkischen Gesellschaft und der Staatlichkeit war die Kodifizierung des Gewohnheitsrechts, die sich im Erscheinen der „salischen Wahrheit“ ausdrückte. Künftig kamen alle staatlichen Gesetzgebungsakte von den Königen.
Nach dem Tod von Clovis im Jahr 511 wurde der Staat unter seinen vier Söhnen aufgeteilt. Nach Brauch wurde das Erbe ohne Bevorzugung des Ältesten zu gleichen Teilen aufgeteilt. Es gab auch keine Hauptstadt, obwohl Clovis die Bedeutung von Paris verstand und dort begraben wurde. Laut Teilung ging Paris an den mittleren Sohn. Die Besitztümer der Brüder befanden sich in Streifen. Die Brüder führten gemeinsam die Eroberungen an. Doch das Gleichheitsprinzip führte zwangsläufig zum Zerfall des gemeinsamen Staates, der dann nur noch mit Gewalt verhindert werden konnte. Nach dem Tod eines der Brüder, des grausamsten der Söhne von Clovis – des jüngsten – schlachtete Chlothar persönlich zwei minderjährige Neffen ab, nahm später einen weiteren Neffen gefangen und verbrannte ihn mit seiner Frau und zwei Töchtern in einer Hütte. Er befindet sich also in der Mitte des VI. Jahrhunderts. vereinigte alle fränkischen Länder, starb aber bald und musste das Land erneut teilen, einmal zwischen den Kindern von Chlothar I., dann ihren Frauen - während des sogenannten Zwei-Königinnen-Krieges. Neben den persönlichen Ambitionen der Herrscher sorgte die ungleichmäßige Entwicklung verschiedener Regionen des Königreichs für Streit.
Die ehemaligen königlichen Militärdiener, die sich auf dem Boden niederließen und es mit den Rechten von Allods, dh mit Eigentum, erhielten, wurden durch den Dienst belastet und verwandelten sich in praktisch unabhängige lokale Verwalter. Mangels Herrschaftskraft verloren die letzten Merowinger das Interesse an aktiver Politik, schlossen sich in ihren Gütern ein, zogen die Jagd allem vor und ... degenerierten als Monarchen. Nach dem Brauch der Merowinger, die die Krone im Kindesalter erhielten, wurden sie bereits im Alter von 14 bis 15 Jahren Väter. Aufgrund der Exzesse stürmischer Jugend lebten sie meist nur bis zu 24-25 Jahre. Sie schnitten sich nie die Haare nach Stammestradition, sie wuchsen wild, lebten zurückgezogen auf ihren Ländereien, reisten wie Bauern in Ochsenkarren und hatten keine Ahnung von Staatsangelegenheiten. Das Land wurde von Bürgermeistern regiert, die normalerweise zu einer solch desaströsen Lebensweise ihrer Herrenkönige beitrugen. Es gab auch 3 davon - in Neustrien, Burgund und Austrasien.
Der Adel nutzt die Apathie der Könige aus und beginnt, sich kommunale Ländereien anzueignen und die Bauern selbst zu unterwerfen, sie zu zwingen, sich selbst zu dienen, und ihnen ihre Landrechte zu entziehen. Schwache Könige brauchten keine Bauernmiliz, und sie verteidigten die Bauern nicht, und sie hatten nicht die Kraft dazu. Aber die Unzufriedenheit der einfachen Bevölkerung wurde vom Bürgermeister von Austrasien, Pepin Geristalsky, ausgenutzt. Es gelang ihm, alle Franken zu vereinen und wurde ab 687 alleiniger Bürgermeister des Königreichs. Unter ihm wurden die merowingischen Fürsten in Klöstern erzogen und unter zuverlässiger Aufsicht gehalten, bis die Wahl des Bürgermeisters auf sie fiel. Als sie zur Welt gebracht wurden, ließen sie ihre Haare wachsen und führten zeremonielle Funktionen durch. Als Könige lebten sie auf bescheidenen Gütern, von wo sie in einem einfachen Wagen, der von zwei Ochsen gezogen wurde, in Begleitung zum Palast gebracht wurden, um ausländische Botschafter zu empfangen, oder zu den jährlichen öffentlichen Versammlungen im März.
So waren in der fränkischen Gesellschaft in der merowingischen Zeit herrschende Klasse und staatliche, königliche Macht bereits vollständig voneinander getrennt. Aber der Großteil der Bevölkerung blieb frei und wurde nicht ausgebeutet. Die Hauptfunktion der herrschenden Klasse bestand darin, die Bevölkerung zu verwalten, zu konsolidieren, sie und das besetzte Gebiet zu schützen sowie andere Ländereien zu erobern, um den Reichtum und den Einfluss des Adels zu vergrößern. Und erst allmählich beginnt die in erfolgreichen Kriegen erstarkte herrschende Klasse, ihre eigenen Gemeindemitglieder zu unterjochen.
Das Wohlergehen der herrschenden Klasse hing also nicht mehr von Geschenken der königlichen Tafel ab, sondern vom Landbesitz. Nachdem der Adel sie erhalten hat, hat er die Könige in Bezug auf die Verfügbarkeit bestimmter materieller Vorteile praktisch eingeholt und beginnt, durch ihre untergeordnete Position belastet zu werden. Daher der Wunsch nach Separatismus. Aber die Möglichkeiten der Dienstschicht waren immer noch durch ihre Allods und königlichen Auszeichnungen begrenzt. Es gab jedoch riesige Gebiete kommunalen Landes, die im Prinzip von niemandem und nichts geschützt wurden, außer den alten primitiven Traditionen. Und der Adel begann, sie nach und nach abzuholen. Dies wird seit Mitte des 7. Jahrhunderts beobachtet. Aber für einige Zeit wurde die Beharrlichkeit des Adels durch die enorme zahlenmäßige Überlegenheit der Bauern ausgeglichen, die insbesondere Pepin von Geristalsky unterstützten. Daher hat es noch keine Massenunterwerfung der Bauern gegeben. Es begann im darauffolgenden 8. Jahrhundert unter einer anderen Dynastie.
So gingen die Franken in den zweihundert Jahren der Merowingerzeit von der Konsolidierung in einem einzigen Staat bis zu den Anfängen der Bildung feudaler Orden.
Nach dem Tod von Pepin Geristalsky und neuen Streitigkeiten wird sein unehelicher Sohn Karl, wiederum mit Hilfe der Austrasier, alleiniger Bürgermeister der Franken (715-741). Er behandelt die merowingischen Könige wie Marionetten und regiert seit 737 ganz ohne Könige. Sein Einfluss nahm besonders zu, nachdem unter seiner Führung der Vormarsch der Araber gestoppt wurde.
Tatsache ist, dass die Araber, nachdem sie die Pyrenäen ziemlich leicht erobert hatten, ab 720 einen Angriff auf Gallien starteten. Aber in der entscheidenden Schlacht bei Poitiers im Jahr 732 konnte die arabische Kavallerie die mit Kriegshämmern bewaffnete Linie der fränkischen Infanterie nicht durchbrechen und zog sich nach dem Tod ihres Kommandanten, Prinz Abdrachman, zurück. Diese Schlacht, obwohl sie von den Arabern mit unbedeutenden Kräften geführt wurde, beendete ihre Raubzüge in Europa.
Für diesen Sieg erhielt Charles später den Spitznamen Martell (Hammer). Dank solcher Erfolge aufgestiegen, gelang es ihm 735, das reichste Herzogtum der fränkischen Länder - Aquitanien - zu unterwerfen. Karl Martel verdankte seine militärischen Erfolge der Änderung des Status der Landzuweisungen seiner Untergebenen. Zuvor beschwerten sich die Ländereien, dass sie als Eigentum dienten, und wurden tatsächlich zu Allods. Dies entfremdete Landbesitzer, insbesondere große, vom Thron und drängte sie sogar in die Unabhängigkeit. Die arabische Bedrohung veranlasste Charles Martel, diese Schenkungsordnung durch Pfründen zu ersetzen – Landzuweisungen, die nur unter Bedingungen des Militärdienstes gewährt wurden. Bei Dienstverweigerung wurden die Ländereien weggenommen. Diese Ordnung war nicht Karls Erfindung, sondern wurde früher sporadisch angewendet, ist aber jetzt zur Regel geworden. Dies band den Adel fester an den Herrscher der königlichen Länder, und es wurden nicht genug von den verräterischen Magnaten beschlagnahmt. Und Karl führte die Säkularisierung bedeutender Massen von Kirchengütern durch und bezahlte damit. Zur Begründung verwies er darauf, dass die Ländereien angeblich bis zu einem besonderen staatlichen Bedarf der Kirche zur vorübergehenden Nutzung überlassen worden seien. Jetzt ist sie angekommen. Karl begann auch ohne Zustimmung des Papstes Bischöfe zu ernennen. Und die Kirche war machtlos dagegen anzukämpfen, weil Martell eine breite gesellschaftliche Unterstützung erlangt hatte.
Die Politik der Verteilung der Begünstigten wurde vom Sohn von Charles Martell, Pepin the Short (741-768), fortgesetzt. Die noch nicht sehr zahlreiche herrschende Schicht musste sich fügen. Nur mit der Kirche beschloss Pepin, Frieden zu schließen und vereinbarte mit ihr, dass die von seinem Vater säkularisierten Ländereien, die bei den Inhabern verblieben, als Kircheneigentum anerkannt wurden, wofür die Kirche einen doppelten Zehnten erhielt. Nachdem Pippin so seine Macht gestärkt hatte, erlangte er vom Papst von Rom die Anerkennung als König der Franken - anstelle der Merowinger, die an wirklicher Macht verloren hatten. Als Antwort darauf versprach er dem Papst Hilfe gegen die ihn unterdrückenden Langobarden.
Mit Zustimmung des Papstes versammelte er 751 den fränkischen Adel in Soissons und erreichte seine Wahl zum neuen König der Franken. Der ehemalige König der Merowinger - Childeric und sein Sohn waren Mönche mit Tonsur. Doch mit der versprochenen Hilfe für den von den Langobarden bedrängten Papst hatte Pepin keine Eile, denn der Krieg mit dem völkisch nahen deutschen Staat stieß bei den Franken nicht auf Sympathie. Dann kam der Papst selbst mit einer Gesandtschaft zu Pepin und vollzog an ihm, seiner Frau und seinem Sohn einen Chrisamritus, der den neuen König und seine Familie sofort erhob, denn so etwas wurde bei den Merowingern nicht gemacht. So wurde Pepin König mit dem Recht, den Titel durch Erbschaft zu übertragen, und der Papst erhielt nach einem erfolgreichen Krieg zwischen Franken und Langobarden weltlichen Besitz - den Kirchenstaat in der Mitte Italiens (756).
Pepin der Kleine wandte sich an den Papst und machte eine Revolution in seinem Geist, denn er gab Stammestraditionen auf und griff auf die Autorität der kirchlichen Legalität zurück. Dank dieses Präzedenzfalls erhielt der Papst in Zukunft das Recht, Könige und ganze Dynastien von der Macht zu entfernen.
Pepin wurde durch Charles ersetzt, der den Spitznamen „der Große“ trug (768-814). Ursprünglich wurde die Macht traditionell von zwei Söhnen von Pepin geteilt - Karl und Carloman. Doch nach dem bald folgenden Tod seines Bruders wurde Karl im Alter von 26 Jahren alleiniger König. Den posthumen Spitznamen „Großartig“ hat er sich verdient. Seine Größe spiegelte sich sogar darin wider, dass aus seinem Namen das Wort „König“ entstand.
Sein Vater begann ihn früh ins Geschäft einzubeziehen. Bereits im Alter von 11 Jahren lernte Karl Papst Stephan II. kennen, nahm dann an Feldzügen und Versammlungen teil. Er war groß und kräftig gebaut, mit einem damals seltenen Wachstum von 192 cm; sein Haar war lang, leicht gewellt, sein Gesicht war nach fränkischer Tradition mit einem dichten Schnurrbart geschmückt. Die Proportionen seines Körpers waren so harmonisch, dass weder ein kurzer Hals noch ein ziemlich fester Bauch im Erwachsenenalter auffielen. Er trug gewöhnlich die traditionelle Tracht der Franken: ein Leinenhemd und eine Unterhose, darüber eine Tunika mit Seidenmustern, eine mit Stoffstreifen umwickelte Hose unterhalb der Knie, im Winter eine Weste aus Otter- oder Rattenhaut. Oben - ein blauer Umhang, an der Seite - ein Schwert mit einem Baldric. An Feiertagen wurden goldene Ornamente hinzugefügt.
Trotz aufrichtiger Religiosität heiratete er 6 Mal und hatte viele Konkubinen. Aber er war ein vorbildlicher Vater gegenüber seinen vielen Kindern, mit denen er immer versuchte, seine Freizeit zu teilen. Der Tod einer von ihnen trauerte wie eine Frau. Besonders an seinen Töchtern hing er. Um sie für sich zu behalten, heiratete er nie eine einzige, aber er erlaubte ihnen, Liebhaber zu haben. Karl legte Wert auf Bildung, gründete eine Art Familienakademie, zu der er damals berühmte Wissenschaftler einlud; Er studierte selbst und zwang seine Familienmitglieder zum Studium. Er selbst sprach und las Latein, verstand Griechisch nach Gehör, beherrschte das Schreiben jedoch erst im Erwachsenenalter. Dann studierte er Logik, Rhetorik, Astronomie. Charles brauchte Land, um die wachsende Dienstklasse auszustatten und die Größe seines Staates zu erhalten, und verfolgte eine aktive Eroberungspolitik. Er nutzte eine weitere Beschwerde des Papstes über die Langobarden, die von Pepin befriedet wurden, aber ihre Unabhängigkeit behielten, besiegte sie schließlich und setzte ihm die eiserne Krone des Langobardenkönigs auf. Während dieses Krieges besuchte er 774 Rom und erhielt vom Papst alle Stipendien, die seinem Vater gewährt wurden.
Aber die wichtigsten militärischen Bemühungen Karls des Großen richteten sich nach Osten, wo es viele schlecht organisierte Barbarenstämme gab. 772 begann er einen Krieg mit den Sachsen, von denen einige noch im 5. Jahrhundert lebten. zogen nach Großbritannien, aber der Großteil von ihnen blieb in den Ländern vom Niederrhein bis zur Elbe. Die Eroberung durch die Sachsen dauerte 32 Jahre. Ihr hartnäckiger Widerstand wurde durch den Zusammenhalt der sächsischen Gesellschaft verursacht, die sich noch im Stadium der Zersetzung der primitiven Ordnung befand. Die Franken hingegen brachten neue Beziehungen, die selbst dem jungen sächsischen Adel fremd waren. Schließlich eroberten die Franken Sachsen und danach Bayern und errichteten dort ihre Feudalordnung.
Während der Sachsenkriege kamen die Franken in Kontakt mit den an der Elbe lebenden slawischen Stämmen, die Karl als Verbündete gegen die Sachsen einsetzte. In der Zukunft wurden einige von ihnen auch vorübergehend von den Franken unterworfen. An der mittleren Donau die Franken während 791-796. besiegte die Awaren und begründete die pannonische Marke.
So entstand ein Imperium, das das Territorium des modernen Frankreichs, Deutschlands, Norditaliens und Spaniens sowie Ungarns, der Tschechischen Republik und Österreichs umfasste.
Im Jahr 800 unterstützte Karl Leo III. auf dem päpstlichen Thron, der sich aus Dankbarkeit während des feierlichen Gottesdienstes nach altem Brauch vor Karl zu Boden neigte und ihm die Kaiserkrone aufsetzte. Karl hielt dies durch all seine Taten für verdient, wodurch er Rom die Macht über ihre früheren Provinzen zurückgab. Außerdem saß zu dieser Zeit eine Frau, Kaiserin Irina, auf dem Thron von Konstantinopel.
Aber um die internationale Anerkennung seines Kaisertitels zu erlangen, begann Karl dennoch, sich mit Byzanz zu beschäftigen. Sogar im Alter von 58 Jahren begann er, Irina zu umwerben, ohne sich darüber zu schämen, dass sie in ihrem Land die Autokratie erlangt hatte, indem sie den Mord an ihrem eigenen Sohn organisierte. Aber diese Ehe sollte nicht wahr werden, denn Irina wurde bald vom Thron abgesetzt. Die byzantinische Regierung erkannte jedoch 812 widerstrebend, aber belastet durch den Kampf gegen die Araber, den Titel eines Basileus für Karl an.
In dem Bemühen, die Rolle der Kirche aufzuwerten, mischte sich Karl der Große aktiv in ihre Angelegenheiten ein. 250 Jahre vor den eigentlichen Kirchenentscheidungen erließ er mehrere Dekrete zum Zölibat der Geistlichen. Er führte auch den obligatorischen Zehnten zugunsten der Kirche ein. In vielerlei Hinsicht legten die Aktivitäten von Charles den Grundstein für die Ideologie der aufstrebenden westlichen Welt. Seine Forderungen, überall kostenlose Grundschulen zu organisieren, trugen dazu bei, Latein zur Weltsprache Westeuropas zu machen. Die vielfältigen Interessen und die brodelnde Energie Karls trugen zur Konsolidierung der westeuropäischen Gesellschaft bei. Vielleicht haben diejenigen Recht, die behaupten, Karl der Große habe den Grundstein für die westeuropäische Einheit gelegt, auf der 1200 Jahre später, in unserer Zeit, der Aufbau der Europäischen Union vollendet wurde.
Karl der Große starb im Alter von 72 Jahren an einer Lungenentzündung, nachdem er sich bei der Jagd erkältet hatte und alle seine Frauen überlebte. Aus seinem Namen entstand der Name der neuen Dynastie - der Karolinger. Unter ihm wurden die Grundlagen des westeuropäischen Feudalismus gelegt.
Frankenstammes feudales Lehen
2. Organisation eines großenEigentum. Feudales Lehen
Ende des 5. Jahrhunderts und Anfang des 10. Jahrhunderts führte eine Revolution der Landverhältnisse im fränkischen Staat zur Dominanz des Feudaleigentums – der Grundlage des Feudalsystems. Die Inbesitznahme bäuerlicher Ländereien durch weltliche und kirchliche Großgrundbesitzer ging einher mit der Verschärfung verschiedener Formen nichtwirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen. Dies war eine zwangsläufige Folge der Etablierung des feudalen Grundeigentums, da, sofern Land und Produktionsmittel direkten Produzenten zur Verfügung gestellt wurden, überschüssige Arbeitskräfte zugunsten des Grundeigentümers nur durch nichtökonomischen Zwang herauszupressen waren.
Die Beschlagnahmung bäuerlicher Kleingärten durch große Feudalherren nimmt zu Beginn des 4. Jahrhunderts einen besonders massiven Charakter an. Großgrundbesitzer, insbesondere solche, die als Grafen oder andere Beamte über Zwangsmittel gegenüber der örtlichen bäuerlichen Bevölkerung verfügten, machten diese gewaltsam zu abhängigen Personen.
Begünstigt wurde der Untergang der Bauernschaft durch die aktive Angriffspolitik der Karolinger, insbesondere Karls des Großen, die Forderung der noch verbliebenen freien Bauern, vor allem in den deutschen Gebieten, nach langjährigem Militärdienst, die sie lange davon trennte der Wirtschaft, sowie Kirchenzehnten, hohe Steuern und hohe Gerichtsstrafen.
Die Kirche spielte eine wichtige Rolle bei der Enteignung des Landes und der Abhängigkeit der Bauernschaft. Um ihren Landbesitz zu erweitern, nutzte sie neben direkter Gewalt die religiösen Gefühle der Bauernmassen und schlug den Gläubigen vor, dass Spenden zugunsten der Kirche ihnen Vergebung der Sünden und ewige Glückseligkeit im Jenseits bringen würden. Kirchliche Institutionen, einzelne Prälaten und vor allem die Päpste selbst praktizierten in großem Umfang Fälschungen, um ihre Rechte an bestimmten Landgütern geltend zu machen.
Ruiniert oder am Rande des Ruins gerieten freie Bauern leicht in Abhängigkeit von Großgrundbesitzern. Gleichzeitig ging es den Feudalherren aber nicht um die Vertreibung der Bauern vom Land, sondern um deren Bindung. Unter der Herrschaft der Naturalwirtschaft war der Boden die einzige Existenzgrundlage. Selbst wenn sie Allods verloren, nahmen freie Gemeindemitglieder den Feudalherren Land ab, um es unter der Bedingung zu nutzen, dass bestimmte Pflichten erfüllt wurden.
Eine der gebräuchlichsten Methoden, um die freie Bauernschaft auch unter den Merowingern in Abhängigkeit zu bringen, war die Praxis, Land an das Prekarium zu übertragen. In den VIII-IX Jahrhunderten. Diese Praxis war als eines der wichtigsten Mittel der Feudalisierung besonders weit verbreitet. Ein Prekarium ist ein bedingter Landbesitz, den ein Großbesitzer zur vorübergehenden Nutzung an eine Person, meistens einen Landlosen oder Landlosen, überträgt. Für die Nutzung dieser Zuteilung musste der Empfänger in der Regel Abgaben entrichten oder in manchen Fällen Frondienst zugunsten des Grundstückseigentümers leisten.
Der Prekarist, der auf das Eigentumsrecht am Boden verzichtete, wurde vom Eigentümer zum Eigentümer. Obwohl er zunächst seine persönliche Freiheit behielt, geriet er in die Landabhängigkeit des Grundeigentümers. Obwohl das prekäre Verhältnis die Form eines "freiwilligen Vertrages" annahm, war es in Wirklichkeit das Ergebnis der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauern, die sie zwang, Land an Großgrundbesitzer abzugeben, und manchmal das Ergebnis direkter Gewalt.
Zusammen mit den Bauern im VIII-IX Jahrhundert. Kleingrundbesitzer fungierten oft als Prekaristen, die ihrerseits die Arbeitskraft abhängiger Menschen ausbeuteten, die meist aus dem Umfeld wohlhabenderer kommunaler Allodisten stammten. In diesen Fällen diente das Prekarium dazu, die Landbeziehungen innerhalb der Schicht der Feudalherren zu formalisieren, da ein so kleines Erbe bereits im Wesentlichen ein Feudalgrundbesitzer war, der bestimmte Beziehungen zu einem größeren Feudalgrundbesitzer einging, der ihm Land im Precarium zur Verfügung stellte .
Wenn in den VI-VII Jahrhunderten. Königliche Auszeichnungen spielten dann im VIII-IX Jahrhundert eine entscheidende Rolle bei der Aufteilung des großen Feudalbesitzes und der Etablierung der bäuerlichen Abhängigkeit. ein wichtigerer Faktor in diesen Prozessen ist der Ruin der Masse der Bauernschaft und ihr Heranziehen in die Landabhängigkeit von großen Feudalherren, auch ohne die aktive Rolle der königlichen Macht. Mit dem Verlust von Land verlor der Bauer oft bald auch seine persönliche Freiheit. Aber es könnte auch anders sein. Der arme Mann, der seine Schulden nicht bezahlen konnte, geriet in die Knechtschaft des Gläubigers und dann in die Position einer persönlich abhängigen Person, nicht viel anders als ein Sklave. Der Akt der Belobigung eines kleinen freien Bauern an einen weltlichen Magnaten oder eine Kirche führte oft zu persönlicher Abhängigkeit. In der Praxis konnte die Begründung einer persönlichen Abhängigkeit eines Bauern von einem Feudalherrn manchmal dem Verlust seiner Allod vorausgehen. Die weite Verbreitung solcher persönlichen Beziehungen zwischen ihnen hatte jedoch als allgemeine Prämisse das schnelle Wachstum des Großgrundbesitzes auf Kosten des kleinbäuerlichen und kommunalen Eigentums, was die Hauptrichtung in der sozialen Entwicklung der fränkischen Gesellschaft jener Zeit zum Ausdruck brachte.
Die weitere Konzentration politischer Macht in den Händen einzelner Großgrundbesitzer, die ihnen als Instrument nichtökonomischen Zwangs diente, trug nicht zuletzt zum Ruin und zur Abhängigkeit der Bauernschaft bei. Die Könige, die diesen Prozess nicht verhindern konnten, waren gezwungen, ihn durch soziale Auszeichnungen zu sanktionieren. Solche Auszeichnungen erschienen unter den Merowingern, aber ihre weite Verbreitung geht auf die karolingische Zeit zurück. Ihr Wesen liegt in der Tatsache, dass Beamten – Grafen, Zenturios und ihren Gehilfen – durch besondere königliche Briefe verboten wurde, das Territorium dieses oder jenes Magnaten zu betreten, um dort irgendwelche gerichtlichen, administrativen, polizeilichen oder fiskalischen Funktionen auszuüben. All diese Funktionen wurden Magnaten und ihren Beamten übertragen. Eine solche Auszeichnung wurde als Immunität bezeichnet.
Üblicherweise liefen die Immunitätsrechte eines Großgrundbesitzers auf Folgendes hinaus: Er übte richterliche Gewalt auf seinem Land aus; hatte das Recht, im Gebiet der Immunität alle Einnahmen zu erheben, die zuvor zugunsten des Königs gewesen waren; schließlich war er der Anführer der Militärmiliz, die auf dem Territorium des Immunbezirks einberufen wurde. Der Gerichtsbarkeit der Immunität unterlag bei Ansprüchen wegen Grundstücken und anderem Vermögen sowie bei Bagatelldelikten nicht nur persönlich abhängigen, sondern auch persönlich freien Bewohnern seines Besitzes. Der Oberste Strafgerichtshof blieb in der Regel in den Händen der Grafen, obwohl einige Immunisten sich auch die Rechte der obersten Gerichtsbarkeit anmaßen.
Meistens formalisierte der Immunitätsspruch einfach jene Mittel des nichtwirtschaftlichen Zwangs, die sich der Feudalherr als Großgrundbesitzer lange vor der Verleihung angeeignet hatte. Der Immunist, der über gerichtlich-administrative und fiskalische Befugnisse verfügte, nutzte sie, um immer mehr Landbesitz zu erwerben, die Ausbeutung zu intensivieren und die Abhängigkeit seiner Bauern, einschließlich der persönlich noch freien, zu stärken. Während der karolingischen Zeit erweiterte die Immunitätszusage häufig die Macht des Immunisten auf Ländereien und Menschen, die zuvor keiner privaten Autorität unterstanden. Gleichzeitig trug die Immunität dazu bei, die Unabhängigkeit der Feudalherren von der Zentralregierung zu stärken und damit den späteren politischen Zusammenbruch des Karolingischen Reiches vorzubereiten.
Die Entwicklung der Vasallenbeziehungen trug auch zum Wachstum der politischen Unabhängigkeit der Feudalherren bei. Als Vasallen bezeichnete man ursprünglich Freie, die mit einem Großgrundbesitzer in persönliche Vertragsbeziehungen traten, meist als dessen Militärdiener – Bürgerwehren. In karolingischer Zeit war der Eintritt in die Vasallenschaft oft mit der Verleihung einer Pfründe an den Vasallen verbunden, was ihr nicht nur den Charakter einer persönlichen, sondern auch einer landesmäßigen Verbindung verlieh. Der Vasall war verpflichtet, seinem Herrn treu zu dienen und sein "Mann" zu werden, und der Lord war verpflichtet, den Vasallen zu beschützen. Mit einer großen Anzahl von Vasallen erlangte ein Großgrundbesitzer politischen Einfluss und militärische Stärke und stärkte seine Unabhängigkeit von der königlichen Verwaltung.
847 schrieb der Enkel Karls des Großen, Karl der Kahle, in seinem Kapitular von Mersenne vor, dass "jeder freie Mann seinen Herrn wählen sollte". So wurde die Vasallenschaft als wichtigste Rechtsform der gesellschaftlichen Kommunikation anerkannt. Die Entwicklung der Vasallenschaft führte zur Bildung einer hierarchischen Struktur der herrschenden Schicht der Feudalherren, schwächte die Zentralgewalt und trug zur Stärkung der Privatmacht der Feudalherren bei.
Mit der Genehmigung und Formalisierung des großflächigen feudalen Landbesitzes zu Beginn des 10. Jahrhunderts vollzogen sich bedeutende Veränderungen in der wirtschaftlichen und sozialen Organisation der fränkischen Gesellschaft. Im 8. bis frühen 10. Jahrhundert wurde das feudale Erbe, die Herrschaft, zu seiner Grundlage, die sowohl freie fränkische Gemeinden als auch große Landkomplexe gallo-römischen Typs absorbierte.
Die sich in der Karolingerzeit herausbildende Struktur des feudalen Großgrundbesitzes war nicht homogen. Sowohl weltliche als auch kirchliche Großgrundbesitzer besaßen Land unterschiedlicher Größe und Qualität. Zu ihrem Besitz gehörten große Ländereien, die zusammenhängende Gebiete einnahmen, die mit einem ganzen Dorf zusammenfielen oder aus mehreren Dörfern bestanden. Am weitesten verbreitet waren Güter dieser Art in den nördlichen Regionen des Frankenreiches - zwischen Rhein und Loire. Aber auch dort bestand der Besitz selbst großer Grundbesitzer manchmal aus kleinen Gütern, die Teile eines großen Dorfes umfassten oder in verschiedenen Dörfern lagen, oder sogar aus einzelnen Haushalten, die mit dem Besitz anderer Eigentümer, manchmal noch freier Bauern, durchsetzt waren. Dieser Typ war besonders charakteristisch für die südlichen Regionen des Landes.
Die Vielfalt in der Struktur des Großgrundbesitzes erklärt sich dadurch, dass sowohl im Norden als auch im Süden des Landes keineswegs immer ein Großgrundbesitzer sofort Eigentümer des gesamten Dorfes wurde. Manchmal erwarb er zunächst mehrere kleine Bauerngrundstücke und sammelte dann nach und nach seinen Besitz durch Tausch, Kauf oder direkte Beschlagnahme, bis das ganze Dorf zu seinem Lehen oder einem Teil davon wurde.
Quellen zur Geschichte des großen feudalen Erbes der Karolingerzeit beschreiben uns das feudale Erbe des fränkischen Königreichs ausführlicher.
1. Wir wünschen, dass unsere Ländereien, die wir dazu bestimmt haben, unseren eigenen Bedürfnissen zu dienen, ganz uns dienen und nicht anderen Menschen.
2. Damit unsere Leute gut behandelt werden und niemand sie in den Ruin treibt.
3. Damit die Manager es nicht wagen, unsere Leute in ihren Dienst zu stellen und von ihnen Fronarbeit, Abholzen von [Wald]material und andere Arbeiten zu ihren Gunsten zu fordern; Sie sollen auch keine Geschenke von ihnen annehmen - weder ein Pferd noch ein Ochse noch eine Kuh noch ein Schwein noch ein Widder noch ein Schwein noch ein Lamm oder irgendetwas anderes, mit Ausnahme von Kürbissen, Gartenprodukten , Äpfel, Hühner und Eier.
6. Wir wünschen, dass unsere Verwalter den Zehnten von der ganzen Ernte in voller Höhe an die Kirchen geben, die in unseren Finanzen sind; und geben unseren Zehnten nicht an andere Kirchen, außer dort, wo es seit alten Zeiten eingerichtet wurde. Und lass nicht andere Geistliche an der Spitze dieser Kirchen stehen, sondern nur unsere – von unserem Volk oder von unserer Kapelle.
9. Wir wünschen uns, dass jeder Gouverneur in seinem Distrikt die gleichen Maße hat – Modii, Sextarii, Situlas von 8 Sextarii und Logen, die wir in unserem Palast haben.
12. Damit keiner der Verwalter unsere Geisel in unserem Anwesen zu ihrem Vasallen macht.
19. Halten Sie in den Getreidespeichern unserer Hauptgüter (in villis capitaneis) mindestens 100 Hühner und mindestens 30 Gänse. Und in Farmen (Mansioniles) halten Sie mindestens 50 Hühner und mindestens 12 Gänse.
23. Lassen Sie die Verwalter in jedem unserer Güter so viele Ställe wie möglich für Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen und Ziegen unterhalten, und darauf können wir nicht verzichten. Außerdem sollen sie Arbeitsvieh (vaccas) halten, das an die Sklaven zur Verrichtung ihres Dienstes verteilt wird, damit durch [diesen] Dienst Gespanne und Karren für den Bedarf des Herrn in keiner Weise verringert werden. Und lassen Sie sie haben, wenn sie dazu dienen, Hunde, lahme, aber nicht kranke Stiere, Kühe oder Pferde, die keine Krätze haben, und anderes Vieh, das nicht krank ist, zu füttern. Und wie gesagt, aus diesem Grund sollten Teams und Karren nicht verringert werden.
28. Wir wünschen, dass [Manager] jedes Jahr am Fortecost, am Palmsonntag, genannt Hosianna, auf unsere Anordnung Geld aus unserer Wirtschaft liefern, nachdem wir uns mit der Abrechnung der Höhe unseres Einkommens dieses Jahres vertraut gemacht haben.
30. Wir möchten, dass unsere Verwalter getrennt von jeder Art von Produkten berücksichtigen (segregare faciant), was sie liefern müssen, wenn sie unseren Bedürfnissen dienen, und auch getrennt berücksichtigen, was von Häusern und Hirten auf Kriegswagen geladen werden soll. damit sie [genau] wissen, wie viel für diesen Fall gesendet wird.
37. Damit unsere Felder und Zaimki gut bestellt und unsere Wiesen rechtzeitig geschützt werden.
41. Dass die Gebäude in unseren [Herren-]Höfen und die sie umgebenden Zäune gut bewacht und dass Ställe, Küchen, Bäckereien und Weinpressen sorgfältig eingerichtet werden, damit unsere Angestellten dort anständig und mit großer Sauberkeit ihre Arbeit verrichten können.
43. Es wurde festgestellt, dass unsere Frauenquartiere rechtzeitig Material für die Arbeit erhalten sollten, nämlich: Flachs, Wolle, Waid, scharlachrote und rote Farbstoffe, einen Kamm zum Kämmen von Wolle, Flusen, Seife, Fette, Gefäße und andere Kleinigkeiten, die vorhanden sind dort benötigt.
45. Dass jeder Manager gute Handwerker in seiner Obhut haben sollte, nämlich: Schmiede, Silber- und Goldschmiede, Schuhmacher, Drechsler, Zimmerleute, Büchsenmacher, Fischer, Vogelfänger, Seifensieder, Brauer, d.h. diejenigen, die sich mit der Herstellung von Bier, Äpfeln, Birnen und anderen verschiedenen Getränken auskennen, Bäcker, die Weißbrot (Simitam) für unseren Bedarf herstellen würden, Menschen, die gut darin sind, Netze für die Jagd und Netze zum Fischen und Fangen von Vögeln zu weben, sowie andere Mitarbeiter, deren Aufzählung zu lang wäre.
47. Damit unsere Jäger, Falkner und andere Angestellte, die ständige Pflichten bei Hof erfüllen, in Übereinstimmung mit einem schriftlichen Befehl von uns oder der Königin in unseren Gütern [notwendige] Unterstützung erhalten, wenn wir sie für einige unserer Geschäfte senden oder wenn die Verwalter und Kelch von unserem Namen, ihnen wird befohlen, etwas zu tun.
48. Damit die Weinpressen auf unseren Gütern gut geordnet sind; und dafür müssen die Verwalter sorgen, damit es niemand wagt, unsere Trauben mit den Füßen zu zertreten, aber alles muss ordentlich und ehrenhaft sein.
52. Wir wünschen, dass verschiedene Leute von Leibeigenen und von unseren Sklaven oder von freien Leuten, die in unseren Finanzen und Gütern leben, [Verwalter] ein volles und gerechtes Gericht schaffen, wie es jeder sollte.
54. Lassen Sie jeden Manager dafür sorgen, dass unsere Leute gut arbeiten und nicht untätig auf den Märkten herumlaufen.
55. Wir wünschen, dass die Verwalter alles, was sie geben, ausgeben und für unsere Bedürfnisse trennen, in einer Liste aufzeichnen würden, und alles, was sie selbst ausgeben, in einer anderen und einer speziellen Liste, die uns über den Rest benachrichtigen würde .
60. Auf keinen Fall sollten Älteste von starken Leuten ernannt werden, sondern von Leuten mit durchschnittlichem Einkommen und Gläubigen.
62. Lasst uns unsere Verwalter jährlich bei der Geburt des Herrn getrennt, klar und geordnet über alle unsere Einkünfte informieren, damit wir wissen, was und wie viel wir an getrennten Posten haben, nämlich: wie viel [gepflügt] von den Bullen an dem unsere Viehtreiber arbeiten ( bubulci ), wie viel [Pflügen] von den Mansi, wer die Orange schuldet, wie viele Schweine erhalten wurden, wie viele Abgaben, wie viel für Schuldverpflichtungen (de fide facta) und Bußgelder laut Gericht, wie viel für Wild, das ohne unsere Erlaubnis in unseren reservierten Dickichten gefangen wurde, wie viel für verschiedene Vergehen, wie viele von Mühlen, wie viele von Wäldern, wie viele von Feldern, wie viele von Brücken und Schiffen, wie viele von freien Menschen und Hunderte, die dem dienen Bedarf unseres Fiskus, wie viel von Märkten, wie viel von Weinbergen und von Weinzahlern, wie viel Heu, wie viel Brennholz und Fackeln, wie viel Holz und anderes [Wald-] Material, wie viel von Ödland, wie viel Gemüse, wie viel Hirse und Hirse, wie viel Wolle, Flachs und Hanf, wie viel Obst von Bäumen, wie viel Nüsse und Nüsse, wie viel von veredelt Bäume verschiedener Art, wie viele aus Gärten, wie viele aus Rübenkämmen, wie viele aus Fischteichen, wie viele Häute, wie viele Felle und Hörner, wie viel Honig und Wachs, wie viel Talg, Fette und Seife, wie viel Beerenwein, gekochter Wein, Mettrunk und Essig, wie viel Bier, Traubenwein - neu und alt, Getreide neu und alt, wie viel Hühner, Eier, Gänse, wie viel von Fischern, Schmieden, Büchsenmachern und Schuhmachern, von Trinkgläsern und Truhenmachern, wie viel von Drechslern und Sattlern, wie viel von Schlossern, von Eisen- und Bleiminen, wie viel von den Wehrleuten (tributariis), wie viel von Hengsten und Stuten.
64. Damit die Bastern - unsere Wagen, die in den Krieg ziehen, gut gemacht sind und ihre Verdecke gut mit Leder bezogen sind, so genäht, dass bei Bedarf Wasserbrücken mit ihrem gesamten Inhalt über Flüsse und Wasser transportiert werden könnten eindringen konnte nicht, und unsere Waren konnten, wie gesagt, in völliger Sicherheit transportiert werden. Wir wünschen, dass Mehl für unseren Tisch in Wagen geschickt würde, jeder mit 12 Modi, auch in denen, in denen Wein transportiert wird, würden 12 Modi nach unserem Maß geschickt, und jeder Wagen hätte einen Schild und einen Speer, einen Köcher und ein Bogen.
65. Fische aus unseren Käfigen zu verkaufen und an ihrer Stelle einen anderen zu pflanzen und so immer Fische [bereit] zu haben, nur wenn wir [unsere] Ländereien nicht besucht haben, [ganz] verkaufen und das Einkommen unseren Verwaltern überlassen zu unserem Vorteil wenden.
66. Über Ziegen und Ziegen, ihre Hörner und Felle geben wir Rechenschaft, jährlich frisch gesalzenes fettes Ziegenfleisch von ihnen an uns.
67. Lassen Sie sie uns unbesetzte Herrenhäuser (de mansis absis) und [neu] erworbene Sklaven mitteilen, wenn es keinen [Standort] gibt, wo sie gepflanzt werden könnten.
68. Wir wünschten, der Verwalter hätte immer gute, mit Eisenreifen umwickelte Fässer bereit, die man in den Krieg oder in den Palast schicken könnte; und mache keine Lederhäute.
Sie zeigen, dass es sich bereits in dieser Zeit um eine Organisation zur Aneignung der feudalen Rente durch Großgrundbesitzer handelte - der Mehrarbeit der Bauern in Form von Abgaben und Frondiensten. Das Land des feudalen Erbes wurde normalerweise in zwei Teile geteilt: das Land des Herrn oder die Domäne, auf dem die Wirtschaft des Feudalherrn betrieben wurde, und das Land, das von abhängigen Bauern genutzt wurde und aus Kleingärten bestand. Im Norden war die Domäne in solchen Gütern ziemlich groß und machte mindestens 1/3 aller darin enthaltenen Ländereien aus.
Die Zusammensetzung des Herren- oder Domänenlandes umfasste ein Herrenhaus - ein Haus und einen Hof mit Nebengebäuden, manchmal mit Werkstätten eines Patrimonialhandwerkers, einen Garten, einen Gemüsegarten, einen Weinberg, einen Scheunenhof, einen Senioren-Hühnerstall. Dem Gut gehörten in der Regel Mühlen und eine Kirche, die als Eigentum des Feudalherrn galten. Ackerland, Wiesen und Weinberge des Gutshofes, aufgeteilt in kleine Parzellen, lagen in den nördlichen Regionen des Königreichs, durchsetzt mit Parzellen abhängiger Bauern. Ein Teil der Wälder und jener Weiden, Wiesen und Ödlande, die zuvor der freien Gemeinde gehörten, gingen nun auch in den Besitz der Feudalherren über. Infolge der Verschachtelung herrschte auf dem Gut eine erzwungene Fruchtfolge mit Rindern, die nach der Ernte auf Brachen und Stoppeln weideten. Die Bewirtschaftung des Herrenlandes erfolgte hauptsächlich durch abhängige Bauern, die mit eigenem Vieh und Gerät auf der Fron arbeiteten, und, wenn auch in viel geringerem Umfang, durch Hofsklaven, die Geräte und Vieh des Gutes nutzten.
Die Ländereien, die den Bauern zur Verfügung standen, wurden in Parzellen aufgeteilt, die man im Westen des fränkischen Staates Mans, im Osten Gufs und im Süden Colonics nannten. Jede Zuteilung umfasste: einen Bauernhof mit einem Haus und Nebengebäuden, manchmal einen Garten und einen an den Hof angrenzenden Weinberg, und eine Feldackerzuteilung, die aus separaten Ackerlandstreifen bestand, die verstreut mit Grundstücken anderer Bauern und dem Anwesen selbst durchsetzt waren. Darüber hinaus nutzten die Bauern die Weiden, die der Gemeinde zur Verfügung standen und manchmal gegen eine Gebühr in den Händen der Feudalherren waren. Die kommunale Organisation mit erzwungener Fruchtfolge und kollektiver Nutzung ungeteilten Bodens verschwand also nicht mit der Entstehung des Gutshofes. Aus der freien ist sie nun aber in eine abhängige und aus der ländlichen Ansammlung freier Gemeindeglieder eine Ansammlung abhängiger Bauern geworden. Den Vorsitz führte ein vom Herrn ernannter Häuptling, der die Forderungen des Herrn ausführte, aber gleichzeitig die Interessen der Bauern vor ihm verteidigte.
Die Parzellen, auf denen die abhängigen Bauern saßen, waren steuerpflichtig, das heißt, ihnen fielen bestimmte Abgaben zu. Auf den Ländereien des Patrimoniums gab es in der Regel auch freie Besitzungen - Prekarien und Begünstigte von Beamten der Patrimonialverwaltung, die sie als Bezahlung für ihre Dienste verwendeten, sowie Begünstigte von kleinen Vasallen des Grundherrn.
Fazit
Den Bauern ihr Land zu entziehen und sie in Abhängigkeit zu bringen, rief heftigen Widerstand sowohl der noch freien als auch der bereits abhängigen Bauernschaft hervor. Es nahm verschiedene Formen an. Eine davon war die Massenflucht der Bauern. Oft kam es zu offenen Bauernaufständen.
Der hartnäckige Widerstand der Bauernschaft gegen die Feudalisierung wird durch das Kapitular von 821 von König Ludwig dem Frommen belegt, das über die Existenz "illegaler" Verschwörungen und Vereinigungen abhängiger Bauern in Flandern berichtet. Bauernaufstände fanden 848 und 866 statt. im Besitz des Bischofs von Mainz. Der größte Aufstand fand 841-842 in Sachsen statt. Die Parole der Bauern, die sich gegen die Unterdrücker – die sächsischen und fränkischen Feudalherren und die sie unterstützende königliche Verwaltung – erhoben, war eine Rückkehr zur alten, vorfeudalen Ordnung: Die Bauern vertrieben die Herren und „fingen an, im Alten zu leben Tage." Daher der Name der Bewegung - der "Stelling"-Aufstand, was übersetzt werden kann: "Kinder des alten Rechts".
Die Entwicklung der feudalen Verhältnisse sowie die Dominanz der religiösen Weltanschauung veranlassten viele Historiker, beginnend mit der Renaissance, diese Zeit als „dunkles Zeitalter“ zu betrachten, als eine Zeit des Niedergangs, der Erniedrigung der menschlichen Person und der Gesellschaft als Ganzes. So entstand die traditionelle Bezeichnung, die von humanistischen Historikern verwendet wurde - der Begriff "Mittelalter", d.h. wie "Zeitlosigkeit", ein Zwischenschritt zwischen dem Höhenflug des menschlichen Geistes in der Antike und seiner Wiedergeburt an der Schwelle zur Neuzeit. So eine negative Bewertung des klassischen Mittelalters, verständlich aus dem Mund der Humanisten, Aufklärer des 18. Jahrhunderts. und einigen liberalen Historikern des 19. Jahrhunderts, die mit den Überresten des Feudalismus in Europa zu kämpfen hatten, erscheint es vom Standpunkt der modernen Wissenschaft nicht nur nicht historisch, einseitig und oberflächlich, sondern einfach falsch.
Schließlich darf man nicht vergessen, dass gerade im Mittelalter die meisten modernen Staaten entstanden, ihre Grenzen hauptsächlich festgelegt und die ethnokulturellen Grundlagen zukünftiger Nationen und Nationalsprachen gelegt wurden. Es gab Parlamente, Geschworenengerichte und die ersten Verfassungen. Scheren, Uhren, Drucken, Fensterglas, Schusswaffen und viele andere Innovationen wurden erfunden. Schriftliche angewandte und theoretische Arbeiten über Chemie, Mathematik, Mechanik, Medizin, die erste Enzyklopädie. Es gab "Projekte" einer Gesellschaft des Wohlergehens und der universellen Gleichheit der Menschen. Am Ende des XV Jahrhunderts. Die Europäer entdeckten Amerika, unternahmen die ersten Weltreisen. Das Mittelalter brachte große Veränderungen auf dem Gebiet der Produktion, der sozialen Beziehungen und des spirituellen Lebens nach Europa.
Gehostet auf Allbest.ru
Ähnliche Dokumente
Das Studium des Dreifaltigkeits-Sergius-Klosters als großes feudales Lehen. Dokumentationssystem in russischen Klöstern und Besonderheiten des Trinity-Archivs. Die Festungsschatzkammer des Dreifaltigkeitsklosters. Kopieren Sie Bücher und Inventare der Leibeigenenkasse. Die Struktur ländlicher Siedlungen.
Dissertation, hinzugefügt am 28.02.2010
Die Entstehung des fränkischen Staates: Die soziale Struktur der fränkischen und gallo-römischen Gesellschaft unter der karolingischen Dynastie. Die Entwicklung der feudalen Verhältnisse, die Organisation der Herrschaft auf dem Gut, der Widerstand der Bauern. Aufzeichnungen der "salischen Wahrheit" über die Struktur der Gesellschaft.
Test, hinzugefügt am 26.11.2009
Die Entstehung des Feudalstaates am Beispiel der Franken. Die wichtigsten sozialen Schichten der fränkischen Gesellschaft. Die Zeit der salischen Wahrheit. Historische Hinweise auf erhöhtes Wergeld für die Ermordung von Priestern und Bischöfen. Freie Franken und Sklaven.
Zusammenfassung, hinzugefügt am 07.07.2011
Das Gerät und die Wirtschaft des Erbes. Wirtschaft der mittelalterlichen Rus'. Votchina in den Schriften der Historiker. Gegenseitige Beziehungen zwischen dem Votchinnik und der ländlichen Gemeinde. Die Russkaja Prawda ist die älteste russische Gesetzessammlung. Votchina nach russischer Prawda. Apparat der Vermögensverwaltung.
Seminararbeit, hinzugefügt am 10.07.2009
Die Machtübernahme des alten karolingischen Geschlechts im fränkischen Staat. Der Lebensweg und die Persönlichkeit Karls des Großen, seine Krönung und die Bedeutung dieses Ereignisses für das Byzantinische Reich. Wiederbelebung des Bildungssystems im Staat. Das Ende des Lebens des Kaisers.
Präsentation, hinzugefügt am 26.11.2013
Die Ökonomie der alten Franken nach der „salischen Wahrheit“. Kommunalwesen, Eigentumsformen im Frankenreich. Mikrostrukturen der barbarischen Gesellschaft. Rechtsstellung der Hauptgruppen der Bevölkerung. Der wirtschaftliche Entwicklungsstand der fränkischen Gesellschaft.
Seminararbeit, hinzugefügt am 01.05.2011
Der Zerfall der Rus in bestimmte Fürstentümer unter Jaroslaw dem Weisen. Ursachen der feudalen Zersplitterung des altrussischen Staates. Merkmal der Zeit der feudalen Zersplitterung in Rus. Feudale Zersplitterung als politische Dezentralisierung des Staates.
Zusammenfassung, hinzugefügt am 08.03.2010
Merkmale der Entwicklung der Feudalwirtschaft in Russland. Allgemeine Merkmale der Feudalwirtschaft. Politische Formationen der Entstehungszeit des Feudalismus im europäischen Teil des Landes. Die Hauptmerkmale der feudalen Wirtschaft Russlands, Formen der feudalen Abhängigkeit.
Test, hinzugefügt am 25.10.2010
Die wichtigsten Typen und Merkmale feudaler Systeme. Entstehung und Entwicklung der Feudalwirtschaft (am Beispiel des fränkischen Staates). Das klassische Modell der Feudalwirtschaft in Frankreich. Merkmale des Feudalismus in Russland. Merkmale der feudalen Wirtschaft Englands.
Seminararbeit, hinzugefügt am 14.11.2013
Staat der Franken: Erscheinungsgeschichte, Gründer. Die Geschichte der Schale von Soissons. Edle Franken der Merowinger- und Karolingerzeit. Salische Wahrheit als Gesetzbuch der Franken. Die Taufe der Franken, die wichtigsten Folgen. Zustand des Königreichs nach dem Tod von Clovis.
Im 5. Jahrhundert Ein mächtiger Migrationsstrom germanischer Stämme fegte über die Länder des Weströmischen Reiches. In der Folge begann in Westeuropa der Prozess der Bildung einer neuen historischen Gemeinschaft auf der Grundlage von Christentum, römischem Recht und Verwaltung einerseits, Gewohnheitsrecht, deutscher Militärorganisation und traditionellen Verwaltungsformen andererseits.
Die Kombination dieser Elemente schuf das Phänomen des westeuropäischen Mittelalters. Die Übergangszeit vom 5. zum 8. Jahrhundert, als auf dem Gebiet der ehemaligen römischen Provinzen Gallien, Spanien und Italien die Reiche der Franken, Goten, Burgunder und anderer existierten, war die Zeit der Herausbildung neuer politischer Zentren, die führende Stelle unter ihnen nahm nach und nach der fränkische Staat der Merowinger ein. Anschließend zerfiel dieses Land, das für kurze Zeit von der Macht der neuen karolingischen Dynastie zusammengehalten wurde, in mehrere große Teile, aber die Idee der politischen Einheit Westeuropas wurde vom Heiligen Römischen Reich geerbt .
Ein charakteristisches Merkmal des europäischen Mittelalters war das Feudalsystem. In der Frühzeit fand seine Gründung statt. Interessant ist natürlich der Beginn dieses Prozesses, als die Lebensweise der spätantiken Gesellschaft von den neuen „barbarischen“ Völkern beeinflusst wurde.
Es ist bekannt, dass die deutschen Führer die römische Kultur und Zivilordnung respektierten. Der Ostgotenkönig Theoderich in Italien unterstützte eindeutig römische Dichter und begann mit einem römischen Zeremoniell. Die Westgoten in Spanien übernahmen das Verwaltungssystem von den Römern und kodifizierten ihre Gesetze nach römischem Vorbild. Die Goten bekannten sich jedoch zum Arianismus, was ihre Romanisierung verhinderte. Das Frankenreich in Gallien zeichnete sich dadurch aus, dass sein erfolgreicher Schöpfer Chlodwig das Christentum in orthodoxer Form übernahm. Es gab keine Heiratshindernisse zwischen den Gallo-Römern und den Franken, und innerhalb weniger Generationen assimilierten sich diese Völker. So verlief der Prozess der Verschmelzung der beiden Kulturen hier schneller als in anderen westeuropäischen, von germanischen Stämmen bewohnten Gebieten, und auch die Bildung einer neuen historischen Gemeinschaft beschleunigte sich. Die Könige der fränkischen merowingischen Dynastie führten häufig Kriege, das Land litt unter zahlreichen Umverteilungen zwischen den Erben der Königskrone. Zu dieser Zeit sind die Elemente des Feudalismus noch nicht so ausgeprägt wie in der nachfolgenden Karolingerzeit, aber die Grundlage für die Entstehung des Feudalsystems wird vorbereitet, wenn das städtische Leben zurückgeht und die Zahl der Siedler zunimmt Nahrungssuche auf dem Land. Die Geschichte der Franken von Gregor von Tours, eine wichtige Quelle dieser Zeit, enthält anschauliche Beschreibungen der bemerkenswertesten Ereignisse in der Geschichte des Landes. Eine andere Quelle, die sog. Das Salische Gesetz (Lex Salica) oder Salische Wahrheit gibt genauere Auskunft über das Leben der fränkischen Gesellschaft. Die Betrachtung der Landverhältnisse der Franken nach der salischen Wahrheit ist Gegenstand dieser Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, die spezifischen Grundlagen aufzuklären, die der Entstehung feudaler Ordnungen in der Landnutzung vorausgingen. Es ist klar, dass es unmöglich ist, ein solches Thema in einem kurzen Band vollständig zu behandeln, daher wird der Frage des Grundbesitzes, seiner Vererbung und dem Recht, darüber zu verfügen, Aufmerksamkeit geschenkt.
Die salische Wahrheit ist eine Sammlung überwiegend strafrechtlicher Gesetze, eine Art Gerichtsgesetzbuch. Die akzeptierte Datierung dieses Denkmals ist 508 bis 511. Seine Quelle war die Volkstradition, ein vom Brauch anerkanntes Gesetz. Laut Prolog I zum wahrscheinlich im 8. Jahrhundert verfassten Text der Sammlung war das salische Gesetz das Gemeinschaftswerk der vier Ältesten Vizogast, Bodagast, Salegast und Vidugast. King Clovis war sein erster Verleger und Herausgeber. Der Originaltext der Prawda ist nicht erhalten, es gibt nur spätere lateinische Abschriften. Offensichtlich haben die Richter oder einer ihrer Assistenten diese Listen zur Orientierung erstellt. Der ursprüngliche Gesetzestext bestand aus 65 Kapiteln (Titeln). Dann wurde es von den Söhnen von Clovis Childebert und Chlothar ergänzt. Diese und nachfolgende Ergänzungen werden in Form von 7 Kapiteln gegeben. In der karolingischen Zeit wurden der Prawda neue Titel hinzugefügt, deren Gesamtzahl 99-100 erreichte. Die letzte Ausgabe des salischen Gesetzes wurde 798 unter Karl dem Großen erstellt. Dies ist die sog. Lex Emendata, d.h. geändertes Gesetz.
Seit den ersten Veröffentlichungen zu zufälligen Manuskripten haben Gelehrte mehrere kritische Ausgaben der salischen Wahrheit gesammelt und vorbereitet. Es wurde auch viel getan, um seine handschriftliche Geschichte zu studieren. In einem Anhang zur englischen Ausgabe des Denkmaltextes von 1880 schlug Hendrik Kern vor, alle verfügbaren Manuskripte in fünf Gruppen zu unterteilen. Die erste umfasst vier Manuskripte aus dem 8. bis 9. Jahrhundert mit 65 Titeln, die laut dem Wissenschaftler bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen. Ihre Besonderheit ist die Erklärung einiger lateinischer Wörter in der fränkischen Sprache in Form eines Glosses (der sogenannte Malberg-Gloss). Die zweite Gruppe wird durch zwei Handschriften repräsentiert, die sprachliche Besonderheiten des 8.-9. Jahrhunderts aufweisen. Die beiden anderen Gruppen umfassen 41 Handschriften und sind in jeweils zwei Untergruppen unterteilt. Hier wird die salische Wahrheit mit diversen Ergänzungen und Korrekturen der karolingischen Zeit wiedergegeben. Die fünfte Gruppe umfasst die Ausgabe eines verlorenen Manuskripts, das mit den ersten beiden Gruppen zusammenhängt. In Russland wurde die erste Ausgabe der Salic Pravda in lateinischer Sprache mit Anmerkungen von Dmitry Egorov (Kiew, 1906) herausgegeben. Der Text der ersten Gruppe wurde zugrunde gelegt. Eine russische Übersetzung wurde 1913 von Nikolai Gratsiansky angefertigt (posthum 1950 neu veröffentlicht).
Das Studium der salischen Wahrheit wurde in einer Vielzahl von Zusammenhängen durchgeführt. Bereits 1316 berief sich ein Kongress französischer Barone auf das Verbot von Frauen, Grundbesitz zu erben, um zu verhindern, dass die englischen Erben des letzten Capet in der weiblichen Linie ihren Anspruch auf den französischen Thron erheben. Dies führte später zum Hundertjährigen Krieg. Seit der Entstehung der Nationalstaaten in Westeuropa ist um das salische Recht darüber gestritten worden, ob es auf der rechten Rheinseite vor dem Einzug der Franken in das Römische Reich verfasst wurde oder ob es nach deren Einwanderung bereits auf der linken Seite erschien Bank. Deutsche Gelehrte betonten oft den deutschen Ursprung der salischen Wahrheit und idealisierten etwas die Sitten der barbarischen deutschen Gesellschaft. Vertreter der französischen Wissenschaft, zum Beispiel Francois Guizot (1787-1874), warnten vor übermäßigem Enthusiasmus für die „Vorzüge“ dieses Gesetzes und verwiesen auf seine Unvollständigkeit, unhöfliche Moral, Unterentwicklung der Institutionen und so weiter.
In Anbetracht dessen, dass die Forschung umhauen. 19. Jahrhundert den komplexen Ursprung der salischen Wahrheit und verschiedene Textschichten und Editionen entdeckte, erlangte die Analyse große Bedeutung für das Studium dieses Denkmals. Mit ihrer Hilfe begann man aus bestimmten Gesetzesbestimmungen Rückschlüsse auf die wirtschaftliche und soziale Struktur der fränkischen Gesellschaft zu ziehen. Hier lassen sich zwei unterschiedliche Ansätze identifizieren. Marxistische Historiker, die damit beschäftigt waren, die Entwicklung der Gesellschaft als allmählichen Übergang von einer wirtschaftlichen Formation zur anderen zu erklären, beriefen sich auf die salische Wahrheit, um zu erklären, wie der Übergang der ehemaligen germanischen Stämme zum Feudalsystem im frühen Mittelalter unter Umgehung der Formation der Sklavenhalter stattfand . In diesem Zusammenhang entstanden die Studien des prominenten sowjetischen Mediävisten Alexander Neusykhin (1898-1969) über das Leben der Deutschen. In seinem Buch „The Emergence of the Dependent Peasantry as a Class of Early Feudal Society in Western Europe in the 6th-8th Centuries“ der Analyse des salischen Gesetzes ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Schlussfolgerungen von Neusykhin wurden in das allgemeine Konzept der Entstehung des Feudalismus in der Arbeit des Akademikers Sergei Skazkin (1890-1973) "Aufsätze zur Geschichte der westeuropäischen Bauernschaft im Mittelalter" eingebaut. Diese sowjetischen Historiker basierten in ihren Studien auf der Untersuchung spezifischer Tatsachen und Phänomene, und von dieser Seite hat ihre Arbeit nicht an Bedeutung verloren. Die Künstlichkeit des Schemas „Wirtschaftsbildung“ selbst macht sie jedoch konzeptionell wenig brauchbar.
Befürworter eines anderen Ansatzes, der bedingt als „zivilisatorisch“ bezeichnet werden kann, betrachten die Denkmäler des Frühmittelalters, um die Durchdringung von Elementen antiker Kultur und Lebensweise der germanischen Stämme nachzuzeichnen und damit die Herausbildung einer neue historische Gemeinschaft in Westeuropa. Gegenwärtig glauben eine Reihe von Wissenschaftlern, dass der Feudalismus nichts weiter als eine Fata Morgana, eine Idee, eine Interpretation und keine historische Tatsache ist. Gutshof, Vasallentum sind historische Tatsachen, und Feudalismus ist nur ein Konzept, ein Versuch, diese Tatsachen miteinander zu verknüpfen. Die Typen sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen im Mittelalter lassen sich nicht einem allgemeinen Prinzip unterordnen. Daher wird argumentiert, dass der Feudalismus kein historisches, sondern ein historiographisches Phänomen ist. In diesem Zusammenhang wird die Frage diskutiert, inwieweit die eine oder andere Gesetzessammlung die tatsächliche Gesetzgebungspraxis widerspiegelt, die für die VI-VII-Jahrhunderte gilt. bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Als Beispiel für eine „zivilisatorische“ Herangehensweise an das Problem können wir die Worte des österreichischen Forschers Alfons Dopcz anführen, der an die lange Geschichte der Nachbarschaft der Gallo-Römer und Franken vor den Merowingern erinnert und dann schreibt: „ Das salische Gesetz sagt uns eindeutig, dass römische und fränkische Untertanen gleich behandelt wurden. Römischer Landbesitz ist erhalten geblieben: Es gibt Romanus-Besitzer und Romanus-Nebenflüsse. Es gibt keine Gewalt, Sklaverei. Die Zivilisation der Franken wuchs auf einer Grundlage, die mit der späteren römischen Zivilisation verbunden ist. Dieser Ansatz scheint konzeptionell produktiver zu sein.
Bevor wir mit der Betrachtung bestimmter Orte der salischen Wahrheit in Bezug auf Landbesitz fortfahren, müssen einige Vorbemerkungen gemacht werden. Die uns bekannten Gesetzestexte enthalten keinen amtlichen königlichen Beschluss über deren Inkrafttreten. Die Ausnahme bilden einige Kapitel, die in Form von Zusätzen hinzugefügt werden. Im 5. Kapitular – dem Edikt von Chilperic (561-584) – gibt es zum Beispiel einen traditionellen Anfang mit der Einhaltung bekannter Formeln: „Nach Diskussionen im Namen Gottes mit den glorreichsten Optimaten, Antirustien und alle unsere Leute haben entschieden ...". Daher wurde schon vor langer Zeit die Idee geäußert, dass die salische Wahrheit kein staatliches Gesetz oder Kodex im eigentlichen Sinne ist, sondern eine Liste von Gerichtsentscheidungen, eine Sammlung, die von einem Gerichtsgutachter (G. Viarda) zusammengestellt wurde.
Der Gesetzestext ist in Kapitel (Titel) und Paragraphen gegliedert, einige Paragraphen haben Ergänzungen. Gesetzesartikel werden in beliebiger Reihenfolge aufgeführt. Staatliche Institutionen werden eher zufällig genannt. Der strafende Teil überwiegt offensichtlich. Der König und die Grafen haben die höchsten richterlichen Funktionen. Geschworene Richter sind an Entscheidungen lokaler Gerichte beteiligt. Die übliche Form der Bestrafung ist eine Geldstrafe (zwei Beträge sind in Denaren und Solidus angegeben). Einige symbolische Rituale sind auch erkennbar, wie das Werfen von Ähren, Erde und so weiter.
Die eroberten Gallo-Römer wurden tatsächlich nicht per Gesetz in die Stellung von Sklaven versetzt. Es kann jedoch nicht argumentiert werden, dass ihr Status dem des Salischen Frankens in allem gleich war. Zum Beispiel sieht das Gesetz für den Mord an einem freien Franken eine Zahlung von 200 Solidi vor, und für den Mord an einem "Römer" (Landbesitzer und nichtköniglicher Gefährte) werden 100 Solidi (XLI. Sklave) zur Hälfte gezahlt ( XLII.4), für die Entführung eines Freien werden 200 Solidi zuerkannt, für einen „Römer“ 63 Solidi und für einen Sklaven 15 Solidi (XXXIX.1,2,3). Wenn ein Römer einen Franken raubt, wird er mit einer Geldstrafe von 35 Solidi belegt, und wenn ein Römer einen Franken raubt, dann mit einer Geldstrafe von 62,5 Solidi.
Charakteristisch ist das Schweigen der salischen Wahrheit über die christliche Kirche und ihre Diener. Die ersten Referenzen erscheinen in späteren Ergänzungen. Zum Beispiel wurde Kapitel LV um Strafvorschriften für das Anzünden einer Kapelle bei 200 solidi, für das Töten eines Diakons - 300, eines Priesters - 600, eines Bischofs - 900 ergänzt. Paragraph 15 erscheint im Dekret von Chlothar über die Vergebung eines Sklaven der in der Kirche Zuflucht gefunden hat.
Daten zu den Landverhältnissen der Franken nach dem salischen Gesetz können durch Analysen präsentiert werden. Landnutzungsregeln werden hier als bekannt vorausgesetzt, daher wird beiläufig, unsystematisch von ihnen gesprochen.
Die erste Frage betrifft den Grundbesitz. Die Wahrheit spricht ganz klar über die individuelle Landnutzung. Das Grundstück wurde zu einer bestimmten Zeit eingezäunt (IX; XXXIV, 1), um es vor Vieh zu schützen. Die Parzellen lagen entlang der Straßen, Wege verliefen dazwischen (XXXIV.2,3). Das Ackerland wurde in Streifen geschnitten. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass jedes Gemeindemitglied das Recht auf einen Anteil an einem Grundstück mit fruchtbarem Boden hatte. Jede Familie bewirtschaftete ihr zu einer bestimmten Jahreszeit zugeteilte Parzellen. „Der fränkische Ackerbau“, schreibt Alexander Neusykhin, „war ein typischer Pflugbau mit Ochsen- oder Stiereinsatz und einem Pflug mit Eisenschar.“ Die Verwendung von Pferden zum Pflügen bei den Franken erklärt sich aus ihrer außergewöhnlichen Anzahl. Nach der Ernte verwandelte sich das Feld in eine Viehweide. Neben Getreide wurden auf den Parzellen Rüben, Bohnen, Erbsen und Flachs angebaut. Obstgärten (Apfel, Birne) und Weinberge werden ebenfalls erwähnt (XXVII). Es gab auch eingezäunte Bereiche für Vieh („wenn jemand beschließt, das Vieh aus dem eingezäunten Bereich zu treiben ...“ - IX.5). Jede Familie hatte ein eigenes Haus mit Scheune und Nebengebäuden für die Tierhaltung (Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine). Die salische Wahrheit schützt all dieses Eigentum definitiv vor dem Eingriff anderer Personen.
Im salischen Gesetz finden sich Spuren von Gemeinschaftseigentum, das Land war noch nicht im vollen Besitz, sondern nur in individueller Nutzung. Beispielsweise durfte es nicht an Dritte verkauft oder vererbt werden. Äcker, Weiden, Wiesen waren Eigentum der Gemeinde. Eine Bestätigung dafür findet sich im Kapitel über Migranten. Hier ist die Regel angedeutet, dass sich ein Besucher in einer Villa (d.h. in einem Dorf) nur mit allgemeiner Zustimmung seiner Bewohner niederlassen darf. Ein Protest einer von ihnen reicht aus, um die neue Person am Bleiben zu hindern (XLV.1). In einer Ergänzung zur salischen Wahrheit, Extravagantia genannt (um die Mitte des 9. Jahrhunderts zusammengestellt), gibt es aussagekräftige Worte: „Eine Person kann sich nicht niederlassen, wenn die Nachbarn Gras, Wasser und die Straße (nicht ihre Zustimmung zur Nutzung ausdrücken)“ (Absatz 11 ). Geht innerhalb von 12 Monaten kein Protest ein, bleiben der Neuansiedler und seine Arbeitskraft unverletzlich (XLV.3). Offensichtlich drückt dieses Erfordernis der allgemeinen Vereinbarung das Recht der Eigentümer aus, dem Siedler kommunales Land zuzuweisen oder nicht.
Kommunaler Grundbesitz findet natürlich seine Erklärung in jener archaischen Art der Landbewirtschaftung, als ein Stück Wald zum Pflügen gerodet wurde. Diese harte Arbeit erforderte die Teilnahme einer großen Anzahl von Menschen. Allmählich, insbesondere unter dem Einfluss der römischen Technologie, gingen die Bauern Westeuropas vom Abholzen von Wäldern und der Bearbeitung leichter Böden zur Entwässerung feuchter Gebiete und zur Bearbeitung schwerer Böden über. Das Wandersystem der Landwirtschaft wich einem fortschrittlicheren Dreifeldersystem.
Das Gemeinschaftseigentum hatte jedoch eine andere Ursprungsquelle - das Stammesleben. Sein lebendiger Ausdruck war die Verpflichtung, in den Prozessen gegen ihre Angehörigen einen Eid abzulegen und die materielle Verantwortung für ihre Verbrechen zu tragen. Der Prozess in der Salic Pravda kannte keine andere Form der Verteidigung oder Anklage als die Bereitstellung von Zeugen für ihre Unschuld, die zum Beweis einen Eid leisteten. Feuer- und Wassertests waren vorgesehen. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Verurteilten zahlten seine Angehörigen das Bußgeld (LVIII.1). Auch die Vira für den Ermordeten wurde unter seinen Angehörigen verteilt: „Wenn jemandes Vater ums Leben gebracht wird, sollen seine Söhne die Hälfte der Vira nehmen und die nächsten Angehörigen die andere Hälfte untereinander teilen, beide väterlicherseits und auf der mütterlichen Seite“ (LXII.one). Bei der Zusammenstellung der Salic Truth wurde jedoch bereits ein Ausweg aus der Stammeshaft aufgezeigt. Wer auf die Verwandtschaft verzichten will, muss seine Weigerung in der Gerichtsverhandlung erklären und nimmt dann, wenn einer seiner Angehörigen getötet wird oder stirbt, nicht mehr an der Teilung des Erbes oder der Zahlung einer Geldstrafe (vira) teil bei seinem eigenen Tod ging sein Vermögen an die Staatskasse (LX.1).
Von großem Interesse ist die Entwicklung des allodialen Landbesitzes bei den Franken. Es ist notwendig, die erste Bedeutung des Wortes "Allod" in der vorfeudalen Zeit von der späteren zu unterscheiden, die unter dem Einfluss der feudalen Beziehungen entstand. In diesem letzten Sinne steht „allod“, der volle Besitz des Landes, im Gegensatz zu „lena“, d.h. bedingter Landbesitz nach Vereinbarung (foedus). Ursprünglich war die Allod ein Grundstück, das freie Mitglieder der Gemeinschaft erhielten, als sie ein Ödland aufteilten. Der Eigentümer der Allod trug unter Beibehaltung seines Privatbesitzes alle Pflichten zugunsten der Gemeinschaft. Diese Zuteilung konnte vererbt werden, was von der salischen Wahrheit (LIX.5) aufgezeichnet wurde. Als Erben werden nur Söhne genannt, aber auch Brüder werden erwähnt. Alexander Neusykhin schlägt vor, „Brüder“ im Text des Gesetzes über Allods als „Söhne“ und nicht als Brüder des Vaters zu verstehen. Seiner Meinung nach schlich sich eine gewisse Mehrdeutigkeit aus der Unbestimmtheit der juristischen Terminologie früher Gesetzessammlungen ein.
Der grundlegende Punkt in diesem Fall ist die Festigung des Rechts, Land in absteigender Linie vom Vater auf den Sohn zu erben. Dies führte zur Entstehung von privatem Landbesitz zusammen mit kommunalem Land. Leider bietet die salische Wahrheit keine vollständige Klarheit über ein so wichtiges Thema. Vollständiges Eigentum impliziert die freie Verfügung über die Zuteilung, einschließlich ihres Verkaufs oder Tauschs. Der Gesetzestext erwähnt dies jedoch an keiner Stelle. Offensichtlich wurde die Allod nur durch Erbschaft weitergegeben. Auch während des Aufenthalts an einem neuen Ort erwarb der Siedler das Grundstück nicht durch Kauf, sondern durch Landabtretung von der Gemeinde (XLV.1). Während der Fahrt wurde er mit einer Ladung seiner Habseligkeiten vor Raub und Willkür geschützt (XIV.5). Als der Bauer seinen früheren Wohnort verließ, verlor er offenbar sein Grundstück. Unmittelbarer Grund für die Umsiedlung war die Zersplitterung der Kleingärten durch das natürliche Wachstum der Bewohner des Dorfes (Villa). Offensichtlich war die Phase der gleichmäßigen Verteilung der Grundstücke bereits überschritten, und in den Händen einiger Gemeindemitglieder gab es aufgrund des Erbes von Allods mehr Land, während andere einen Mangel daran hatten, was sie zwang, an einen neuen Ort zu ziehen . Es ist klar, dass ein Siedler in kleinen Dörfern mit einer günstigeren Aufnahme rechnen konnte als in großen, wo die Zuweisung neuer Grundstücke mit der Aufteilung und Bewirtschaftung neuer Gebiete verbunden war. Das herrenlose Land wurde jedoch immer weniger: Die Könige verteilten es großzügig an ihre Vertrauten. Infolgedessen gingen die verarmten Gemeindemitglieder, die zu Siedlern wurden, zu Adeligen und erhielten von ihnen Land mit der Verpflichtung, es zu bebauen. Im Laufe der Zeit, wenn die Gemeinde selbst von allen Seiten durch den Besitz des Herrn eingeschränkt wird, werden die Traditionen der kommunalen Grundbesitzrechte nicht an Kraft verlieren und ein Teil des Landes wird weiterhin gemeinsam bewirtschaftet, ganz zu schweigen von der Nutzung von Almenda ( Wiesen, Weiden, Waldstücke). Im Norden Frankreichs bestand beispielsweise der kommunale Landbesitz bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Existenz von Allods zerstörte die Gemeinschaft nicht so sehr wie das direkte Eingreifen des Königs in ihre Rechte. Zum Beispiel das Recht, einen Ausländer abzulehnen. Im Kapitel über die Raubüberfälle auf die salische Wahrheit wird gesagt, dass es unmöglich ist, einer Person, die einen königlichen Brief besitzt, die Umsiedlung unter Strafe von 200 Solidi zu verweigern (XIV.4). Der Mann des Königs stand unter besonderem Schutz. Grafen fallen auf, ihre Hilfsrichter, königliche hochrangige Sklaven "Sacebarons", königliche Waffenbrüder. Das Leben eines Mannes im Dienste des Königs (wie das des Grafen-Vizekönigs) wird mit einer Geldstrafe von 600 Solidi, dem Dreifachen des üblichen freien Frankens, bewacht (XLI.1,3,5). Während der Kampagne wird die Disziplin verschärft. Hier wird die Ermordung eines einfachen Soldaten mit 600 Solidi und die Ermordung „eines in königlichen Diensten“ mit 1800 Solidi bewertet (LXIII.1,2). Gleichzeitig wird auch das Eigentum des Grafen besonders geschützt, Diebstähle „unter der Burg“, „in der Oberstube“, Schäden an der Meistermühle sind besonders vorgeschrieben. Der Adel versucht, seine privilegierte Stellung zu festigen. Gleichzeitig eröffnet der königliche Dienst vielen die Möglichkeit, ihren Besitz zu mehren. Zusammen mit erblichen Landbesitzungen (Allods) erscheinen Nutznießer unter den Karolingern, Lehensbesitz, dem königlichen Dienst unterworfen. Dies ist bereits ein sichtbarer Ausdruck des Feudalsystems.
Die salische Wahrheit erwähnt auch die abhängige Bevölkerung, vor allem die Sklaven. Es wird auch über halbfreie Menschen gesprochen, die sogenannten. litas Ein Sklave ist das Eigentum seines Herrn, er unterliegt Bestrafung, Folter und der Todesstrafe. Ehen zwischen Sklaven und Freien sind verboten. Für das Verbrechen eines Sklaven zahlt sein Herr. Sklaven werden in der salischen Wahrheit als Diener im Haus ihres Herrn dargestellt – „die Diener des Herrn“. Unter ihnen werden aber auch Weinbauern, Schmiede, Zimmerleute, Pferdeknechte, Schweinehirten, Goldschmiede genannt (X.4.5; XXXV.6). Es ist nicht ersichtlich, dass Sklaven intensiv als Pflüger auf den Feldern eingesetzt wurden. Diebstahl und Mord an einem Sklaven werden gleichermaßen mit 30 Solidi bewertet. Das Leben eines Litas wird etwas höher geschätzt - auf 100 Solidi. Lit konnte nur mit Zustimmung seines Herrn und unter Rückgabe seines Eigentums durch ein Lösegeld die Freiheit erlangen. Bemerkenswert ist, dass die salische Wahrheit die Schuldsklaverei noch nicht kennt. Bei Verletzung einer Schuldverpflichtung oder Nichtrückzahlung eines Darlehens wird ein Bußgeld verhängt und die Schuld unter Mitwirkung der gräflichen Bediensteten zurückgezahlt (L.1-3; LII.1).
In den VI-VIII Jahrhunderten. es findet eine Spaltung der fränkischen Gesellschaft in freie und vollwertige Grundbesitzer einerseits und unselbstständige Landnutzer andererseits statt. Die Stellung eines Sklaven, eines Litas und eines Gemeindebauern wird im Status eines „Leibeigenen“, eines Leibeigenen, ausgeglichen. „Der ehemalige freie Mann“, schreibt der bekannte sowjetische Mediävist Aron Gurevich, „wurde zu einem abhängigen Inhaber, wurde schließlich aus dem System der öffentlichen Rechtsbeziehungen ausgeschlossen, nahm nicht mehr an öffentlichen Versammlungen teil, leistete keinen Militärdienst, war unter der Gerichtsbarkeit seines Herrn, der ihn wie einen Sklaven körperlich bestrafen konnte. Man kann jedoch der Beobachtung des herausragenden russischen Historikers Nikolai Kareev (1850-1931) zustimmen, dass die Bildung eines neuen Beziehungssystems die Entwicklung von Elementen der früheren römischen Ära, der sogenannten, fortsetzte. Kolonie.
Salische Wahrheit beschreibt die fränkische Gesellschaft am Anfang dieses Prozesses, als die freien kommunalen Landnutzer unter Beibehaltung vieler Züge traditioneller deutscher Lebensweise und Gleichheit untereinander allmählich den Staatsprinzipien der merowingischen Macht erlagen. Im Gesetzestext sind noch Spuren der Existenz der patriarchalischen Sklaverei, des Stammeslebens, des gemeinsamen Landbesitzes mit seinen gestreiften Streifen, der traditionellen Einteilung in Bezirke (pagi), Garantien in Gerichtsverfahren usw. zu erkennen Antike Zivilisation ist bereits sichtbar: das Erscheinen geschriebener Gesetze, die Verwendung von Denaren und Solidi, der Wunsch, Blutrachen zu begrenzen und durch Geldentschädigungen zu ersetzen usw. In der Natur der Landnutzung im salischen Recht sind deutsche Prinzipien (Freiheit von Bewegung, gemeinschaftliche Landnutzung) erscheinen noch in einer reineren Form vorfeudaler Verhältnisse.
Mehr zum Thema Grundbesitzformen und Grundbesitz in der fränkischen Gesellschaft der salischen Wahrheitszeit.:
- 11. Der Sieg des Privateigentums an der bäuerlichen Parzelle und die Gründe für den Ruin der freien Franken.
Der Untergang der Haupthochburg der Sklaverei – des Römischen Reiches – ermöglichte vielen ethnischen Gruppen und Völkern den Eintritt in die politische Arena Westeuropas. Das Sklavensystem wurde durch das Feudalsystem ersetzt.
Das System der feudalen Beziehungen entstand unter verschiedenen historischen Bedingungen. In einigen Fällen bildete es sich in den Tiefen der Sklavenhaltergesellschaft selbst während ihres Zerfalls, wie zum Beispiel im alten Rom, in anderen während des Zerfalls des Stammessystems.
Die Entstehung des fränkischen Staates und seine Merkmale
Die erste Erwähnung der Franken in historischen Denkmälern erschien im 3. Jahrhundert. Ihre Vorfahren hießen anders: Hamavs, Sicambri, Batavs usw. Schon unter Cäsar versuchten einzelne germanische Stämme, nach Gallien zu ziehen, einer reichen römischen Provinz im Zentrum Westeuropas, so Tacitus, „um ihre Sümpfe und Wälder zu tauschen sehr fruchtbares Land“. Die germanischen Stämme in den Werken römischer Historiker wurden Franken genannt. Der Name „Frank“ (er wird mit „mutig“, „frei“ übersetzt) war ein Sammelbegriff für eine ganze Gruppe niederrheinischer und mittelrheinischer germanischer Stämme. Später wurden die Franken in zwei große Zweige geteilt - Küsten (Salic) und Küsten (Ripuan).
Die Römer setzten die Germanen als Söldner ein und siedelten sie an ihren Grenzen an, um die Grenzen zu bewachen. Ab 276 kamen die Franken zunächst als Gefangene, dann als Verbündete der Römer ins römische Gallien. Die Franken befanden sich auf der Stufe einer frühen Klassengesellschaft. Die Nachbarschaftsmarkengemeinschaft war die Grundlage ihres sozialen Lebens. Seine Stabilität beruhte auf dem Recht des kollektiven Landbesitzes und der Gleichheit der Mitglieder der Marke - freier Bauernkrieger. Dieser Faktor spielte eine wichtige Rolle bei der Überlegenheit der Franken gegenüber allen anderen germanischen Stämmen.
Nach dem Untergang des Römischen Reiches im 5. Die Franken erobern das nordöstliche Gallien. Es war ein bedeutender Teil des Territoriums des Römischen Reiches. Die eroberten Besitzungen fielen unter die Herrschaft der ehemaligen fränkischen Führer. Unter ihnen ist Merovei bekannt, von dessen Namen der Name der merowingischen Königsfamilie stammt. Der berühmteste Vertreter des merowingischen Geschlechts ist König Chlodwig (481-511), der König der salischen Franken war. 486 erobert er die Region Soissons (den letzten römischen Besitz in Gallien) mit ihrem Zentrum in Paris.
496 nimmt Clovis zusammen mit dreitausend Kriegern das Christentum an. Dies hatte sehr schwerwiegende politische Folgen. Tatsache ist, dass andere germanische Stämme, die ebenfalls versuchten, von den Überresten des Römischen Reiches zu profitieren, Arianer waren, die die Dogmen der römischen Kirche leugneten. Nun erhielt Clovis die Unterstützung der Kirche im Kampf gegen sie. Um 510 schuf Chlodwig ein riesiges Königreich vom Mittelrhein bis zu den Pyrenäen. Interessant ist die Tatsache, dass Chlodwig sich im besetzten Gebiet zum Repräsentanten des römischen Kaisers proklamiert, denn die nominelle Aufrechterhaltung der politischen Bindungen an das Reich war eine der Möglichkeiten, Sonderrechte zu proklamieren, und wird zum Herrscher eines einzigen, nicht mehr Stammes-, aber territoriales Königreich.
In den eroberten Ländern ließen sich die Franken hauptsächlich in ganzen Gemeinden nieder und nahmen leere Ländereien sowie Grundstücke der ehemaligen römischen Schatzkammer und der lokalen Bevölkerung weg. Im Großen und Ganzen war das Verhältnis der Franken zur gallo-römischen Bevölkerung jedoch friedlich. Dies sorgte weiter für die Bildung einer völlig neuen sozio-ethnischen Gemeinschaft der keltisch-germanischen Synthese.
Die Darstellung des Materials in diesem Lehrbuch basiert auf der zweiten Periodisierung.
In der ersten Phase gab es, wie bereits erwähnt, einen Prozess der Landnahme und die Bildung eines fränkischen Staates der frühen Klasse.
Am Ende des VI - Anfang des VII Jahrhunderts. vier Teile des fränkischen Staates nahmen Gestalt an. In jedem von ihnen ragten Adelsfamilien heraus, die alle Macht besaßen - königliche Bürgermeisterämter. Die Macht der Könige lag in ihren Händen. Diese Periode wurde die „Ära der faulen Könige“ genannt.
Die zweite Etappe in der Geschichte des fränkischen Staates ist Aufstieg, Aufstieg und Fall der Karolinger.
Die Blütezeit der karolingischen Dynastie fällt in die Regierungszeit Karls des Großen (Sohn von Pippin dem Kurzen), der von 768 bis 814 regierte.
Litas gehörte zu den Halbfreien. Ihre Rechtsstellung war sehr spezifisch. Sie besaßen Grundstücke, führten ihre eigene Wirtschaft, nahmen an Feldzügen und Gerichtsverhandlungen teil, konnten teilweise über ihr Eigentum verfügen und Geschäfte mit anderen Personen abschließen.
Ihr Leben wurde von einem Wergeld bewacht, das zweimal niedriger war als das Wergeld, das für das Leben eines freien Gemeindemitglieds bestimmt war.
Soziale Unterschiede zeigten sich deutlich in der Rechtsstellung der Sklaven. Dies war die am stärksten unterdrückte Bevölkerungsgruppe des fränkischen Staates. Aus gewohnheitsrechtlicher Sicht galt der Sklave als Sache und wurde einem Tier gleichgestellt. Ihre Arbeitskraft wurde als Hilfsarbeit auf den Höfen der freien Franken und des Dienstadels eingesetzt. Im Gegensatz zu den Sklaven von Athen und Rom verfügten die fränkischen Sklaven jedoch über bewegliches Vermögen, was aus der Zahlung von Geldstrafen in Höhe von sechs solidi (Kosten für zwei gesunde Kühe) hervorgeht. Es deutet auch darauf hin, dass sie eine gewisse Rechtsfähigkeit hatten.
Im südlichen Teil des fränkischen Staates lebte die gallo-römische Bevölkerung: Die Römer waren königliche Gefährten, die Römer waren Bauern, die Römer zahlten Steuern. Kapitel 41 der Salic Truth spricht von der Verantwortung für den Entzug des Lebens dieser Bevölkerungsgruppen.
Staatssystem des fränkischen Staates in der ersten Phase (V-VII Jahrhunderte)
Die Staatsbildung erfolgt durch die Degeneration der Organe der Stammesdemokratie der Franken zu Organen der Staatsgewalt. Riesige eroberte Gebiete erforderten eine besondere Organisation der Verwaltung und ihres Schutzes. Clovis war der erste fränkische König, der seine Position als Alleinherrscher etablierte. Von einem einfachen Kriegsherrn verwandelte er sich in einen Monarchen und zerstörte alle, die sich ihm in den Weg stellten. Ein wichtiger Moment bei der Stärkung der Positionen des fränkischen Staates war die Annahme des Christentums durch Clovis. Der Prozess der Auflösung der frühen Feudalmonarchie begann. Staatsoberhaupt - König zu dieser Zeit wurde er vor allem Militärführer, dessen Hauptanliegen die Wahrung des öffentlichen Friedens und die Befriedung von Personen waren, die den Gehorsam verweigerten. Der Staatsapparat wurde noch geschaffen, es gab keine klare Abgrenzung der Befugnisse der königlichen Beamten. Die Verwaltung des Staates wurde in den Händen der königlichen Diener und Mitarbeiter konzentriert. Das sogenannte Palast-Patrimonial-Regierungssystem war geboren. Unter den engen Mitarbeitern des Königs ragten heraus: der Palastgraf, der richterliche Funktionen ausübte; referendary - der Bewahrer des königlichen Siegels, der für die Büroarbeit des Königs verantwortlich war; Camerarius - der die Einnahmen an die Schatzkammer und die Sicherheit des Eigentums des Palastes überwachte.
Die Bildung lokaler Behörden erfolgte unter dem Einfluss spätrömischer Orden. So wurde das gesamte Staatsgebiet in Bezirke eingeteilt, die von vom König ernannten Grafen geleitet wurden. Sie übten polizeiliche, militärische und justizielle Funktionen aus. Die Grafschaften wurden in Hunderte aufgeteilt.
Im 8. Jahrhundert Regierung wurde schwieriger. 800 wurde der fränkische Staat zum Reich ausgerufen.
Königliche Macht erhielt einen besonderen Charakter und seine Befugnisse. Die Macht und Persönlichkeit des Kaisers wurde von der Kirche geheiligt anerkannt. Der Kaisertitel machte die gesetzgebenden und richterlichen Rechte des Königs unbestreitbar. Der Staatsapparat konzentrierte sich jedoch nach wie vor auf den Hof.
Die lokale Verwaltung war wie folgt organisiert. Das Königreich wurde in Bezirke eingeteilt - pagi. Jeder von ihnen wurde von einem Grafen geleitet, der normalerweise vom König aus dem Kreis der Großgrundbesitzer ernannt wurde. Er übte administrative, gerichtliche, militärische und steuerliche Befugnisse aus. Pagi wiederum wurden in Hunderte geteilt. An ihrer Spitze stand jeweils ein Zenturio, der Vertreter des Grafen in der unteren Instanz. In einigen Gebieten (normalerweise Grenzgebieten) ernannten die Könige Herzöge, deren Befugnisse sich über mehrere Grafschaften (von 2 bis 12) erstreckten. Der Herzog übte die Befugnisse des Grafen in den ihm anvertrauten Teilen des Territoriums aus, in denen es aus irgendeinem Grund zu diesem Zeitpunkt keine Zählung gab; Ihre Hauptaufgaben bestanden darin, den Frieden im Land zu wahren und die Verteidigung zu organisieren.
Gesetz des Fränkischen Staates
Der ursprüngliche Text dieser Wahrheit ist uns nicht überliefert. Die ältesten Manuskripte stammen aus der Zeit von Pippin dem Kurzen und Karl dem Großen (8. Jahrhundert). Dieser Originaltext wurde unter den Königen Childebert I. und Chlothar I. (VI. Jh.) ergänzt.
Die salische Wahrheit wurde in lateinischer Sprache verfasst und verbreitete ihre Wirkung vor allem im Norden des Landes. Im Süden war der Kodex von Allaric in Kraft, den Clovis in den Angelegenheiten der Gallo-Römer anzuwenden befahl.
Bürgerrecht. Während der Herrschaft der Merowinger behielten die Franken noch gemeinschaftlichen Grundbesitz. Der Titel LIX der salischen Wahrheit bestimmte, dass das Land (Allod) der gesamten Stammesgemeinschaft gehörte, in deren gemeinsamer Nutzung Wälder, Ödland, Weiden, Sümpfe, Straßen, ungeteilte Wiesen standen. Die Franken verfügten über diese Ländereien zu gleichen Bedingungen. Gleichzeitig weist die salische Wahrheit darauf hin, dass die Franken das Feld, den Garten oder den Gemüsegarten getrennt nutzten. Sie umzäunten ihre Grundstücke mit einem Zaun, dessen Zerstörung eine Bestrafung nach der salischen Wahrheit zur Folge hatte (Titel XXXIV).
Privateigentum an Grund und Boden entstand durch Schenkungen, Käufe von den Römern und die Beschlagnahme unbesetzten Landes. Später wurden diese Länder Allod genannt. Daneben gab es von den Eigentümern übertragene Ländereien zur Nutzung und zum Besitz für bestimmte Dienstleistungen und Naturalleistungen, das sogenannte Prekarium. In unruhigen Zeiten, als der Adel Kriege um den Besitz von Land führte, übertrugen viele Besitzer von Allods es bewusst an mächtige Magnaten unter der Bedingung der Patronage, d.h. Schutz vor Angriffen anderer Magnaten.
Nach der Reform von Charles Martel erschien eine neue Art des Landbesitzes - Pfründe - bedingter Besitz von Land, verbunden mit Dienst und bestimmten Pflichten. In Zukunft wird diese Art von Eigentum zum wichtigsten.
Gesetze der Verpflichtungen. Mit Ausnahme von Grundstücken kann jeder andere Besitz Gegenstand von Verkauf, Verleih, Tausch oder Schenkung sein. Die Übertragung des Eigentums von einer Person auf eine andere erfolgte traditionell, d.h. die informelle Übertragung von Dingen, die den Verträgen folgten. Die Erwerbsverjährung wurde ebenfalls anerkannt, bei den Franken war sie sehr kurz - ein Jahr.
Kreditverpflichtungen wurden gemäß Salic Pravda besonders geschützt, wo in den Titeln 50 und 52 das Verfahren zur Geltendmachung einer Forderung sorgfältig geregelt ist.
Erbrecht. Frauen konnten das Land zunächst nicht erben. Dieses Recht erhielten sie erst im 7. Jahrhundert. Es gab keine testamentarische Erbfolge. Allerdings praktizierten die Franken die sogenannte Affatomie, eine besondere Art der Eigentumsübertragung nach dem Tod des Besitzers. Titel 46 definierte das Verfahren für eine solche Übertragung in einigen Einzelheiten.
Familiengesetz. Die salische Wahrheit gibt nicht die Reihenfolge der Eheschließung an. Allerdings ist die Analyse von Art. 3 Kapitel XXV lässt den Schluss zu, dass die Ehe ohne Zustimmung der Eltern nicht geschlossen wurde. Freie Ehen mit Sklaven wurden nicht genehmigt, da sie sonst ihre Freiheit verlieren würden. Das Familienrecht der Franken ist geprägt von der Dominanz des Mannes über die Frau, des Vaters über die Kinder. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Macht ihres Mannes und Vaters nicht so unbegrenzt war wie im alten Rom. Seine Macht über seine Söhne endete mit Erreichen der Volljährigkeit (12 Jahre). Hinsichtlich seiner Töchter behielt er seine Macht bis zu deren Heirat. Spezifisch war die Stellung der Frau, die unter der Vormundschaft ihres Mannes stand. Eine Scheidung wurde für sie als inakzeptabel anerkannt. Wenn der Ehemann beschloss, sich von seiner Frau, die nicht beim Ehebruch ertappt wurde, sowie bei der Begehung eines Verbrechens scheiden zu lassen, musste er ihr und den Kindern alles Eigentum hinterlassen. Bei der Eheschließung übertrug der Bräutigam der Braut bestimmtes Vermögen – in Höhe ihrer Mitgift meist bewegliches Vermögen (Vieh, Waffen, Geld). Später wurden Immobilien auch als Mitgift übertragen. Daher stellte sich heraus, dass sich im Falle des Todes eines Ehemanns manchmal bedeutendes Vermögen in den Händen von Witwen befand. Daher wurde festgelegt, dass eine Person, die eine Witwe heiratete, den Betrag von drei Solidi und einen Denar an die Verwandten des ersten Ehemanns im Voraus zahlen musste. Diese Gebühr wurde an den nächsten Verwandten des ersten Ehemanns gezahlt. Wenn es sich nicht herausstellte, betrat sie die königliche Schatzkammer.
Strafrecht. Die meisten Artikel der Salic Truth beziehen sich auf das Strafrecht, dessen Normen in kasuistischer Form ausgedrückt werden, d.h. es fehlt an verallgemeinernden und abstrakten Begriffen - "Schuld", "Verbrechen", "Vorsatz", "Fahrlässigkeit" usw. Aus der Analyse dieser Artikel können wir schließen, dass ein Verbrechen darunter eine Handlung ist, die einer bestimmten Person körperlichen, materiellen oder moralischen Schaden zufügt. Aus diesem Grund widmet die salische Wahrheit zwei Arten von Verbrechen mehr Aufmerksamkeit: gegen eine Person und gegen Eigentum. Die erste davon umfasst alle Handlungen im Zusammenhang mit Körperverletzung, Mord, Beleidigung usw. Zum zweiten - alle Eingriffe auf das Eigentum. Der dritte Typ – gegen die Ordnung der Kontrolle – ist nur wenigen Artikeln gewidmet.
Gegenstand des Verbrechens. Aus dem Text der salischen Wahrheit folgt, dass alle Bevölkerungsschichten Rechtssubjekte waren. Das heißt aber nicht, dass sie alle die gleiche Verantwortung tragen. Die Strafen für einen Sklaven wurden strenger bestimmt, wie die Todesstrafe, die auf freie Franken nicht angewendet wurde.
Auch bei Diebstahlsfällen wurde die Zugehörigkeit zu Sklaven oder Freien berücksichtigt (Titel 40, § 1, 5). Für ein Verbrechen, das von einem Sklaven begangen wurde, war der Besitzer nur dann verantwortlich, wenn er sich weigerte, den Sklaven zur Folter auszuliefern. Darüber hinaus wurde die Verantwortlichkeit für den Eigentümer genauso festgestellt, als ob die Straftat von einer freien Person begangen worden wäre (Titel 40, § 9).
Auch in der salischen Wahrheit gibt es Hinweise auf das Gruppensubjekt. So wurde zum Beispiel im Titel „Über Mord in einer Menschenmenge“ die Verantwortung in Abhängigkeit vom Aktivitätsgrad seiner Teilnehmer festgelegt. Aber gleichzeitig erkennt die salische Wahrheit in einigen Fällen immer noch die gleiche Verantwortung für alle an, die ein Verbrechen begangen haben (Titel XIV, § 6). All dies bestätigt die These, dass die Gesellschaft ihre Klassenstruktur noch nicht gebildet hat.
objektive Seite. Die salische Wahrheit erkannte nur Handeln als strafbar an, Unterlassen war nicht strafbar. Schon die Franken unterschieden zwischen solchen Methoden des Eigentumsdiebstahls wie Diebstahl und Raub. Außerdem wurde nicht nur die Höhe des gestohlenen Geldes berücksichtigt, sondern auch, auf welche Weise die Straftat begangen wurde (Aufbrechen, Schlüsselauswahl usw.) - Titel XI, § 2, 5.
Subjektive Seite. Die salische Wahrheit sah eine Haftung nur für vorsätzliche Verbrechen vor. Andere Formen der Schuld kannte sie noch nicht.
Gegenstand der Straftat waren in der Regel nur jene sozialen Beziehungen, die den Schutz von Leben, Gesundheit und Ehre einer Person sowie ihres Eigentums regelten. Es gab jedoch separate Artikel, die bestimmte Aspekte der sozialen Beziehungen im Bereich der Verwaltungsordnung regelten (Titel 51, § 2).
Die Betrachtung der Zusammensetzung des Vergehens gemäß der salischen Wahrheit lässt uns den Schluss zu, dass das Gesetz ebenso wie die Gesellschaft und der Staat selbst unvollkommen waren und sowohl Merkmale eines Stammes- als auch eines Staatssystems aufwiesen.
Bestrafung. Nach der salischen Wahrheit waren seine Ziele: allgemeine und besondere Warnung, Vergeltung, aber das Hauptziel war Schadensersatz. Die salische Wahrheit sah, wie bereits erwähnt, verschiedene Strafen für Freie und Sklaven vor. Wenn also für freie Franken die Strafen überwiegend Eigentum waren, dann wurden für Sklaven neben Geldstrafen auch Körperstrafen und sogar die Todesstrafe verhängt (allerdings nur in Ausnahmefällen für schwere Verbrechen) - Titel 40, § 5.
Die Strafen für die salische Wahrheit waren sehr hoch. Der kleinste von ihnen entsprach drei Festkörpern, und das sind die Kosten für eine Kuh, "gesund, gehörnt und sehend".
Die Strafe für Mord hieß „vira“, „wergeld“. Es kam auf die Identität des Opfers an. Wenn dies ein Bischof ist, haben sie 900 Solidi bezahlt, eine Zählung - 600 usw. Interessant ist hier die Tatsache, dass der Mord an Frauen bezahlt wurde, wie für den Mord an einer Person, die im königlichen Dienst stand - 600 Solidi. Es ist ganz klar, dass solch hohe Geldstrafen für gewöhnliche Franken unerschwinglich waren. Interessant ist in diesem Zusammenhang Titel 58 „Über eine Handvoll Erde“, der das Verfahren zur Zahlung des Wergeldes durch die Angehörigen des Mörders regelt.
Gericht und Prozess. Während des Stammessystems gehörten richterliche Funktionen der Versammlung des Clans. In der Ära der salischen Wahrheit war die Justizbehörde das Gericht der Hundert – ein Malus, der regelmäßig zu bestimmten Zeiten zusammentrat und aus sieben gewählten Rahinburgs bestand, die Fälle unter dem Vorsitz eines gewählten Tungin entschieden. Rakhinburgs wurden normalerweise von wohlhabenden Leuten ausgewählt, aber Hunderte von freien Einwohnern mussten an Gerichtssitzungen teilnehmen. Die Rakhinburgs waren verpflichtet, nach dem Gesetz zu urteilen, und der Kläger hatte das Recht, sie an diese Verpflichtung zu erinnern. Wenn sie sich danach weigern, den Fall zu prüfen, werden sie zu einer Geldstrafe von drei Solidus verurteilt, und wenn sie nicht nach dem Gesetz verurteilt werden, zu einer Zahlung von 15 Solidus (Titel 57, Art. 1-2). .
Mit dem Aufstieg der Macht des Königs und seiner Agenten auf dem Feld begannen die richterlichen Funktionen von Hunderten von Grafen und Herzögen ausgeführt zu werden. Die Könige begannen auch, Gerichtsverfahren in Erwägung zu ziehen. Während der Ära der "faulen Könige" erhielten die Bürgermeister zusammen mit einigen Beamten des Gerichts das Recht, im Namen des Königs zu urteilen. Karl der Große führte eine wichtige Gerichtsreform durch: Er schaffte die Pflicht freier Einwohner ab, zu allen Gerichtssitzungen zu erscheinen, und ersetzte die gewählten Rachinburgs durch vom König ernannte Gerichtsmitglieder - Scabins.
Scabins wurden von den Gesandten des Königs unter den örtlichen Landbesitzern ernannt. Sie standen im Dienst des Königs und richteten unter dem Vorsitz des Grafen. Unter Karl dem Großen entstanden auch kirchliche Gerichte sowie für Laien mit einer gemischten Zusammensetzung von Richtern in einer bestimmten Kategorie von Fällen.
Der Prozess hatte einen anklagenden und kontradiktorischen Charakter. Das Auffinden des gestohlenen Gegenstands, die Vorladung des Angeklagten und Zeugen lag in der Verantwortung des Opfers. Die salische Wahrheit begründete eine schwere Haftung für das Nichterscheinen des Angeklagten vor Gericht (Titel 56) sowie für Zeugen, deren Aussage für den Kläger erforderlich ist (Titel 49). Übrigens sah die Salicheskaya Pravda eine Geldstrafe von 15 Solidi (Titel 43) wegen Falschaussage vor.
Was die Suche nach einem gestohlenen Gegenstand betrifft, so wurde es durch Titel 37 geregelt und hieß Verfolgung im Kielwasser. Bei der Umsetzung wurde ein wichtiger Umstand festgestellt: In welcher Zeit wurde der gestohlene Gegenstand gefunden. Wenn vor Ablauf von drei Tagen, dann musste der Kläger durch Dritte beweisen, dass diese Sache ihm gehörte. Und wenn nach dem Diebstahl drei Tage vergangen sind, muss derjenige, bei dem es gefunden wurde, die Gewissenhaftigkeit des Erwerbs beweisen. Titel 47 „Auf der Durchsuchung“ bestimmte das Verfahren zur Beweisführung der eigenen Rechte an strittigen Sachen. Interessant ist hier die Frist für die Ansetzung eines Gerichtsverfahrens - 40 Tage für diejenigen, die auf der einen Seite der Loire wohnen, und 80 Tage auf der anderen Seite.
Das Gericht prüfte den Fall in Anwesenheit von Zeugen, deren Aussage das Hauptbeweismittel war und unter Eid abgegeben wurde. Die Anzahl der Zeugen laut Gesetz kann je nach Fallkategorie unterschiedlich sein (von 3 bis 12 Personen). Wenn es nicht möglich war, die Wahrheit mit Hilfe von Zeugen herauszufinden, griffen sie auf Torturen zurück, bei denen die Hand des Angeklagten in einen Topf mit kochendem Wasser getaucht wurde. Das Subjekt musste seine Hand dort hinlegen und halten, bis eine bestimmte sakramentale Formel ausgesprochen wurde. Die verbrannte Hand wurde gefesselt und nach einiger Zeit erneut vor Gericht untersucht. Wenn die Wunde an der Hand bis dahin verheilt war, wurde das Subjekt für unschuldig erklärt, wenn nicht, wurde es bestraft. Allerdings konnte dieses Verfahren ausbezahlt werden, aber nur mit Zustimmung des Opfers (Titel 53).
Somit bot die salische Wahrheit und dabei einige Vorteile für die Reichen.
Die Urteile des Amtsgerichts wurden von den Grafen und ihren Gehilfen vollstreckt.
Ein klassisches Beispiel für eine frühe feudale Gesellschaft im von den Germanen eroberten Gebiet des Weströmischen Reiches war die Gesellschaft der Franken, in der der Zerfall des primitiven Gemeinwesens durch den Einfluss der römischen Ordnung beschleunigt wurde.
1. Fränkischer Staat unter den Merowingern
Herkunft der Franken. Gründung des fränkischen Reiches
In historischen Denkmälern tauchte der Name der Franken ab dem 3. Jahrhundert auf, und römische Schriftsteller nannten viele germanische Stämme Franken, die verschiedene Namen trugen. Anscheinend stellten die Franken einen neuen, sehr umfangreichen Stammesverband dar, der eine Reihe von germanischen Stämmen in seiner Zusammensetzung umfasste, die sich während der Völkerwanderungen zusammenschlossen oder vermischten. Die Franken teilten sich in zwei große Zweige auf - die Küsten- oder Salic-Franken (vom lateinischen Wort "salum", was Meer bedeutet), die an der Mündung des Rheins lebten, und die Küsten- oder Ripuarian-Franken (vom lateinischen Wort "ripa", was Küste bedeutet), die südlich an den Ufern von Rhein und Maas lebten. Immer wieder überquerten die Franken den Rhein, überfielen römische Besitzungen in Gallien oder siedelten sich dort als Verbündete Roms an.
Im 5. Jahrhundert Die Franken eroberten einen bedeutenden Teil des Territoriums des Römischen Reiches, nämlich Nordostgallien. An der Spitze der fränkischen Besitzungen standen die Anführer der ehemaligen Stämme. Von den Anführern der Franken ist Merovei bekannt, unter dem die Franken in den katalanischen Feldern gegen Attila kämpften (451) und in dessen Namen der Name des merowingischen Königshauses entstand. Der Sohn und Nachfolger von Merovei war der Anführer Childeric, dessen Grab in der Nähe von Tournai gefunden wurde. Der Sohn und Erbe von Childeric war der prominenteste Vertreter der merowingischen Familie - König Clovis (481-511).
Als König der salischen Franken unternahm Chlodwig zusammen mit anderen Führern, die wie er handelten, im Interesse des fränkischen Adels die Eroberung großer Gebiete Galliens. 486 eroberten die Franken die Region Soissons (den letzten römischen Besitz in Gallien) und später das Gebiet zwischen Seine und Loire. Am Ende des 5. Jahrhunderts Die Franken fügten dem germanischen Stamm der Alemannen (Alamanen) eine schwere Niederlage zu und zwangen sie teilweise aus Gallien zurück über den Rhein.
496 wurde Clovis getauft, nachdem er zusammen mit 3.000 seiner Krieger das Christentum angenommen hatte. Die Taufe war ein kluger politischer Schachzug von Clovis. Er wurde nach dem Ritus der westlichen (römischen) Kirche getauft. Die aus dem Schwarzmeergebiet zuwandernden germanischen Stämme - die Ostgoten und Westgoten sowie die Vandalen und Burgunder - waren aus Sicht der römischen Kirche Ketzer, da sie Arianer waren, die einige ihrer Dogmen leugneten.
Zu Beginn des VI Jahrhunderts. Fränkische Trupps stellten sich den Westgoten entgegen, denen ganz Südgallien gehörte. Gleichzeitig wirkten sich die großen Wohltaten, die aus der Taufe von Clovis flossen, aus. Der gesamte Klerus der westlichen christlichen Kirche, der jenseits der Loire lebte, stellte sich auf seine Seite, und viele Städte und befestigte Punkte, die als Sitz dieses Klerus dienten, öffneten den Franken sofort die Tore. In der entscheidenden Schlacht von Poitiers (507) errangen die Franken einen vollständigen Sieg über die Westgoten, deren Vorherrschaft sich fortan nur noch auf die Grenzen Spaniens beschränkte.
So entstand durch die Eroberungen ein großer fränkischer Staat, der fast das gesamte ehemalige römische Gallien umfasste. Unter den Söhnen von Chlodwig wurde Burgund dem fränkischen Königreich einverleibt.
Die Gründe für die schnellen Erfolge der noch sehr stark gemeinschaftsverbundenen Franken lagen darin, dass sie sich in kompakten Massen im Nordosten Galliens ansiedelten, ohne sich in der lokalen Bevölkerung aufzulösen (wie etwa die Westgoten). Die Franken zogen tief in Gallien ein, brachen die Verbindungen zu ihrer früheren Heimat nicht ab und zogen dort ständig neue Kräfte für die Eroberung an. Gleichzeitig begnügten sich die Könige und der fränkische Adel oft mit den weiten Ländern des ehemaligen Reichsfiscus, ohne in Konflikte mit der lokalen gallo-römischen Bevölkerung zu geraten. Schließlich unterstützte der Klerus Clovis während der Eroberungen ständig.
„Salic Wahrheit“ und ihre Bedeutung
Die wichtigsten Informationen über das Gesellschaftssystem der Franken liefert die sogenannte „Salic Truth“ – eine Aufzeichnung der alten Gerichtsbräuche der Franken, die vermutlich unter Chlodwig entstanden ist. Dieses Gesetzbuch untersucht detailliert verschiedene Fälle aus dem Leben der Franken und listet Bußgelder für die unterschiedlichsten Straftaten auf, die vom Diebstahl eines Huhns bis zu einem Lösegeld für die Tötung eines Menschen reichen. Daher ist es nach der "Salic Truth" möglich, das wahre Bild des Lebens der Salic Franks wiederherzustellen. Auch die ripuarischen Franken, die Burgunder, die Angelsachsen und andere germanische Stämme hatten solche Rechtsordnungen - die Prawda.
Die Zeit für die Aufzeichnung und Bearbeitung dieses gewöhnlichen (vom Wort Brauch) Volksrechts ist das 6. bis 9. Jahrhundert, d Staat entstand. Um das Privateigentum zu schützen, war es notwendig, die gerichtlichen Strafen festzusetzen, die gegen Personen verhängt werden sollten, die das Recht auf dieses Eigentum verletzten. Eine feste Fixierung erforderte auch solche neuen sozialen Beziehungen, die aus Stammesbeziehungen entstanden, wie territoriale oder benachbarte, kommunale Bauernbindungen, die Fähigkeit einer Person, auf die Verwandtschaft zu verzichten, die Unterordnung freier Franken unter den König und seine Beamten usw.
Die salische Wahrheit wurde in Titel (Kapitel) unterteilt und jeder Titel wiederum in Absätze. Eine große Anzahl von Titeln widmete sich der Festsetzung der Strafen, die für alle Arten von Diebstählen zu zahlen waren. Aber die „Salic Truth“ berücksichtigte die unterschiedlichsten Aspekte des fränkischen Lebens, so waren auch solche Titel darin: „Von Morden oder wenn jemand die Frau eines anderen stiehlt“, „Von wenn jemand eine freie Frau an sich reißt“. an der Hand, am Pinsel oder am Finger“, „Von Vierbeinern, wenn sie einen Menschen töten“, „Von einem Diener in der Hexerei“, usw.
Im Titel „Über Beleidigung mit Worten“ wurden Strafen für Beleidigungen festgelegt. Der Titel "Über Verstümmelung" lautete: "Wenn jemand einem anderen das Auge ausreißt, erhält er 62 1/2 solidi"; „Wenn er sich die Nase abreißt, erhält er eine Zahlung ... 45 solidi“; „Wenn das Ohr abgerissen wird, werden 15 Solidi vergeben“ usw. (Der Solidus war eine römische Geldeinheit. Nach dem 6. Jahrhundert glaubte man, dass 3 Solidi den Kosten für einen „gesunden, sehenden und gehörnten“ entsprachen " Kuh.)
Von besonderem Interesse an Salic Pravda sind natürlich Titel, anhand derer man das Wirtschaftssystem der Franken und die zwischen ihnen bestehenden sozialen und politischen Beziehungen beurteilen kann.
Die Wirtschaft der Franken nach der „salischen Wahrheit“
Laut der Salic Pravda befand sich die Wirtschaft der Franken auf einem viel höheren Niveau als die von Tacitus beschriebene Wirtschaft der Deutschen. Die Produktivkräfte der Gesellschaft hatten sich zu dieser Zeit erheblich entwickelt und gewachsen. Die Tierhaltung spielte dabei zweifellos eine wichtige Rolle. Die Salic Pravda legte in ungewöhnlichen Einzelheiten fest, welche Strafe für den Diebstahl eines Schweins, für ein einjähriges Ferkel, für ein Schwein, das zusammen mit einem Ferkel gestohlen wurde, für ein getrenntes Spanferkel, für ein aus einem Schloss gestohlenes Schwein zu zahlen war Scheune usw. Wahrheit“ betrachtete alle Fälle von Diebstahl großer gehörnter Tiere, Diebstahl von Schafen, Diebstahl von Ziegen, Fälle von Pferdediebstahl.
Für gestohlenes Geflügel (Hühner, Hähne, Gänse) wurden Geldbußen festgesetzt, was auf die Entwicklung der Geflügelzucht hinwies. Es gab Titel, die über den Diebstahl von Bienen und Bienenstöcken aus dem Bienenhaus, über Beschädigung und Diebstahl von Obstbäumen aus dem Garten ( Schon die Franken wussten, wie man Obstbäume durch Stecklinge veredelt.), über den Diebstahl von Trauben aus einem Weinberg. Es wurden Strafen für den Diebstahl verschiedenster Angelgeräte, Boote, Jagdhunde, Vögel und für die Jagd gezähmter Tiere etc. festgesetzt. Das bedeutet, dass die fränkische Wirtschaft eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen hatte - Viehzucht, Imkerei, Gartenbau und Weinbau . Gleichzeitig haben Wirtschaftszweige wie Jagd und Fischerei nicht an Bedeutung verloren. Vieh, Geflügel, Bienen, Gartenbäume, Weinberge, sowie Boote, Fischerboote usw. waren bereits im Privatbesitz der Franken.
Die Landwirtschaft spielte laut Salic Pravda die Hauptrolle in der Wirtschaft der Franken. Neben Getreide säten die Franken Flachs und legten Gemüsegärten an, pflanzten Bohnen, Erbsen, Linsen und Rüben.
Gepflügt wurde damals auf Stieren, die Franken waren sowohl mit dem Pflug als auch mit der Egge gut vertraut. Schäden an der Ernte und Schäden am gepflügten Feld wurden mit Bußgeldern geahndet. Die anfallende Ernte von den Feldern wurde von den Franken auf Karren abtransportiert, vor die Pferde gespannt waren. Die Getreideernten waren ziemlich reichlich, denn das Getreide war bereits in Scheunen oder Bohrtürmen gelagert, und es gab Nebengebäude am Haus jedes freien fränkischen Bauern. Die Franken nutzten Wassermühlen ausgiebig.
Die Markgemeinde der Franken
"Salic Truth" gibt auch eine Antwort auf die wichtigste Frage zur Bestimmung der Gesellschaftsordnung der Franken, denen das Land - das wichtigste Produktionsmittel der damaligen Zeit - gehörte. Das Gutsland befand sich laut der Salic Pravda bereits im individuellen Besitz jedes Frankens. Darauf deuten die hohen Geldbußen aller Personen hin, die auf die eine oder andere Weise Zäune verwüstet und zerstört haben oder mit dem Ziel eingedrungen sind, fremde Höfe zu stehlen. Im Gegenteil, die Wiesen und Wälder blieben weiterhin kollektives Eigentum und Nutzung durch die gesamte bäuerliche Gemeinschaft. Die Herden, die den Bauern der Nachbardörfer gehörten, weideten noch auf den gemeinsamen Wiesen, und jeder Bauer konnte jeden Baum aus dem Wald nehmen, auch einen gefällten, wenn er die Spur hatte, dass er vor mehr als einem Jahr gefällt worden war.
Ackerland war noch kein Privateigentum, da die gesamte Bauerngemeinschaft als Ganzes die höchsten Rechte an diesem Land behielt. Aber das Ackerland wurde nicht mehr umverteilt und befand sich in der erblichen Nutzung jedes einzelnen Bauern. Die obersten Rechte der Gemeinde am Ackerland drückten sich darin aus, dass kein Gemeindemitglied das Recht hatte, sein Land zu verkaufen, und wenn ein Bauer starb, ohne seine Söhne (die das von ihm bebaute Stück Land erbten, zu hinterlassen zu seinen Lebzeiten), wurde dieses Land der Gemeinde zurückgegeben und fiel in die Hände der "Nachbarn", d.h. aller ihrer Mitglieder. Aber jeder Gemeindebauer hatte für die Zeit des Pflügens, Säens und Reifens des Getreides sein eigenes Stück Land, er umzäunte es und vererbte es seinen Söhnen. Land konnte nicht von einer Frau vererbt werden.
Die damalige Gemeinschaft war nicht mehr die Stammesgemeinschaft, die Caesar und Tacitus einmal beschrieben hatten. Neue Produktivkräfte forderten neue Produktionsverhältnisse. Die Stammesgemeinde wurde durch die Nachbargemeinde ersetzt, die unter Verwendung des altgermanischen Namens Engels die Marke nannte. Ein Dorf, das bestimmte Ländereien besaß, bestand nicht mehr aus Verwandten. Ein erheblicher Teil der Bewohner dieses Dorfes blieb weiterhin mit Stammesbeziehungen verbunden, aber gleichzeitig lebten bereits Fremde im Dorf, Einwanderer aus anderen Orten, Menschen, die sich in diesem Dorf niedergelassen haben, entweder durch Vereinbarung mit anderen Gemeindemitgliedern, oder in Übereinstimmung mit der königlichen Charta.
Im Titel „Über Siedler“ stellte „Salicheskaya Pravda“ fest, dass sich jeder in einem fremden Dorf niederlassen könne, wenn keiner seiner Bewohner dagegen protestiere. Aber wenn es mindestens eine Person gab, die dagegen war, konnte sich der Siedler nicht in einem solchen Dorf niederlassen. Darüber hinaus wurde das Verfahren zur Räumung und Bestrafung (in Form einer Geldstrafe) eines solchen Migranten erwogen, den die Gemeinde nicht als seine Mitglieder, „Nachbarn“, akzeptieren wollte und der ohne Erlaubnis in das Dorf zog. Gleichzeitig erklärte die „Salicheskaya Pravda“, dass „wenn dem Umgesiedelten innerhalb von 12 Monaten kein Protest vorgelegt wird, muss er wie andere Nachbarn unverletzlich bleiben.“
Der Siedler blieb unverletzlich, auch wenn er einen entsprechenden Brief des Königs hatte. Im Gegenteil: Wer es wagte, gegen eine solche Charta zu protestieren, musste eine hohe Strafe von 200 Solidi zahlen. Einerseits deutete dies auf die allmähliche Umwandlung der Gemeinschaft von einer Stammes- zu einer benachbarten oder territorialen Gemeinschaft hin. Andererseits zeugte dies von der Stärkung der königlichen Macht und der Zuweisung einer Sonderschicht, die gewöhnliche, freie Gemeindemitglieder überragte und gewisse Privilegien genoss.
Auflösung der Stammesbeziehungen. Die Entstehung von Eigentum und sozialer Ungleichheit in der fränkischen Gesellschaft
Das bedeutet natürlich nicht, dass Stammesbeziehungen in der Gesellschaft der Franken keine Rolle mehr spielten. Stammesbindungen, Stammesreste waren noch sehr stark, wurden aber mehr und mehr durch neue soziale Bindungen ersetzt. Die Franken hatten noch immer solche Bräuche, wie Geld für die Ermordung einer Person an ihre Verwandten zu zahlen, Eigentum (außer Land) auf der mütterlichen Seite zu erben, einen Teil des Lösegelds (Wergeld) für die Ermordung für seinen insolventen Verwandten zu zahlen usw.
Gleichzeitig zeichnete "Salicheskaya Pravda" sowohl die Möglichkeit auf, Eigentum an einen Nicht-Verwandten zu übertragen, als auch die Möglichkeit des freiwilligen Austritts aus der Stammesunion, dem sogenannten "Verzicht auf die Verwandtschaft". Titel 60 ging ausführlich auf das damit verbundene Verfahren ein, das offenbar bereits in der fränkischen Gesellschaft üblich geworden war. Derjenige, der auf die Verwandtschaft verzichten wollte, musste zu einer Versammlung der vom Volk gewählten Richter erscheinen, dort drei Äste über seinem Kopf brechen, eine Elle messen, sie in vier Richtungen zerstreuen und sagen, dass er auf das Erbe verzichtet und von allen Konten mit seinem Verwandten. Und wenn später einer seiner Verwandten getötet wurde oder starb, hätte derjenige, der auf die Verwandtschaft verzichtete, weder an der Erbschaft noch am Empfang des Wergelds beteiligt sein müssen, und das Erbe dieser Person selbst ging an die Staatskasse.
Wer hat davon profitiert, den Clan zu verlassen? Natürlich die reichsten und mächtigsten Menschen, die unter der direkten Schirmherrschaft des Königs standen, die ihren weniger wohlhabenden Verwandten nicht helfen wollten und nicht daran interessiert waren, ihr kleines Erbe zu erhalten. Solche Menschen gab es bereits in der fränkischen Gesellschaft.
Die Vermögensungleichheit unter den Gemeindemitgliedern wird in einem der wichtigsten Titel zur Charakterisierung des Gesellschaftssystems der Franken beschrieben, dem Titel „Salic Truth“ mit dem Titel „Über eine Handvoll Land“. Wenn jemand das Leben einer Person nimmt, sagt dieser Titel, und nachdem Sie das gesamte Eigentum gegeben haben, können Sie nicht zahlen, was nach dem Gesetz fällig ist, er muss 12 Verwandte vorlegen, die dies weder auf Erden noch unter schwören werden die Erde hat er mehr als das, was ihnen bereits gegeben wurde. Dann muss er sein Haus betreten, eine Handvoll Erde von seinen vier Ecken aufheben, sich auf die Schwelle stellen, mit dem Gesicht ins Haus hinein, und diese Erde mit seiner linken Hand über seiner Schulter auf seinen Vater und seine Brüder werfen.
Wenn der Vater und die Brüder bereits bezahlt haben, dann soll er das gleiche Land auf seine drei nächsten Verwandten von Mutter und Vater werfen. „Dann muss er in [einem] Hemd, ohne Gürtel, ohne Schuhe, mit einem Pflock in der Hand über den Flechtzaun springen, und diese drei [Verwandten mütterlicherseits] müssen die Hälfte dessen bezahlen, was nicht ausreicht, um die Vira zu bezahlen Gesetz folgt. Dasselbe sollten die anderen drei tun, die väterlicherseits verwandt sind. Wenn einer von ihnen zu arm ist, um den auf ihn fallenden Anteil zu bezahlen, muss er seinerseits einem der Wohlhabenderen eine Handvoll Land zuwerfen, damit er alles nach dem Gesetz bezahlt. Die Schichtung der freien Francs in Arm und Reich wird auch durch Titel über Schulden und Methoden ihrer Rückzahlung, über Kredite und ihre Beitreibung durch den Schuldner usw. angezeigt.
Es besteht kein Zweifel, dass die fränkische Gesellschaft zu Beginn des VI Jahrhunderts. bereits in mehrere unterschiedliche Schichten zerfallen. Der Großteil der fränkischen Gesellschaft bestand damals aus freien fränkischen Bauern, die in Nachbargemeinden lebten und unter denen noch zahlreiche Reste des Stammessystems erhalten waren. Die unabhängige und vollwertige Stellung des freien fränkischen Bauern wird durch das hohe Wergeld angezeigt, das im Falle seiner Ermordung für ihn gezahlt wurde. Dieses Wergeld entsprach laut Salic Pravda 200 Solidi und war Lösegeld und keine Strafe, da es auch im Falle eines versehentlichen Mordes gezahlt wurde und wenn eine Person an einem Schlag oder Biss starb jedes Haustiers (im letzteren Fall das Tiergeld, wie es üblicherweise vom Halter des Tieres in der Hälfte gezahlt wird). Also die direkten Erzeuger materieller Güter, also freie fränkische Bauern, zu Beginn des 6. Jahrhunderts. noch mehr Rechte genossen.
Gleichzeitig bildete sich in der fränkischen Gesellschaft eine Schicht neuer Dienstadel, deren besondere Vorzugsstellung durch ein gegenüber einem einfachen Freifranken weitaus höheres Wergeld betont wurde. „Salicheskaya Pravda“ verliert kein Wort über den ehemaligen Stammesadel, was auch auf die bereits vollzogene Auflösung der Stammesbeziehungen hinweist. Ein Teil dieses Stammesadels starb aus, ein Teil wurde von den auferstandenen Königen aus Angst vor Rivalen zerstört, und ein Teil schloss sich den Reihen des Dienstadels an, der die Könige umgab.
Für einen Vertreter des Adels, der in königlichen Diensten stand, wurde ein dreifaches Wergeld gezahlt, also 600 Solidi. So war das Leben eines Grafen - eines königlichen Beamten oder das Leben eines königlichen Kriegers bereits viel teurer als das Leben eines einfachen fränkischen Bauern, was von der tiefen sozialen Schichtung der fränkischen Gesellschaft zeugte. Wergeld, bezahlt für die Ermordung eines Vertreters des Dienstadels, wurde ein zweites Mal verdreifacht (d. h. es erreichte 1.800 Solidi), wenn der Mord zu einem Zeitpunkt begangen wurde, als der Ermordete in königlichen Diensten stand (während eines Feldzugs usw .).
Die dritte Schicht in der Gesellschaft der Franken bildeten die Halbfreien, die sogenannten Litas, sowie die Freigelassenen, also freigelassene ehemalige Sklaven. Für Halbfreie und Freigelassene wurde nur das halbe Wergeld eines einfachen Freifrankens, also 100 Solidi, gezahlt, was ihre unterlegene Stellung in der fränkischen Gesellschaft betonte. Was den Sklaven betrifft, wurde für seinen Mord nicht mehr das Wergeld bezahlt, sondern einfach eine Geldstrafe.
So verschwanden Stammesbindungen in der fränkischen Gesellschaft und wichen neuen sozialen Beziehungen, den Beziehungen der entstehenden feudalen Gesellschaft. Der beginnende Prozess der Feudalisierung der fränkischen Gesellschaft spiegelte sich am deutlichsten in der Opposition der freien fränkischen Bauernschaft gegen den Dienst- und Militäradel wider. Dieser Adel verwandelte sich allmählich in eine Klasse von Großgrundbesitzern - Feudalherren, denn es war der fränkische Adel, der in den Diensten des Königs stand, der bei der Eroberung römischen Territoriums große Landbesitzungen bereits an den Rechten des Privateigentums erhielt. Die Existenz in der fränkischen Gesellschaft (zusammen mit der freien Bauerngemeinschaft) von großen Gütern, die in den Händen des fränkischen und überlebenden gallo-römischen Adels waren, wird durch die Chroniken (Chroniken) dieser Zeit sowie alle diese Titel der Salic Truth, die von den Dienern oder Hofknechten des Herrn sprechen – Sklaven (Weingärtner, Schmiede, Zimmerleute, Pferdeknechte, Schweinehirten und sogar Goldschmiede), die der riesigen Wirtschaft des Herrn dienten.
Die politische Struktur der fränkischen Gesellschaft. Aufstieg des Königshauses
Tiefgreifende Veränderungen im Bereich der sozioökonomischen Beziehungen der fränkischen Gesellschaft führten zu Veränderungen in ihrem politischen System. Am Beispiel von Chlodwig kann man gut nachvollziehen, wie sich die einstige Macht des Heerführers des Stammes bereits Ende des 5. Jahrhunderts gewendet hat. ins erbliche Königtum. Von einem Chronisten (Chronisten), Gregor von Tours (6. Jahrhundert), ist eine wunderbare Geschichte überliefert, die diese Transformation in einer visuellen Form charakterisierte.
Einmal, sagt Gregor von Tours, hätten die Franken sogar während des Kampfes um die Stadt Soissons in einer der christlichen Kirchen reiche Beute gemacht. Unter der erbeuteten Beute befand sich auch eine wertvolle Schale von erstaunlicher Größe und Schönheit. Der Bischof der Kirche von Reims bat Clovis, diesen Kelch, der als heilig galt, der Kirche zurückzugeben. Chlodwig, der mit der christlichen Kirche in Frieden leben wollte, stimmte zu, fügte aber hinzu, dass es in Soissons immer noch eine Aufteilung der Beute zwischen ihnen durch seine Soldaten geben sollte, und dass er, wenn er bei der Aufteilung der Beute einen Becher erhielt, er würde es dem Bischof geben.
Dann erzählt die Chronistin, dass die Krieger auf die an sie gerichtete Bitte des Königs, ihm eine Schale zu geben, die er in ihre Kirche bringen soll, antworteten: „Tu, was immer du willst, denn niemand kann sich deiner Macht widersetzen.“ Die Geschichte des Chronisten zeugt somit von der stark gewachsenen Autorität der königlichen Macht. Aber unter den Kriegern lebten noch Erinnerungen an die Zeit, als der König nur wenig höher stand als seine Krieger, er verpflichtet war, die Beute mit ihnen durch das Los zu teilen, und sich am Ende des Feldzugs oft von einem Militärführer abwandte zu einem ordentlichen Vertreter des Stammesadels. Deshalb stimmte einer der Krieger, wie es später in der Chronik heißt, nicht mit den anderen Kriegern überein, erhob die Axt und zerschnitt den Kelch und sagte: „Du wirst nichts davon bekommen, außer was fällig ist durch Los.“
Der König schwieg diesmal, nahm den verdorbenen Kelch und überreichte ihn dem Boten des Bischofs. Wie jedoch aus der Geschichte von Gregor von Tours hervorgeht, wurden Clovis' „Sanftmut und Geduld“ vorgetäuscht. Nach einem Jahr befahl er seiner gesamten Armee, die Waffen zusammenzubauen und zu inspizieren. Clovis näherte sich während der Inspektion dem widerspenstigen Krieger und erklärte, dass die Waffe dieses Kriegers von ihm in Unordnung gehalten wurde, und nachdem er die Axt aus dem Krieger gezogen hatte, warf er sie auf den Boden und hackte ihm dann den Kopf ab. „Also“, sagte er, „das hast du mit dem Becher in Soissons gemacht“, und als er starb, befahl er den anderen, nach Hause zu gehen, „und erweckte große Angst in sich selbst.“ Aus einem Zusammenstoß mit einem Krieger, der versuchte, die frühere Ordnung der Aufteilung der Beute zwischen den Mitgliedern des Trupps und seinem Anführer zu verteidigen, ging Clovis als Sieger hervor und bekräftigte das Prinzip der exklusiven Position des Königs in Bezug auf die Mitglieder des Trupps das hat ihm gedient.
Am Ende seiner Regierungszeit hatte Clovis, ein gerissener, grausamer und verräterischer Mann, keine Rivalen mehr gegenüber anderen Vertretern des Adels. Er strebte mit allen Mitteln nach Alleinherrschaft. Nachdem Clovis Gallien erobert und riesigen Landreichtum in seine Hände bekommen hatte, zerstörte er die anderen Anführer des Stammes, die sich ihm in den Weg stellten.
Clovis zerstörte die Anführer sowie viele seiner edlen Verwandten aus Angst, dass sie ihm seine königliche Macht nicht nehmen würden, und dehnte sie auf ganz Gallien aus. Und dann, nachdem er seine engsten Mitarbeiter versammelt hatte, sagte er zu ihnen: "Wehe mir, denn ich bin wie ein Wanderer unter Fremden geblieben und habe keine Verwandten, die mir helfen könnten, wenn ein Unglück passiert." „Aber er sagte dies“, schrieb der Chronist, „nicht, weil er ihren Tod betrauerte, sondern aus List, in der Hoffnung, dass er nicht versehentlich einen weiteren seiner Verwandten finden könnte, um ihm das Leben zu nehmen.“ Auf diese Weise wurde Chlodwig alleiniger König der Franken.
Die salische Wahrheit bezeugt die zunehmende Bedeutung königlicher Macht. Nach den darin verfügbaren Daten war der königliche Hof die höchste Instanz. In den Regionen regierte der König durch seine Beamten - Grafen und ihre Gehilfen. Die Volksversammlung der Stämme existierte nicht mehr. Es wurde durch militärische Überprüfungen ersetzt, die vom König einberufen und durchgeführt wurden. Das sind die sogenannten „Märzfelder“. In den Dörfern und Hunderten (Zusammenschluss mehrerer Dörfer) blieb zwar noch das Volksgericht (Mallus) erhalten, aber allmählich wurde dieses Gericht vom Grafen geleitet. Alle "Gegenstände, die dem König gehörten", waren laut "Salicheskaya Pravda" mit einer dreifachen Geldstrafe geschützt. Auch Vertreter der Kirche waren in einer privilegierten Position. Das Leben eines Priesters wurde von einem dreifachen Wergeld (600 Solidi) bewacht, und wenn jemand einem Bischof das Leben nahm, musste er ein noch größeres Wergeld zahlen - 900 Solidi. Raub und Brandstiftung von Kirchen und Kapellen wurden mit hohen Geldstrafen geahndet. Das Anwachsen der Staatsmacht erforderte ihre Weihe mit Hilfe der Kirche, so dass die fränkischen Könige die Kirchenprivilegien vermehrten und schützten.
Das politische System der Franken war also durch das Wachstum und die Stärkung der königlichen Macht gekennzeichnet. Dies wurde durch die Krieger des Königs, seine Beamten, sein Gefolge und Vertreter der Kirche, dh der aufstrebenden Schicht von Großgrundbesitzern - Feudalherren, ermöglicht, die königliche Macht brauchten, um ihre neu entstandenen Besitztümer zu schützen und zu erweitern. Das Wachstum der königlichen Macht wurde auch durch jene wohlhabenden und wohlhabenden Bauern erleichtert, die sich von den freien Gemeindemitgliedern trennten, aus denen später eine Schicht kleiner und mittlerer Feudalherren wuchs.
Fränkische Gesellschaft im VI-VII Jahrhundert.
Eine Analyse der Salic Pravda zeigt, dass sowohl die römische als auch die fränkische Gesellschaftsordnung eine wichtige Rolle in der Entwicklung der fränkischen Gesellschaft nach der Eroberung des gallischen Territoriums durch die Franken spielten. Einerseits sorgten die Franken für eine schnellere Vernichtung von Sklavenhalterresten. „Die alte Sklaverei ist verschwunden, ruinierte, verarmte freie Menschen sind verschwunden“, schrieb Engels, „jene, die die Arbeit als Sklavenbeschäftigung verachteten. Zwischen der römischen Kolonne und dem neuen Leibeigenen stand ein freier fränkischer Bauer" ( F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, S. 160-161.). Andererseits ist nicht nur die endgültige Auflösung der Stammesbeziehungen unter den Franken, sondern auch das rasche Verschwinden ihres gemeinsamen Besitzes an Ackerland maßgeblich dem Einfluss der römischen Gesellschaftsordnung zuzuschreiben. Bis zum Ende des VI Jahrhunderts. es ist bereits aus einem erblichen Besitz in ein vollständiges, frei veräußerbares Grundeigentum (allod) des fränkischen Bauern übergegangen.
Schon die Umsiedlung der Franken auf römisches Territorium zerriss und konnte nicht umhin, Bündnisse zu brechen, die auf Blutsverwandtschaft beruhten. Ständige Bewegungen vermischten Stämme und Clans untereinander, es entstanden Vereinigungen kleiner ländlicher Gemeinschaften, die weiterhin gemeinsames Land besaßen. Dieser gemeinschaftliche, kollektive Besitz an Ackerland, Wald und Wiesen war jedoch nicht die einzige Eigentumsform der Franken. Daneben gab es in der Gemeinde selbst einen fränkischen Eigenbesitz, der lange vor der Umsiedlung für ein eigenes Grundstück, Vieh, Waffen, ein Haus und Hausrat entstanden war.
Auf dem von den Franken eroberten Gebiet bestand der aus der Antike erhaltene private Grundbesitz der Gallo-Römer weiter. Im Zuge der Eroberung des römischen Territoriums entstand und etablierte sich ein großflächiger Privatbesitz am Land des fränkischen Königs, seiner Krieger, Diener und Gefährten. Die Koexistenz verschiedener Eigentumsarten hielt nicht lange an, und die gemeinschaftliche Eigentumsform von Ackerland, die einem niedrigeren Niveau der Produktivkräfte entsprach, wich der Allod.
Das Edikt des Königs Chilperic (zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts), das in Abänderung der salischen Wahrheit das Erbe von Land nicht nur für die Söhne, sondern auch für die Töchter des Verstorbenen festlegte, und auf keinen Fall für seine Nachbarn, zeigt, dass dieser Prozess sehr schnell vonstatten ging.
Das Erscheinen einer Landallod unter den fränkischen Bauern war von größter Bedeutung. Die Umwandlung des Gemeinschaftseigentums an Ackerland in Privateigentum, d. h. die Umwandlung dieses Landes in eine Ware, bedeutete, dass die Entstehung und Entwicklung von Großgrundbesitz nicht nur mit der Eroberung neuer Gebiete und der Eroberung freien Landes verbunden war , aber auch mit dem Verlust des Eigentumsrechts des Bauern an bebautem Land wurde es zu einer Frage der Zeit.
Als Ergebnis der Interaktion sozioökonomischer Prozesse, die in der altdeutschen Gesellschaft und im späten Römischen Reich stattfanden, trat die fränkische Gesellschaft in die Zeit des frühen Feudalismus ein.
Unmittelbar nach dem Tod Chlodwigs wurde der frühfeudale fränkische Staat in die Erbschaften seiner vier Söhne zersplittert, dann für kurze Zeit vereinigt und dann wieder in Teile zersplittert. Erst dem Urenkel Clovis Chlothar II. und dem Ururenkel Dagobert I. gelang zu Beginn des 7. Jahrhunderts eine längere Vereinigung des Staatsgebietes in einer Hand. Aber die Macht des merowingischen Königshauses in der fränkischen Gesellschaft basierte darauf, dass es im 6. und vor allem im 7. Jahrhundert durch die Eroberungen Chlodwigs und seiner Nachfolger einen großen Grundbesitz geschaffen hatte. kontinuierlich geschmolzen. Die Merowinger überreichten mit großzügiger Hand Auszeichnungen an ihre Krieger, ihre Dienstleute und die Kirche. Durch die fortwährende Landvergabe der Merowinger wurde die reale Basis ihrer Macht stark reduziert. Vertreter anderer, größerer und reicherer Grundbesitzerfamilien erstarkten in der Gesellschaft.
Dabei wurden die Könige aus dem merowingischen Geschlecht in den Hintergrund gedrängt und erhielten den Spitznamen „faul“, und die eigentliche Macht im Königreich lag in den Händen einzelner Personen aus dem grundbesitzenden Adel, den sogenannten Major-Häusern ( Major-Häuser wurden ursprünglich als die obersten Herrscher des königlichen Hofes bezeichnet, die für die Haushaltung und die Bediensteten des Palastes verantwortlich waren).
Im Laufe der Zeit konzentrierten die Bürgermeisterämter die gesamte militärische und administrative Macht des Königreichs in ihren Händen und wurden de facto zu seinen Herrschern. „Der König“, schrieb der Chronist, „musste sich mit nur einem Titel begnügen und war, mit langen Haaren und offenem Bart auf dem Thron sitzend, nur ein Anschein eines Souveräns, hörte den Botschaftern zu, die von überall kamen und gaben sie Abschied nehmend, wie für sich selbst, Antworten, vorher auswendig gelernt und ihm diktiert ... Die Verwaltung des Staates und alles, was in inneren oder äußeren Angelegenheiten zu tun oder zu regeln war, all dies lag in der Obhut des Bürgermeisterhaus. Ende des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts. stärkten besonders die Bürgermeisterämter, die aus dem reichen Adelsgeschlecht der Karolinger stammten, die den Grundstein für eine neue Dynastie auf dem Thron der fränkischen Könige legten - die karolingische Dynastie (VIII-X Jahrhundert).
2. Reich Karls des Großen
Entstehung des Karolingischen Reiches.
Im Jahr 715. Bürgermeister des fränkischen Staates wurde Karl Martell, der bis 741 regierte.Karl Martell machte eine Reihe von Feldzügen über den Rhein nach Thüringen und Alemannien, das unter den „faulen“ Königen der Merowinger wieder unabhängig wurde, und unterwarf beide Gebiete seine Macht. Er annektierte Friesland oder Friesland (das Land des friesischen Stammes) erneut dem fränkischen Staat und zwang die Sachsen und Bayern, ihm erneut Tribut zu zollen.
Zu Beginn des 8. Jahrhunderts die Franken mussten sich den Arabern stellen, die von der Iberischen Halbinsel in Südgallien eindrangen, um es dem fränkischen Staat zu entreißen. Charles Martell sammelte hastig militärische Abteilungen, um die Araber abzuwehren, während die arabische leichte Kavallerie sehr schnell vorrückte (entlang der alten Römerstraße, die von Süden nach Poitiers, Tours, Orleans und Paris führte). Die Franken trafen bei Poitiers (732) auf die Araber und errangen einen entscheidenden Sieg, der sie zur Umkehr zwang.

Nach dem Tod von Charles Martell wurde sein Sohn Pepin der Kleine, der wegen seiner geringen Statur so genannt wurde, Bürgermeister. Unter Pepin wurden die Araber endgültig aus Gallien vertrieben. In den Regionen jenseits des Rheins betrieb Pepin intensiv die Christianisierung der germanischen Stämme und versuchte, mit kirchlichen Predigten die Macht der Waffen zu stärken. 751 sperrte Pippin der Kleine den letzten Merowinger in ein Kloster und wurde König der Franken. Zuvor schickte Pepin eine Botschaft an den Papst mit der Frage, ist es gut, dass der fränkische Staat von Königen regiert wird, die keine wirkliche königliche Macht haben? Darauf antwortete der Papst: „Es ist besser, den König zu nennen, der Macht hat, als den, der lebt, ohne königliche Macht zu haben.“ Danach krönte der Papst Pippin den Kleinen. Für diesen Dienst half Pepin dem Papst, den Staat der Langobarden zu bekämpfen, und übergab sie nach der Eroberung der Region Ravenna, die sie zuvor in Italien erobert hatten, dem Papst. Die Übertragung der Region Ravenna markierte den Beginn der weltlichen Macht des Papsttums.
768 starb Pippin der Kleine. Die Macht ging auf seinen Sohn Karl den Großen (768 - 814) über, dem es durch mehrere Kriege gelang, ein sehr großes Reich aufzubauen. Diese Kriege führte Karl der Große, wie seine Vorgänger, im Interesse von Großgrundbesitzern – Feudalherren, von denen er selbst einer der klügsten Vertreter war, und waren auf den Wunsch fränkischer Großgrundbesitzer zurückzuführen, neue Ländereien zu erobern und die Bauern, die noch ihre Freiheit behielten, gewaltsam zu versklaven.
Insgesamt wurden unter Charles mehr als 50 Feldzüge durchgeführt, die Hälfte davon führte er selbst. Charles war sehr aktiv in seinen militärischen und administrativen Unternehmungen, geschickt auf dem Gebiet der Diplomatie und äußerst grausam gegenüber den fränkischen Massen und der Bevölkerung der von ihm eroberten Länder.
Der erste von Karl dem Großen angezettelte Krieg war der Krieg mit dem deutschen Stamm der Sachsen (772), der das gesamte Gebiet Niedergermaniens (vom Rhein bis zur Elbe) besetzte. Die Sachsen und diese Zeit befanden sich noch auf der letzten Stufe des primitiven Gemeinschaftssystems. In einem langen und hartnäckigen Kampf mit den fränkischen Feudalherren, die ihre Ländereien eroberten und ihnen die Versklavung brachten, leisteten die Sachsen entschiedenen Widerstand und bewiesen großen Mut. 33 Jahre lang kämpfte Karl der Große für die Unterwerfung der freien sächsischen Bauern. Mit Feuer und Schwert pflanzte er das Christentum unter den Sachsen ein und glaubte, dass die Eroberung durch die Christianisierung der Sachsen, die an vorchristlichen Kulten festhielten, gefestigt werden sollte. Vollendet wurde die Unterwerfung der Sachsen erst 804, als sich der Adel der Sachsen im Kampf gegen das eigene Volk auf die Seite der fränkischen Feudalherren stellte.
Gleichzeitig mit den Sachsenkriegen unternahm Karl auf Wunsch des Papstes und auch in eigenem Interesse, da er eine Erstarkung der Langobarden befürchtete, zwei Feldzüge gegen sie. Nachdem Karl der Große die Langobarden besiegt hatte, die in Norditalien in der Poebene lebten, setzte er sich die eiserne Krone der langobardischen Könige auf und wurde König der Franken und Langobarden (774). Karl übergab die eroberten lombardischen Gebiete jedoch nicht dem Papst.
Karl unternahm einen Feldzug gegen den deutschen Stamm der Bayern und beraubte sie ihrer Unabhängigkeit. Feldzüge unter Karl dem Großen richteten sich auch gegen den Nomadenstamm der Awaren, die damals in Pannonien lebten. Nachdem Karl ihre Hauptfestung (791) zerstört hatte, beschlagnahmte er riesige Beute im Palast des Avar-Kagan (Khan). Nachdem Karl die Awaren besiegt hatte, schuf er eine besondere Grenzregion - die Marke Pannonskuvd.
Zu Grenzkämpfen unter Karl dem Großen kam es auch mit den Stämmen der Westslawen, deren Siedlungen an den Ostgrenzen seines Reiches lagen. Aber der Widerstand der slawischen Stämme erlaubte Karl dem Großen nicht, ihre Gebiete in das Reich einzubeziehen. Er musste sogar Bündnisse mit dem slawischen Adel gegen gemeinsame Feinde eingehen (z. B. mit Aufmunterung gegen die Sachsen oder mit den Slowenen aus Horutanien gegen die Nomaden der Awaren) und beschränkte sich darauf, an der slawischen Grenze Festungen zu bauen und Tribute zu sammeln von der in der Nähe lebenden slawischen Bevölkerung.
Karl der Große unternahm mehrere Feldzüge jenseits der Pyrenäen (778-812). Auf dem eroberten Gebiet jenseits der Pyrenäen entstand eine Grenzregion – die spanische Marke.
So entstand als Ergebnis langer Angriffskriege der Bürgermeister und Könige der karolingischen Familie ein riesiger Staat, der an Größe nur geringfügig hinter dem ehemaligen Weströmischen Reich zurückblieb.
Und dann beschloss Charles, sich selbst zum Kaiser zu erklären. Im Jahr 800 krönte ihn Papst Leo III., der daran interessiert war, den Einfluss der römischen Kirche in allen von den Franken eroberten Ländern zu verbreiten, und daher in direktem Bündnis mit Karl dem Großen, mit der Kaiserkrone.
Das aufstrebende Imperium genoss großen Einfluss auf die internationalen Angelegenheiten seiner Zeit. Die Könige von Galizien und Asturien erkannten die höchste Macht des Kaisers an. Mit ihm freundschaftlich verbunden waren die Könige von Schottland und die Anführer der irischen Stämme. Auch der ferne Kalif von Bagdad, Harun-ar-Rashid, der im Kampf gegen Byzanz und das Kalifat von Córdoba in Spanien auf ein Bündnis mit dem Reich Karls des Großen setzen wollte, schickte Karl reiche Geschenke.
Zu Beginn des neunten Jahrhunderts Das Reich Karls des Großen musste sich erstmals einer ernsthaften Gefahr angesichts der normannischen Piraten stellen. Die Normannen, wie die skandinavischen Stämme, die Skandinavien und Jütland bewohnten, damals genannt wurden, umfassten in ihrer Zusammensetzung die Vorfahren der modernen Norweger, Schweden und Dänen. Im Zusammenhang mit den Ereignissen im VIII. und IX. Jahrhundert. Unter den skandinavischen Stämmen begannen diese Führer durch den Prozess der Auflösung der Stammesbeziehungen, die scharfe Trennung des Adels und die Stärkung der Rolle der Militärführer und ihrer Trupps, ferne Seereisen zum Zwecke des Handels und Raubes zu unternehmen. Später wurden diese Piratenkampagnen zu einer echten Katastrophe für die Bevölkerung Westeuropas.
Anerkennung des feudalen Grundbesitzes in der fränkischen Gesellschaft im VIII-IX Jahrhundert.
Die Grundlage der Veränderungen im Gesellschaftssystem der Franken im VIII. und IX. Jahrhundert. es kam zu einer völligen Umwälzung der Grundbesitzverhältnisse: Ruin der Masse des freien fränkischen Bauerntums und gleichzeitige Vermehrung des Großgrundbesitzerbesitzes durch Aneignung kleinbäuerlichen Eigentums. Feudaler Landbesitz entstand und begann sich bei den Franken bereits im 6. Jahrhundert zu entwickeln. Unter den Merowingern spielte sie jedoch keine führende Rolle im Gesellschaftssystem. Die Hauptzelle der fränkischen Gesellschaft in dieser Zeit war eine freie Bauerngemeinschaft - die Marke.
Natürlich führte die damalige Entwicklung des Privateigentums an Grund und Boden zwangsläufig zum Anwachsen des Großgrundbesitzes, aber dieser Prozess verlief zunächst relativ langsam. Feudaler Landbesitz wurde erst durch die Agrarrevolution im 8. und 9. Jahrhundert dominant. Bei dieser Gelegenheit schrieb Engels: "... bevor die freien Franken fremde Siedler werden konnten, mussten sie irgendwie die Allod verlieren, die sie während der Besetzung des Landes erhalten hatten, ihre eigene Klasse von landlosen freien Franken musste sich bilden" ( F. Engels, Die Frankenzeit, K. Marx und F. Engels, Werke, Bd. XVI, Teil I, S. 397.).
Infolge der geringen Entwicklung der Produktivkräfte sah sich der Kleinbauer oft nicht in der Lage, die soeben erhaltene Parzelle als sein Eigentum zu behalten. Die Unfähigkeit des Kleinbauern, seinen Hof zu erweitern, die äußerst unvollkommene landwirtschaftliche Technik und damit die äußerste Hilflosigkeit des Direktproduzenten gegenüber allerlei Naturkatastrophen trieben ihn stetig in den Ruin. Gleichzeitig führte der unaufhörliche Prozess der inneren Zersetzung der Gemeinde selbst auch zur Trennung reicher Bauern von den freien Gemeindemitgliedern, die nach und nach die Ländereien ihrer verarmten Nachbarn übernahmen und zu kleinen und mittleren Feudalbesitzern wurden.
So verlor der freie fränkische Bauer infolge wirtschaftlicher Veränderungen seinen Grundbesitz und geriet in völlige wirtschaftliche Abhängigkeit sowohl von Großgrundbesitzern (Kombattanten, königlichen Beamten, kirchlichen Würdenträgern etc.) als auch von kleineren Feudalherren. Dieser Prozess des Verlusts ihres Landes durch die Bauern wurde durch eine Reihe von Gründen beschleunigt; Vernichtungskriege des fränkischen Adels und langer Militärdienst, die die Bauern lange aus ihrer Wirtschaft herausreißen, oft ins heißeste Loch; lästige Steuern, die mit zunehmender Staatsmacht die Bauern schwer zu tragen hatten, und unerträgliche Geldstrafen für verschiedene Arten von Fehlverhalten; Zwangsabgaben an die Kirche und direkte Gewalt von Großgrundbesitzern.
Die schwierige Situation der fränkischen Bauern führte dazu, dass im VIII. und IX. Jahrhundert. weit verbreitet ist die Praxis der sogenannten Prekarien. Das bereits im römischen Recht bekannte Precarium erhielt seinen Namen vom lateinischen Wort „preces“, was „Anfrage“ bedeutet und bedeutete schon unter den Merowingern die Überlassung eines Grundstücks durch einen Großgrundbesitzer an einen landlosen Bauern zur Nutzung bzw Besitz. Für das erhaltene Land musste der Bauer eine Reihe von Abgaben zugunsten seines Besitzers tragen. Dies war die erste, früheste Form des mittelalterlichen Prekariums.
Eine andere Form, die im 8. und 9. Jahrhundert am weitesten verbreitet war, war die folgende: Ein Bauer, der sah, dass er sein Land nicht für sich behalten konnte, „gab“ es seit der Gefahr an einen mächtigen Nachbarn und besonders oft an die Kirche Der Verlust von Land bestand für ihn meistens gerade in der Gegenwart eines so mächtigen Nachbarn. Dann erhielt der Bauer dieses Land zurück, aber nicht als sein eigenes Eigentum, sondern als lebenslanger, manchmal erblicher Besitz, und trug wiederum gewisse Pflichten zugunsten des Grundbesitzers. Dafür bewachte dieser seinen Haushalt.
Es gab Sammlungen sogenannter Formeln (d. h. Muster von Rechtsakten), die solche Grundstücksübertragungen formalisierten. Hier ist eine der Antworten der Äbtissin des Frauenklosters auf eine Bitte um Land im Prekarium. „Für die süßeste Frau, die ich bin, Äbtissin so und so. Da bekannt ist, dass Sie Ihr Grundstück in diesem und jenem Stadtteil besitzen, neuerdings hinter dem Kloster St. Maria hat zugestimmt und dafür hat sie uns und das genannte Kloster gebeten, [euch] ein Prekarium zu geben, dann haben sie euch mit diesem Schreiben zugestimmt, dass ihr zu Lebzeiten dieses Land besitzen und in Gebrauch behalten würdet, aber kein Recht hättet es gab für niemanden eine Möglichkeit, es zu veräußern, und wenn sie sich dazu entschließen würde, würde sie das Land sofort verlieren ... "
Manchmal erhielt der Prekarist zusätzlich zu seinem ehemaligen Land, das ihm als Prekarie gegeben wurde, ein zusätzliches Stück Land. Dies war die dritte Form der Prekarien, die hauptsächlich der Kirche diente, um Kleinbesitzer anzuziehen, sie zu Prekaristen zu machen und ihre Arbeitskraft auf den noch unbebauten Flächen einzusetzen. Es ist ganz klar, dass sowohl die zweite als auch die dritte Form der Prekarie zum Wachstum des Großgrundbesitzes beigetragen haben.
Das Prekarium war somit eine Form der Grundbesitzverhältnisse, die, wenn sie Vertreter zweier antagonistischer Klassen verband, gleichzeitig zum Verlust des Grundbesitzes des freien fränkischen Bauern und zum Anwachsen des feudalen Grundbesitzes führte.
Innerhalb der damals herrschenden Klasse der Landbesitzer entwickelten sich auch besondere Landverhältnisse im Zusammenhang mit der Ausbreitung der unter Charles Martell nach der Schlacht mit den Arabern bei Poitiers eingeführten sogenannten Benefizien (das lateinische Wort „beneficiura“ bedeutete wörtlich „gute Tat “). Der Kern der Nutznießung war folgender: Der Grundbesitz wurde auf die eine oder andere Person übertragen, die nicht im vollen Besitz war, wie es unter den Merowingern der Fall war. Die Person, die die Pfründen erhielt, musste zugunsten desjenigen, der ihm dieses Land schenkte, Militärdienst leisten. Auf diese Weise wurde eine Schicht von Dienstleuten gebildet, die für das erhaltene Land Wehrdienst leisten mussten. Verweigerte der Berechtigte den Wehrdienst, verlor er auch die Berechtigten. Stirbt der Begünstigte oder der Stifter des Begünstigten, fällt dieser an seinen Eigentümer oder dessen Erben zurück. Somit konnte ein Begünstigter nicht von der Person vererbt werden, die ihn erhielt, und war nur ein lebenslanger und bedingter Landbesitz.
Karl Martel erhielt das für die Verteilung der Erben benötigte Land, indem er einen Teil des Kirchenbesitzes zu seinen Gunsten beschlagnahmte (das war die sogenannte Säkularisation oder die Übertragung von Kirchenland in die Hände der weltlichen Macht). Natürlich war die Kirche sehr unzufrieden damit, obwohl sie sich in allen eroberten Gebieten befindet. erhielt neues Land und neue Privilegien. Daher verpflichtete der Nachfolger von Karl Martel, Pepin der Kleine, obwohl er die ausgewählten Ländereien nicht an die Kirche zurückgab, die Begünstigten dennoch, bestimmte Beiträge zu ihren Gunsten zu zahlen.
Die Einführung von Nutznießern, die zusammen mit den Bauern verteilt wurden, die auf dem zugeteilten Land saßen, führte zu einer weiteren Zunahme der Abhängigkeit der Bauern vom Grundbesitzer und zu einer Zunahme ihrer Ausbeutung.
Außerdem wurde die militärische Macht allmählich in den Händen der herrschenden Klasse konzentriert. Von nun an konnten Großgrundbesitzer ihre Waffen nicht nur gegen äußere Feinde, sondern auch gegen ihre eigenen Bauern einsetzen und sie zu allerlei Pflichten zum Wohle der Grundbesitzer zwingen.
Versklavung der fränkischen Bauernschaft
Das Anwachsen des Großgrundbesitzes auf Kosten freier Bauern, die das Recht auf Landbesitz verloren, ging mit deren Versklavung einher. Der ruinierte Kleinbesitzer war oft gezwungen, nicht nur sein Land an den Großgrundbesitzer zu übergeben, sondern auch persönlich von ihm abhängig zu werden, dh seine Freiheit zu verlieren.
„An meinen Herrn Bruder so und so“, hieß es im Namen des Bauern in Leibeigenschaftsbriefen. - Jeder weiß, dass mich extreme Armut und große Sorgen befallen haben und ich absolut nichts habe, womit ich leben und mich kleiden könnte. Sie haben sich also auf meine Bitte in meiner größten Not nicht geweigert, mir von Ihrem Gelde so viel Solidus zu geben; und ich habe nichts, um diese Feststoffe zu bezahlen. Deshalb habe ich Sie gebeten, die Versklavung meiner freien Persönlichkeit an Sie zu vollziehen und zu genehmigen, damit Sie von nun an die volle Freiheit haben, mit mir alles zu tun, was Sie mit Ihren geborenen Sklaven tun dürfen, nämlich zu verkaufen, zu tauschen, bestrafen.
Freie Bauern konnten sich zu günstigeren Bedingungen von einem großen Feudalherrn abhängig machen, ohne zunächst ihre persönliche Freiheit zu verlieren und gleichsam unter die Schirmherrschaft eines Großgrundbesitzers zu geraten (die sogenannte Belobigung, vom lateinischen Wort „commendatio“ - "Ich vertraue mich an"). Aber es ist ganz klar, dass das Gebot eines Bauern sowie seine Verwandlung in einen Prekaristen eines Großgrundbesitzers zu denselben Folgen führte, nämlich zur Verwandlung dieses freien Bauern sowie seiner Nachkommen in Leibeigene.
Der Staat spielte in diesem Prozess eine aktive Rolle. Dies wird durch eine Reihe von Dekreten Karls des Großen und seiner unmittelbaren Nachfolger belegt. In seinen Dekreten (Kapitular, vom lateinischen Wort „caput“ - „Kopf“ oder „Kopf“, da jedes Dekret in Kapitel unterteilt war) befahl Karl den Managern, freie Bauern, die auf königlichen Gütern lebten, zu überwachen und Geldstrafen von den Bauern zu erheben zugunsten des königlichen Hofes und richtet sie. In 818-820. Es wurden Dekrete erlassen, die alle Steuerzahler an das Land binden, dh ihnen das Recht nehmen, sich frei von einem Grundstück zum anderen zu bewegen. Die Karolinger befahlen den Bauern, Großgrundbesitzer zu verklagen und sich ihrer Autorität zu unterwerfen. Schließlich wurde im Kapitular von 847 direkt vorgeschrieben, dass jeder noch Freie, d. h. zunächst ein Bauer, einen Seigneur (Meister) finden sollte. Der Staat trug also aktiv zur Etablierung feudaler Verhältnisse in der fränkischen Gesellschaft bei.
Der Feudalbesitz und sein Wirtschaftsleben
Das Ergebnis der Revolution der Landverhältnisse im 8. und 9. Jahrhundert war die endgültige Durchsetzung des Grundbesitzes der herrschenden Klasse. An die Stelle der ehemaligen Freibauern-Gemeindemark trat ein Feudalgut mit ihm innewohnenden Sonderwirtschaftsordnungen. Was diese Orden waren, geht aus dem sogenannten „Capitulare de villis“ hervor, das um 800 im Auftrag Karls des Großen erstellt wurde und eine Anweisung an die Verwalter der königlichen Güter war. Aus diesem Kapitel sowie aus anderen Quellen des 9. Jahrhunderts, insbesondere aus der sogenannten „Polyptik des Abtes Irminon“ (d. h. dem Schreibbuch des Klosters Saint-Germain, das sich in einem Vorort von Paris befindet) , ist es klar, dass der Feudalbesitz in zwei Teile geteilt war: ein Gutshof mit einem Gutsland und ein Dorf mit Zuteilungen von abhängigen Bauern.
Der herrschaftliche Teil oder das Land des Herrn wurde als Domäne bezeichnet (vom lateinischen Wort "dominus" - des Herrn). Die Domäne bestand aus einem Gutshof mit Haus und Nebengebäuden sowie aus einem Gutsackerland. Auch die Mühle und die Kirche gehörten dem Gutsbesitzer. Das Ackerland der Domäne (Meister) war zwischen den Bauernparzellen verstreut, dh es gab ein sogenanntes gestreiftes Land, das zwangsläufig von einer erzwungenen Fruchtfolge begleitet war, die mit der Praxis der offenen Felder nach der Ernte verbunden war. Jeder musste auf einem bestimmten Feld das Gleiche säen und das Feld zur gleichen Zeit wie seine Nachbarn ernten, da sonst das auf das Feld freigelassene Vieh die von seinem Besitzer nicht geerntete Ernte zerstören könnte. Das herrschaftliche Land wurde von Bauernhänden bewirtschaftet, die mit ihrer Ausrüstung im Frondienst arbeiten mussten. Neben Ackerland umfasste die Domäne auch Wälder, Wiesen und Ödland.
Bauernland oder Land des "Besitzens", da die Bauern nicht seine Eigentümer waren, sondern es sozusagen vom Eigentümer des Landes "behielten" - der Eigentümer dieses Anwesens, wurde in Zuteilungen (Mansi) aufgeteilt. Jedes Herrenhaus umfasste einen Bauernhof mit einem Haus und Nebengebäuden, einen Gemüsegarten und Ackerland, das in Streifen mit anderen Bauern- und Landbesitzern verstreut war. Außerdem hatte der Bauer das Recht, gemeinschaftliche Weiden und Wälder zu nutzen.
So hatte ein Bauer, der auf dem Land eines Feudalherren arbeitete, anders als ein Sklave, der weder ein Haus, noch eine Farm, noch Eigentum oder eine Familie hatte, sein eigenes Haus, seine eigene Familie und seinen eigenen Haushalt. Die Existenz des bäuerlichen Eigentums an Ackerbau und landwirtschaftlichen Geräten neben dem Feudaleigentum hat ein gewisses Interesse der Produzenten materieller Güter, der Feudalgesellschaft, an ihrer Arbeit geweckt und war ein direkter Ansporn für die Entwicklung der Produktivkräfte in der Epoche des Feudalismus .
Die Produktivkräfte der Gesellschaft im VIII. und IX. Jahrhundert. extrem langsam, aber ständig wachsend. Es gab eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Techniken, effizientere Bodenbearbeitungsmethoden wurden verwendet, Wälder wurden für Ackerland gerodet und jungfräuliches Land wurde erhoben. Relog und Two-Field wichen nach und nach dem Three-Field.
In den wirtschaftlich rückständigen Teilen des Reiches (östlich des Rheins) wurden vor allem minderwertige Getreidesorten (Hafer, Gerste, Roggen) angebaut, während in den mittleren und westlichen Regionen zunehmend qualitativ höherwertige Sorten (Weizen etc.) angebaut wurden benutzt. Aus Gartenfrüchten wurden Hülsenfrüchte, Radieschen und Rüben gezüchtet. Von Obstbäumen - Apfel, Birne und Pflaume. In den Gärten wurden Heilkräuter und Hopfen angepflanzt, die für die Bierherstellung benötigt wurden. Der Weinbau entwickelte sich in den südlichen Teilen des Reiches. Aus Industriekulturen wurde Flachs gesät, aus dem Kleidung und Leinöl hergestellt wurden.
Bei landwirtschaftlichen Werkzeugen ist zu beachten, dass Ende des 9. Jahrhunderts. Pflüge verbreiteten sich: ein kleiner leichter Pflug für die Bearbeitung von steinigen oder Wurzelböden, der die Erde nur in langen Furchen schnitt, und ein schwerer Radpflug mit Eisenschar, der beim Pflügen nicht nur schnitt, sondern auch die Erde umdrehte. Die Egge, die damals ein dreieckiger Holzrahmen mit Eisenzähnen war, wurde hauptsächlich beim Anbau von Gemüsegärten verwendet. Das Eggen der Felder wurde mit Hilfe eines schweren Holzscheites durchgeführt, der über das gepflügte Feld gezogen wurde und die Erdklumpen aufbrach. Auf dem Hof wurden Sensen, Sicheln, zweizinkige Heugabeln und Rechen verwendet.

Das Getreide wurde vom Stroh gereinigt, mit einer Schaufel im Wind gesiebt, durch aus biegsamen Stäben geflochtene Siebe gesiebt und schließlich mit einfachen Stöcken oder hölzernen Dreschflegeln gedroschen. Die Verschmutzung der Felder erfolgte in der Regel unregelmäßig. Es ist klar, dass bei einer so niedrigen landwirtschaftlichen Technik die Erträge normalerweise extrem niedrig waren (1 1/2 selbst oder 2 selbst). Die bäuerliche Wirtschaft wurde von Kleinvieh (Schafe, Schweine und Ziegen) dominiert. Es gab wenige Pferde und Kühe.
Die gesamte Ökonomie eines Großgrundbesitzes war natürlicher Natur, d.h. Die Hauptaufgabe eines jeden Gutes war die Befriedigung des eigenen Bedarfs und nicht die Produktion für den Verkauf auf dem Markt. Die auf den Gütern arbeitenden Bauern waren verpflichtet, den Herrenhof (König, Graf, Kloster etc.) mit Lebensmitteln zu versorgen und den Gutsbesitzer, seine Familie und zahlreiches Gefolge mit allem Notwendigen zu versorgen. Das Handwerk war damals noch nicht von der Landwirtschaft getrennt, und die Bauern beschäftigten sich neben dem Ackerbau damit. Es wurden nur überschüssige Produkte verkauft.
Folgendes wurde über einen solchen Haushalt im „Capitulare on Estates“ (Kapitel 62) gesagt: „Lassen Sie unsere Manager jährlich bei der Geburt des Herrn getrennt, klar und der Reihe nach alle unsere Einkünfte mitteilen, damit wir Was und wie viel wir haben, können Sie unter separaten Artikeln erfahren. , genau ... wie viel Heu, wie viel Brennholz und Fackeln, wie viel Tesu ... wie viel Gemüse, wie viel Hirse und Hirse, wie viel Wolle, Flachs und Hanf , wie viele Früchte von Bäumen, wie viele Nüsse und Nüsse ... wie viel von Gärten, wie viel von Rübenkämmen, wie viele von Fischteichen, wie viele Häute, wie viele Felle und Hörner, wie viel Honig und Wachs, wie viel Talg , Fette und Seife, wieviel Beerenwein, gekochter Wein, Honiggetränke und Essig, wieviel Bier, Traubenwein, neues und altes Getreide, wieviel Hühner, Eier und Gänse, wieviel von Fischern, Schmieden, Büchsenmachern und Schuhmachern . .. wie viele von Drechslern und Sattlern, wie viele von Schlossern, von Eisen- und Bleiminen, wie viele von schweren Menschen, wie viele Fohlen und Stuten.
Ein solches Gut war die Haupteinheit der fränkischen Gesellschaft unter den Karolingern, was bedeutet, dass im Reich Karls des Großen eine Vielzahl wirtschaftlich geschlossener kleiner Welten geschaffen wurden, die nicht wirtschaftlich miteinander verbunden waren und ihre Bedürfnisse unabhängig voneinander mit den darin produzierten Produkten befriedigten Wirtschaft.
Die Not der Bauern und ihr Kampf mit den Feudalherren
Die feudal abhängigen Bauern wurden von den Feudalherren grausam ausgebeutet. Die Formen der bäuerlichen Abhängigkeit in der Zeit des Feudalismus waren äußerst vielfältig. Es war, wie Marx betont, "... Unfreiheit, die von der Leibeigenschaft durch Fronarbeit zu einer einfachen Rentenverpflichtung gemildert werden kann" ( K. Marx, Das Kapital, Bd. III, Gospolitizdat, 1955, S. 803.). Zusammen mit den überlebenden Überresten der freien Bauernschaft (insbesondere in den östlichen und nördlichen Regionen des Reiches) im fränkischen Staat des VIII-IX Jahrhunderts. es gab Bauern, die nur in rechtlicher Hinsicht vom Feudalherren abhängig waren. Es gab jedoch nur sehr wenige solcher Bauern.
Der Großteil der feudal abhängigen Bauernschaft waren Leibeigene, über deren Person die Feudalherren das Eigentumsrecht hatten, wenn auch ein unvollständiges (das heißt, sie hatten kein Recht, sie zu töten). Die Leibeigenen waren sowohl persönlich als auch grundstücksmäßig und gerichtlich vom Feudalherrn abhängig und zahlten ihm hohe Feudalzinsen. Es drückte sich in Form verschiedener Abgaben aus - Arbeitsdienst (Corvée), Lebensmittel (natürliche Abgaben) und Geld (Geldabgaben). Die vorherrschende Form der Rente unter den Karolingern war offenbar die Arbeitsrente. Aber gleichzeitig gab es Naturalmiete und teilweise Barmiete.
Als persönlich Unterhaltsberechtigter war der Leibeigene verpflichtet, dem Feudalherrn bei der Erbschaft seines Grundbesitzes das beste Stück Vieh abzugeben; musste für das Recht, eine Frau zu heiraten, die nicht seinem Herrn gehörte, bezahlen und zusätzliche Zahlungen leisten, die ihm der Feudalherr nach Belieben auferlegte.
Als landabhängiger Leibeigener war er verpflichtet, Abgaben zu zahlen und im Frondienst zu arbeiten. So wurden die Pflichten der Leibeigenen im 9. Jahrhundert dargestellt. in "Die Politik des Abtes Irminon". Von nur einer Bauernparzelle (und es gab mehrere tausend solcher Parzellen in der Klosterwirtschaft) erhielt das Kloster Saint-Germain jährlich: einen halben Stier oder 4 Widder „für militärische Angelegenheiten“; 4 Denare ( Denar = ungefähr 1/10 g Gold.) Gesamtbesteuerung; 5 Mods ( Natrium = ca. 250 Liter.) Körner für Pferdefutter; 100 Spalten und 100 Fransen nicht aus des Meisters Wald; 6 Hühner mit Eiern und nach 2 Jahren für die dritte - ein einjähriges Schaf. Die Inhaber dieser Schrebergarten waren außerdem verpflichtet, an drei Tagen in der Woche das Klosterfeld für die Winter- und Frühjahrssaat zu pflügen und verschiedene handwerkliche Arbeiten für das Kloster zu verrichten.
Zur Beilegung aller Streitigkeiten war der Bauer verpflichtet, sich an das örtliche Gericht zu wenden, an dessen Spitze der Feudalherr selbst oder sein Schreiber stand. Es ist klar, dass der Feudalherr Streitigkeiten in allen Fällen zu seinen Gunsten entschied.
Außerdem hatte der Grundbesitzer in der Regel noch das Recht, allerlei Abgaben zu erheben - Straße, Fähre, Brücke usw. Noch schwieriger wurde die Lage der arbeitenden Massen durch Naturkatastrophen, mit denen sie dann nicht mehr umzugehen wussten zu bewältigen, sowie endlose Feudalkämpfe, die die bäuerliche Wirtschaft ruinierten.
Die grausame feudale Ausbeutung verursachte einen scharfen Klassenkampf zwischen den Bauern und den Feudalherren. Dass dieser Kampf weit verbreitet war, belegen auch die königlichen Kapitulare, die eine strenge Bestrafung der Rebellen anordneten, und die Berichte mittelalterlicher Chronisten. Aus diesen Kapitularen und Chroniken erfahren wir das Ende des 8. Jahrhunderts. In dem Dorf Selt, das dem Bischof von Reims gehörte, kam es zu einem Aufstand abhängiger Bauern. 821 entstand in Flandern eine "Verschwörung" von Leibeigenen. In 841-842. kam es im sächsischen Raum zu einem sogenannten „Stelling“-Aufstand (was wörtlich „Kinder des alten Rechts“ bedeutet), als freie sächsische Bauern in einen Kampf sowohl mit dem eigenen als auch mit dem fränkischen Adel, der sie brachte, eintraten Versklavung. 848 traten freie Bauern aus, die gegen die Versklavung im Bistum Mainz kämpften. 866 brach am selben Ort ein zweiter Aufstand aus. Es sind auch andere Bewegungen bekannt, die sich gegen feudale Unterdrückung und Ausbeutung richteten. Alle diese Aufstände fanden hauptsächlich im 9. Jahrhundert statt, als eine Revolution in den Agrarverhältnissen vollendet war und der Prozess der Versklavung der Bauern die größten Ausmaße annahm.
Diese Aufstände gegen die herrschende Klasse konnten in jener historischen Situation nicht gewinnen, als die etablierte feudale Produktionsweise alle Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung hatte. Die Bedeutung der frühen antifeudalen Bewegungen der Bauern war jedoch sehr groß. Diese Bewegungen waren fortschrittlichen Charakters, denn ihr Ergebnis war eine gewisse Begrenzung der grausamen Ausbeutung der Werktätigen und die Schaffung erträglicherer Bedingungen für ihre Existenz. Somit trugen diese Bewegungen zur schnelleren Entwicklung der Produktivkräfte der feudalen Gesellschaft bei. Je mehr Zeit der Bauer seiner eigenen Wirtschaft widmete, je mehr er sich für die Verbesserung der landwirtschaftlichen Technologie und die Steigerung der Produktivität seiner Arbeit interessierte, desto schneller entwickelte sich die feudale Gesellschaft als Ganzes.
Innere Organisation der herrschenden Klasse der Feudalherren
Grundbesitzverhältnisse, die innerhalb der Klasse der Feudalherren bestanden, liegen ihrer militärpolitischen Organisation zugrunde. Der Begünstigte war in der Regel mit Vasallenbeziehungen verbunden, wenn eine freie Person, die Begünstigte von einem Großgrundbesitzer erhielt, sein Vasall genannt wurde (vom lateinischen Wort "vassus" - Diener) und verpflichtet war, für ihn Militärdienst zu leisten. Der Eintritt in Vasallenbeziehungen wurde durch eine bestimmte Zeremonie gesichert. Nach Erhalt einer Pfründe gab ein Freier bekannt, dass er Vasall des einen oder anderen Herrn (seigneur) werden würde, und der seigneur leistete ihm einen Treueeid. Diese Zeremonie wurde später Hommage genannt (vom lateinischen Wort „homo“ – eine Person, da der Treueeid die Worte enthielt: „Ich werde deine Person“).
Im Gegensatz zu den Beziehungen zwischen Bauern und Feudalherren gingen die Vasallenbeziehungen nicht über die Grenzen derselben herrschenden Klasse hinaus. Die Vasallenschaft festigte die Feudalhierarchie, d. h. die Unterordnung der kleineren Grundbesitzer unter die größeren und der größeren unter die größten, während die persönliche Abhängigkeit des Bauern vom Feudalherrn zur Versklavung der Bauern führte.
Die Verwaltungsstruktur des Reiches
Die Regierungsjahre der ersten Karolinger beinhalten eine zeitweilige Stärkung der zentralen Staatsgewalt, deren Haupt- und bestimmender Grund freilich nicht in den „herausragenden Fähigkeiten“ der Karolinger und insbesondere in der „ Staatsbegabung" Karls des Großen. Tatsächlich wurde eine gewisse Stärkung des zentralen Staatsapparates unter den Karolingern durch die tiefgreifendsten Veränderungen auf dem Gebiet der sozialen Beziehungen verursacht.
Die Klasse der Landbesitzer-Feudalherren in dieser Zeit brauchte eine solche zentrale Autorität, die ihr die schnellste Unterwerfung der Klasse der Bauern, die gegen die Versklavung kämpften, sicherstellte und gleichzeitig eine breite Eroberungspolitik verfolgte, neue Ländereien brachte und neue Leibeigene für die Großgrundbesitzer. Die Veränderungen in den Formen des Feudalstaates waren also auf grundlegende Veränderungen in der Position der Bauernschaft und ihres Kampfes gegen die herrschende Klasse zurückzuführen. Zum Zentrum der Verwaltung des Karolingischen Reiches wurde zeitweilig der Reichshof mit seinen Beamten - Kanzler, Erzkapellmeister und Pfalzgraf. Der Kanzler fungierte als Sekretär des Kaisers und Hüter des Staatssiegels. Der Erzkaplan kontrollierte den fränkischen Klerus, und der Pfalzgraf war wie der ehemalige Bürgermeister für die Wirtschaft und Verwaltung des Schlosses zuständig.
Mit Hilfe der königlichen Kapitulare versuchte Karl der Große, verschiedene Fragen der Regierung eines riesigen Staates zu lösen. Kapitulare wurden von Karl dem Großen auf Anraten von Großgrundbesitzern herausgegeben, die sich zu diesem Zweck zweimal im Jahr im königlichen Schloss versammelten.
Das Reich wurde in Regionen aufgeteilt. Die Grenzregionen wurden Marken genannt. Die Marken waren gut befestigt und dienten sowohl der Verteidigung als auch als Sprungbrett für weitere Eroberungen. An der Spitze jeder Region standen Grafen und an der Spitze der Mark - Markgrafen. Um die Aktivitäten der Grafen zu kontrollieren, sandte Karl besondere souveräne Gesandte in die Region.
Zur Stärkung des Reichsstaatsapparates, der für die herrschende Klasse vor allem in Zeiten grundlegender sozialer Veränderungen in der fränkischen Gesellschaft notwendig war, die auf Unterdrückung und Versklavung der Massen abzielten, führte Karl der Große eine Justizreform durch, die die bisherigen abschaffte Verpflichtung der Bevölkerung zur Teilnahme an Bezirksgerichtssitzungen. Aus dem Volk gewählte Richterämter wurden abgeschafft. Die Richter wurden Staatsbeamte, die ein Gehalt bezogen und unter dem Vorsitz des Grafen richteten. Auch eine Militärreform wurde durchgeführt. Karl der Große hörte auf, von den Bauern Militärdienst zu fordern (zu diesem Zeitpunkt waren die meisten bereits bankrott und vollständig von den Feudalherren abhängig). Königliche Begünstigte wurden zur wichtigsten Militärmacht.
Stärkung der politischen Macht der Feudalherren
Die Durchsetzung des feudalen Grundbesitzes führte zur Stärkung der politischen Macht der Grundbesitzer gegenüber der arbeitenden Bevölkerung, die auf ihren Ländereien saß. Auch die Merowinger trugen zur Ausweitung der Privatmacht der Großgrundbesitzer bei, indem sie ihnen sogenannte Immunitätsrechte einräumten.
Unter den Karolingern wurde die Immunität weiterentwickelt. Der Name Immunität kommt vom lateinischen Wort "immunitas", was in der Übersetzung ins Russische "Immunität" einer Person bedeutet, ihre Befreiung von etwas.
Der Kern der Immunität bestand darin, dass das Territorium des Landbesitzers des Immunisten (d. h. der Person, die den Immunitätsbrief erhalten hatte) vom König vom Besuch königlicher Beamter befreit wurde, um gerichtliche, administrative, polizeiliche, steuerliche oder andere Aufgaben zu erfüllen. Die Pflicht zur Wahrnehmung dieser Funktionen wurde dem Immunisten selbst übertragen, dessen private Macht dadurch stark wuchs. Manchmal überwies der König alle Einnahmen, die bis zu diesem Zeitpunkt zugunsten der königlichen Schatzkammer geflossen waren (Steuern, Gerichtsstrafen usw.), zugunsten des Immunisten. Ein Großgrundbesitzer entpuppte sich gegenüber der auf seinem Land lebenden Bevölkerung als eine Art Souverän.
Die königliche Macht trug auf diese Weise gleichsam selbst zur Verwandlung der Großgrundbesitzer in vom König unabhängige Völker bei. Aber das lag natürlich nur an ihrer Schwäche. Die Immunität als Summe der politischen Rechte des Feudalherrn gegenüber dem wirtschaftlich abhängigen Bauern wuchs und entwickelte sich unabhängig vom Willen der Könige und Kaiser. Die Großgrundbesitzer, die die volle wirtschaftliche Macht über die bäuerliche Bevölkerung ihrer Güter erhalten hatten, versuchten, diese Bevölkerung auch politisch abhängig zu machen. Sie führten willkürlich Gerichtsverfahren und Repressalien auf ihren Gütern durch, bildeten ihre eigenen bewaffneten Abteilungen und erlaubten königlichen Beamten nicht, ihre Domänen zu betreten. Die Zentralregierung erwies sich im Kampf gegen solche Tendenzen der Großgrundbesitzer als machtlos und war gezwungen, die bereits etablierten Beziehungen mit Hilfe von Immunitätsbriefen zu formalisieren.
Unter den Karolingern wurde die Immunität zu einem allgegenwärtigen Phänomen und zu einem der mächtigen Mittel zur Versklavung der Bauernschaft. Die Immunitätsrechte erstreckten sich auf weitere Gebiete, und die Immunisten selbst gewannen noch mehr Macht. Der Immunist berief nun Gerichtsverhandlungen ein, hielt Prozesse ab, fahndete nach Verbrechern, kassierte Strafen und Zölle zu seinen Gunsten usw.
„Auf Bitte des Bischofs von so und so“, schrieben die Könige in ihren Briefen, „… gewährten wir ihm diesen Segen, der darin besteht, dass innerhalb der Güter der Kirche dieses Bischofs … nicht a Ein einzelner souveräner Beamter soll eintreten, um Gerichtsverfahren zu verhandeln oder gerichtliche Geldstrafen einzuziehen, aber der Bischof selbst und sein Nachfolger lassen ihnen im Namen Gottes kraft vollständiger Immunität alle oben genannten Rechte zu ... Und alles das Die Schatzkammer könnte dort von freien oder nicht freien und anderen Menschen, die auf den Ländereien ... der Kirche leben, empfangen werden, lassen Sie sie für immer in die Lampen der oben genannten Kirche eintreten.
Um schließlich die Rekrutierung freier Siedler auf den Ländereien von Großgrundbesitzern für den Militärdienst zu gewährleisten, übertrugen die Karolinger diesen Grundbesitzern Verwaltungsrechte über alle freien Siedler auf ihren Gütern, das heißt, als ob sie Seigneurs für diese zuvor freien Menschen ernannten im rechtlichen Sinne. So kam es zu bedeutenden Veränderungen in der politischen Position der Menschen, die sich auf dem Land eines Großgrundbesitzers niederließen, dh Bauern und anderen freien Menschen. Bisher waren diese Personen dem Grundstückseigentümer rechtlich gleichgestellt, obwohl sie wirtschaftlich von ihm abhängig waren. Jetzt sind sie Menschen geworden, die dem Grundbesitzer und legal unterstellt sind.
Die Ausweitung und Stärkung der Immunität, die in den Händen der herrschenden Klasse ein Instrument des nichtwirtschaftlichen Zwangs der Massen der ausgebeuteten Bauernschaft war, trug zum Prozess ihrer weiteren Versklavung und Intensivierung der feudalen Ausbeutung bei. "Wirtschaftliche Unterwerfung erhielt politische Sanktion" ( F. Engels, Die Frankenzeit, K. Marx und F. Engels, Werke, Bd. XVI, Teil D, S. 403 .. .). Der Bauer, der zuvor das Recht auf Besitz seines angestammten Landes verloren hatte, verlor nun auch seine persönliche Freiheit. Die Privatmacht des Immunisten erhielt eine Art Staatscharakter, und aus dem Nachlass des Immunisten wurde gleichsam ein Kleinstaat.
Die innere Schwäche des karolingischen Reiches und sein rascher Zusammenbruch
Das aus Eroberungskriegen entstandene Reich Karls des Großen hatte wie andere ähnliche Reiche der Antike und des Mittelalters keine eigene wirtschaftliche Basis und war ein vorübergehender und instabiler militärisch-administrativer Verbund. Es war sowohl im Hinblick auf die ethnische (Stammes-) Zusammensetzung des Karolingischen Reiches als auch im Hinblick auf seine sozioökonomische Entwicklung äußerst vielfältig. In einer Reihe von Gebieten sind Stammesmerkmale seit langem ausgelöscht. Die germanischen Stämme, die diese Gebiete eroberten, übernahmen nicht nur die provinziellen Dialekte der lateinischen Sprache, sondern auch die für das spätrömische Reich charakteristische Gesellschaftsordnung. Die darin entstandenen Anfänge feudaler Verhältnisse (Großgrundbesitz verbunden mit Kleinbauern, Subsistenzwirtschaft, Kolonien und Patrozinium) trugen zur rascheren Entwicklung des Feudalismus in Gebieten des karolingischen Staates wie Aquitanien, Septimanien und der Provence bei. Deutlich rückständiger im Entwicklungsstand der feudalen Verhältnisse waren die rheinischen Gebiete. Solche Gebiete waren Bayern, Sachsen, Alemannen, Thüringen und Friesland, wo die Entwicklung des Feudalismus langsam war und wo eine große Anzahl von Stammesresten erhalten blieb.
Schließlich gab es im Karolingerreich Gebiete, in denen sich romanische und germanische Elemente als ethnisch gemischt erwiesen. Die Wechselwirkung der sozioökonomischen Ordnungen, die unter der einheimischen romanisch-gallischen Bevölkerung existierten, mit den sozioökonomischen Ordnungen, die unter den neu ankommenden germanischen Stämmen (Franken und Burgundern) existierten, führte zur Entwicklung des Feudalismus in seinen klassischsten Formen. Diese Gebiete waren jene Teile des Reiches, die gleichsam an der Schnittstelle zwischen der romanischen und der germanischen Welt lagen, also Nordost- und Mittelgallien sowie Burgund.
Zwischen den im Reich Karls des Großen vereinten Stämmen und Nationalitäten bestanden keine rein gewalttätigen wirtschaftlichen Bindungen. Deshalb vollzog sich die historische Entwicklung nicht innerhalb der Grenzen des Reiches als Ganzes, sondern innerhalb der Grenzen einzelner Nationalitäten und Stämme oder ihrer mehr oder weniger verwandten Verbindungen. Die natürliche Tendenz der mit Waffengewalt unterworfenen Stämme und Nationalitäten zur Befreiung von der Herrschaft der Eroberer, die ungeteilte Vorherrschaft der Naturalwirtschaft in den Feudalgütern, der Zerfall der fränkischen Gesellschaft in eine Reihe wirtschaftlich geschlossener Welten, das kontinuierliche Wachstum der die Macht der Großgrundbesitzer in den Ortschaften und die Ohnmacht der Zentralregierung - all dies führte zum unvermeidlichen politischen Zusammenbruch des Reiches.
Und tatsächlich wurde das Reich nach dem Tod Karls des Großen (814) zunächst unter seinen Erben aufgeteilt, um dann endgültig in drei Teile aufzubrechen. Dieser Zerfall wurde durch den Vertrag von Verdun formalisiert, der 843 zwischen den Enkeln Karls des Großen geschlossen wurde. Einer dieser Enkel, Karl der Kahle, erhielt durch den Vertrag von Verdun Besitzungen westlich des Rheins - den westfränkischen Staat (d.h. das zukünftige Frankreich). Ein anderer Enkel, Ludwig der Deutsche, erhielt Besitzungen östlich des Rheins - den ostfränkischen Staat (dh das zukünftige Deutschland). Und der älteste Enkel - Lothar erhielt einen Landstreifen am linken Rheinufer (zukünftiges Lothringen) und Norditalien.
Feudalkirchliche Kultur
In der feudalen Gesellschaft, die die Sklavenhaltergesellschaft ablöste, entstand eine neue, feudale Kultur. Träger der feudalen Kultur im frühen Mittelalter war die Kirche.
Die Religion in der feudalen Gesellschaft war eines der mächtigen Mittel zur Errichtung und Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft der Ausbeuter. Die Kirche versprach himmlische Glückseligkeit als Belohnung für irdisches Leid, lenkte die Massen mit allen Mitteln vom Kampf gegen die Feudalherren ab, rechtfertigte die feudale Ausbeutung und versuchte beharrlich, die Werktätigen im Geiste des absoluten Gehorsams gegenüber ihren Herren zu erziehen. Der Einfluss der Kirche beeinflusste mit aller Kraft die geistige Kultur der mittelalterlichen Gesellschaft. „... die feudale Organisation der Kirche“, schrieb Engels, „weihte die säkulare feudale Staatsordnung mit der Religion. Der Klerus war auch die einzige gebildete Klasse. Daraus folgte von selbst, dass das kirchliche Dogma der Ausgangspunkt und die Grundlage allen Denkens war. Rechtswissenschaft, Naturwissenschaft, Philosophie – alle Inhalte dieser Wissenschaften wurden mit der Lehre der Kirche in Einklang gebracht“ ( F. Engels, Rechtssozialismus, K. Marx und F. Engels, Werke, Bd. XVI, Teil I, S. 295.).
Der Zerfall der feudalen Gesellschaft in eine Reihe wirtschaftlich und politisch abgeschlossener kleiner Welten und der weit verbreitete Bruch der handelspolitischen und kulturellen Bindungen, die in der Sklavenhaltergesellschaft bestanden, führten im 6. bis 10. Jahrhundert zum Fehlen einer breiten Bildung. Alle damals bestehenden Schulen (bischöfliche und klösterliche) befanden sich in den Händen des Klerus. Die Kirche bestimmte ihr Programm und wählte die Zusammensetzung ihrer Studenten aus. Die Hauptaufgabe der Kirche bestand gleichzeitig darin, Kirchendiener auszubilden, die in der Lage waren, mit ihrer Verkündigung auf die Massen des Volkes einzuwirken und die bestehende Ordnung unversehrt zu wahren.
Von ihren Dienern verlangte die Kirche in der Tat sehr wenig - Kenntnis der Gebete, die Fähigkeit, das Evangelium auf Latein zu lesen, auch wenn sie nicht alles, was gelesen wurde, zu verstehen, und Vertrautheit mit der Reihenfolge der Gottesdienste. Personen, deren Wissen über die Grenzen eines solchen Programms hinausging, tauchten im 6. bis 10. Jahrhundert in der westeuropäischen Gesellschaft auf. die seltensten Ausnahmen.
Bei der Schaffung von Schulen konnte die Kirche auf einige Elemente weltlicher Bildung, die die feudale Gesellschaft von der Antike geerbt hatte, nicht verzichten. Indem sie diese Elemente weltlicher Bildung an ihre eigenen Bedürfnisse anpasste, wurde die Kirche zu ihrem unbewussten „Hüter“. Die alten Disziplinen, die in Kirchenschulen gelehrt wurden, wurden die "sieben freien Künste" genannt, was bedeutete: Grammatik, Rhetorik und Dialektik (das sogenannte Trivium - "drei Wege des Wissens", oder die erste Stufe des Lernens) und Arithmetik, Geometrie , Astronomie und Musik (das sogenannte Quadrivium - "vier Wege der Erkenntnis", oder die zweite Stufe des Lernens). Ein Versuch, die aus der Antike geerbten Elemente der Bildung zusammenzuführen, geht auf das 5. Jahrhundert zurück. und wurde von Marcianus Capella durchgeführt. Die Einteilung der „freien Künste“ in Trivium und Quadrivium erfolgte bereits im 6. Jahrhundert. Boethius und Cassiodorus - die letzten Vertreter der antiken Bildung.
Aber die "freien Künste" des Mittelalters waren sehr entfernt von dem, was in alten Schulen gelehrt wurde, denn Vertreter der kirchlichen Bildung behaupteten, dass jedes Wissen nur dann nützlich ist, wenn es hilft, sich die kirchliche Lehre besser anzueignen. Rhetorik galt damals als ein Fach, das dazu beitrug, für Kirche und Staat notwendige Dokumente kompetent zu erstellen. Die Dialektik (wie man damals die formale Logik nannte) war der Theologie völlig untergeordnet und diente den Vertretern der Kirche nur dazu, Ketzer im Streit zu bekämpfen. Musik wurde während des Gottesdienstes benötigt, Astronomie wurde verwendet, um den Zeitpunkt des Beginns verschiedener kirchlicher Feiertage zu bestimmen und für alle Arten von Vorhersagen.
Die astronomischen und geographischen Darstellungen jener Zeit zeugen von der extremen Ignoranz der Geistlichkeit. Den Schülern der Kirchenschulen wurde beigebracht, dass es im äußersten Osten das Paradies gibt, dass die Erde wie ein Rad ist, dass der Ozean sie auf allen Seiten umfließt und dass Jerusalem in seiner Mitte liegt. Die Lehre von der Sphärizität der Erde wurde kategorisch abgelehnt, weil die Vertreter der Kirche argumentierten, dass es nicht vorstellbar sei, dass sich Menschen auf der gegenüberliegenden Seite der Erde kopfüber bewegen würden.
Alle aus der Antike überlieferten Informationen, die Schüler dazu veranlassen könnten, nach Erfahrungswissen zu streben, wurden sorgfältig totgeschwiegen. Antike Autoren absichtlich verzerrt. Die Mönche zerstörten oft die einzigartigen Texte auf den alten Manuskripten, die sich in den Klosterbibliotheken befanden, und verwendeten dann das auf diese Weise „gereinigte“ und teure Pergament, um die Klosterchroniken aufzuzeichnen. Echtes Naturwissen wurde durch abergläubischen Unsinn ersetzt.
Bildung, monopolisiert von der westlichen christlichen Kirche, war von sehr primitiver Natur. Die Kirche war und konnte nicht daran interessiert sein, das gesamte antike Erbe des Mittelalters zu bewahren, und versuchte, gezwungen, sich an letzteres zu wenden, es nur für ihre eigenen Zwecke zu verwenden.
"Karolingische Wiederbelebung"
Die sogenannte „karolingische Erweckung“ stärkte die Stellung der Kirche im Bereich der spirituellen Kultur und Bildung weiter. Einige Wiederbelebung der Aktivitäten des Klerus und der Vertreter der kaiserlichen Behörden in der Organisation der Kirchenschulen in der zweiten Hälfte des VIII. und zu Beginn des IX. Jahrhunderts. war mit den tiefgreifendsten sozioökonomischen Veränderungen im Leben der Gesellschaft verbunden, das heißt mit einer völligen Revolution der Grundbesitzverhältnisse, die zur Erstarkung weltlicher und geistlicher Feudalherren und zur Versklavung der Bauern führte.
Die Rolle der Kirche unter diesen Bedingungen wurde immer wichtiger. Deshalb beließen die Karolinger, während sie die kirchliche Autorität durch die Schaffung einer Schicht gebildeter Kleriker stärkten, das gesamte Bildungsmonopol in den Händen der Kirche und änderten in keiner Weise die zuvor bestehenden Ordnungen. Die gebildeten Leute, die sie für die Arbeit im Staatsapparat brauchten, zogen die Karolinger aus kirchlichen Schulen.
Die Aufgaben dieser Schulen wurden von der prominentesten Figur der „Karolingischen Renaissance“ – Alcuin (um 735-804), einem Schüler der Yorker Schule – klar und knapp umrissen. In einem seiner Briefe an Karl den Großen schrieb Alcuin: "Ich arbeite hart an vielen Dingen, um viele zum Wohle der heiligen Kirche Gottes zu erziehen und deine kaiserliche Macht zu schmücken." Karl der Große forderte in seinen Kapitularen von den Mönchen die obligatorische Einrichtung von Klosterschulen zum Unterrichten von Geistlichen – Lesen, Zählen, Schreiben und Singen, denn Hirten, die der Belehrung des Volkes verpflichtet sind, müssen die „Heilige Schrift“ lesen und verstehen können. Karl der Große zog aus Italien, wo der Klerus ein höheres Bildungsniveau hatte, eine Reihe von Personen an, die in der Lage waren, kirchliche Schulen zu leiten. Also brachte Karl der Große Peter vom Libanon, Paul den Diakon, Leidard und Theodulf heraus.
Karl der Große schenkte den kirchlichen Schulen große Aufmerksamkeit und glaubte, dass den Laien nur die "Wahrheiten" der Religion und das "Glaubensbekenntnis" beigebracht werden sollten. Für diejenigen, die sich weigerten, das "Glaubensbekenntnis" zu studieren, verordnete Karl der Große eine Reihe von Kirchenstrafen (Fasten usw.). Königliche Gesandte und Grafen waren verpflichtet, die Ausführung dieser Befehle zu überwachen.
So ging es sowohl in den Kapitularen Karls des Großen als auch in den Beschlüssen der während seiner Regierungszeit tagenden Kirchenräte nicht um die Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus und der Kultur in allen Schichten der feudalen Gesellschaft, sondern nur um die Unterweisung eines bestimmten Kreises Menschen, die in der Lage sind, das Volk mit ihrer Predigt zu beeinflussen. Die Theologie galt noch immer als „Krone der Bildung“. Tatsächlich „übertrifft unsere glorreiche, gelehrte Weisheit des Herrn alle Weisheit der akademischen Wissenschaft“, schrieb Alcuin und bezog sich dabei auf Platons Akademie. Es ist klar, dass es bei einer solchen Fragestellung keine wirkliche Wiederbelebung der "freien Künste" der Antike geben konnte.
Lehrbücher, zusammengestellt in Form von Dialogen zwischen einem Lehrer und einem Schüler, zeugen von dem damals extrem niedrigen Bildungsniveau. Ein Beispiel für ein solches Handbuch ist ein Dialog, den Alcuin für den Sohn Karls des Großen - Pepin - geschrieben hat:
„P und n und n. Was ist ein Brief? - A l bis at und n. Wächter der Geschichte. P und p und n. Was ist ein Wort? - A l bis at und n. Verräter der Seele ... P und p und n. Wie sieht die Person aus? - A l bis at und n. Zum Ball. - P und p und n. Wie ist die Person platziert? - A l bis at und n. Wie eine Lampe im Wind ... P und p und n. Was ist ein Kopf? - A l bis at und n. Die Oberseite des Körpers.- P und p und n. Was ist ein Körper? - A l bis at und n. Die Wohnung der Seele ... P und p und n. Was ist Winter? - A l bis at und n. Sommer Exil. P und p und n. Was ist Frühling? - A l bis at und n. Maler der Erde usw.
Die gesamte Literatur der karolingischen Zeit war reine Nachahmung, hauptsächlich die christliche Literatur der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung. Dies ist an den Werken von Alcuin selbst und an den Werken seines Schülers - des Biographen Karls des Großen - Eingard zu sehen. Die Manuskripte verbesserten sich jedoch in dieser Zeit erheblich. Es wurde eine Schriftreform durchgeführt, in deren Folge überall ein klarer Buchstabe (karolingische Minuskel) etabliert wurde, der als Grundlage für die moderne Gliederung lateinischer Buchstaben diente. Die Schreiber verzierten die Manuskripte mit Miniaturen (kleinen Bildern) zu biblischen Themen.
Neben kirchlichen Werken kopierten karolingische Schreiber auch Bücher antiker Autoren (Dichter, Philosophen, Juristen und Politiker), was zur Erhaltung dieser Handschriften beitrug.
Es ist notwendig, den Bau zu erwähnen, der unter Karl dem Großen stattfand. Um die Bedeutung der Reichsmacht und der Kirche zu steigern, ließ er Schlösser und Kathedralen in Aachen und anderen Punkten seines Staates errichten. In ihrer Architektur ähnelten die Gebäude dem Stil byzantinischer Bauten in Ravenna.
Die Baumaschinen im Westen waren zu dieser Zeit äußerst unvollkommen. Auf Befehl Karls des Großen wurden häufig Marmorsäulen beim Bau von Gebäuden verwendet, die aus ganz Italien entfernt wurden. Gleichzeitig wurden antike Kunstdenkmäler barbarisch zerstört. Die meisten der unter Charles errichteten Gebäude waren jedoch aus Holz und starben daher sehr schnell.

Die „karolingische Renaissance“ war sehr kurzlebig. Der rasche Zusammenbruch des Imperiums musste sich auf den Bereich der Kultur auswirken. Moderne Chronisten, die den miserablen Zustand der Bildung in der Zeit nach dem Zusammenbruch des Reiches aufzeichnen, haben festgestellt, dass das Königreich der Franken zu einem Schauplatz von Unruhen und Kriegen geworden ist, dass überall mörderische Kämpfe brodeln und dass das Studium von „beidem die heilige Schrift und die freien Künste" völlig vernachlässigt.
Das aktuelle Bild der kirchlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Geisteskultur im Frühmittelalter zeigt also, dass das von der Kirche in der frühesten Entwicklungsstufe der Feudalgesellschaft ergriffene Bildungsmonopol zu sehr beklagenswerten Ergebnissen geführt hat. „Von der Antike, als Erbe“, schrieb Engels, „waren Euklid und das Sonnensystem des Ptolemäus, von den Arabern das dezimale Zahlensystem, die Anfänge der Algebra, die moderne Zahleneinschreibung und Alchemie, das christliche Mittelalter hat nichts hinterlassen ” ( F. Engels, Dialektik der Natur, Gospolitizdat, 1955, S. 5.).
Die Kirche sah eine ihrer Hauptaufgaben darin, die Massen in einem Zustand äußerster Unwissenheit zu halten und damit zu ihrer noch vollständigeren Versklavung beizutragen.
Die damals vorherrschende feudalkirchliche Kultur hatte einen ausgeprägten Klassencharakter.
Volkskunst im frühen Mittelalter
„Die Gedanken der herrschenden Klasse“, betonten Marx und Engels, „sind die herrschenden Gedanken in jeder Epoche. Das bedeutet, dass die Klasse, die die dominierende materielle Kraft der Gesellschaft darstellt, gleichzeitig ihre dominierende geistige Kraft ist. K. Marx und F. Engels, Deutsche Ideologie, Soch., Bd. 3, hrsg. 2, S. 45.). Aber das bedeutet nicht, dass diese Kultur die einzige ist, da sie die vorherrschende ist.
So wie der Lehre der Kirche, die die feudale Ausbeutung rechtfertigte und verteidigte, die ketzerische antifeudale Lehre des Volkes gegenüberstand, so stand der spirituellen Kultur der herrschenden Klasse die spirituelle Kreativität der Massen gegenüber: märchenhafte Epenepen , Lieder, Musik, Tänze und dramatische Action.
Der Reichtum der Volkskunst zeigt sich vor allem darin, dass die ursprüngliche Grundlage der größten epischen Werke des westeuropäischen Mittelalters Volksmärchen waren. Am vollständigsten sind diese Volksmärchen in den nördlichen und nordwestlichen Regionen Europas erhalten geblieben, wo die Entwicklung der feudalen Verhältnisse relativ langsam vor sich ging und wo lange Zeit eine bedeutende Schicht der freien Bauernschaft existierte.
Die epischen Werke der burgundischen und fränkischen Gesellschaft – das Nibelungenlied und die „Heldengedichte“, insbesondere das Rolandslied – sind nur in Form von späteren Werken überliefert, in denen die ursprünglichen Volksmärchen einer angemessenen Bearbeitung im Interesse des Volkes unterzogen wurden herrschende Klasse. Entstanden aus einem Volksepos, das den Kampf Karls des Großen mit den Arabern poetisiert, trägt das „Rolandlied“ jedoch die Züge eines starken Volkseinflusses. Es kommt in jenen Teilen dieses Gedichts zum Ausdruck, die von der Liebe zum "süßen Frankreich" sprechen, vom Hass auf Feinde, die in seine Freiheit eingreifen, und wo alle Feudalherren verurteilt werden, die die Interessen des Mutterlandes um ihrer persönlichen Interessen willen verraten.
Musik und Poesie spielten zweifellos eine große Rolle in der Volkskunst des 5. bis 10. Jahrhunderts. Am weitesten verbreitet in der fränkischen Gesellschaft waren Volkslieder und Epen, alle Arten von komischen und satirischen Liedern.
Die Massen des Volkes hielten sehr lange an vorchristlichen Bräuchen fest, brachten den einstigen Gottheiten Opfer dar, verbanden vorchristliche religiöse Riten mit christlichen und „beschmutzten“ christliche Kirchen mit Volksliedern und -tänzen. Im VI Jahrhundert. Im Süden Galliens gab es Fälle, in denen die Menschen den Gottesdienst unterbrachen und ausriefen: „Heiliger Martial, bitte für uns, und wir werden für dich tanzen!“ Danach wurde in der Kirche ein Reigen veranstaltet und Volkstänze begannen .
Die katholische Kirche behandelte die musikalische und poetische Kreativität des Volkes scharf negativ. Da die Kirche in einer solchen Kreativität eine Manifestation „heidnischer“, „sündiger“, „nicht dem christlichen Geist entsprechender“ Volkstätigkeit sah, suchte sie beharrlich nach ihrem Verbot und verfolgte die direkten Sprecher und Träger der Musikkultur des Volkes – Volkssänger – streng und Tänzer (Mimen und Histrion).
Zahlreiche gegen Volkssänger und -schauspieler gerichtete Kirchenerlasse sind erhalten. Die Volkskunst, die diese Sänger und Schauspieler repräsentierten, hatte einen ausgesprochen antifeudalen Charakter und war für die herrschende Klasse gefährlich. Deshalb verfolgte ihn die Kirche unermüdlich. Deshalb erklärte Alcuin, dass "ein Mann, der Histrionen, Pantomimen und Tänzer in sein Haus lässt, nicht weiß, welche große Menge unreiner Geister ihnen folgt." Karl der Große wiederum verfolgte diese Personen unter Verweis auf die Zahl der „Entehrten“ und verbot den Vertretern des Klerus kategorisch, „Falken, Habichte, Hundemeute und Possenreißer“ mit sich zu führen. Derselbe Geist war von zahlreichen Kirchenratsbeschlüssen durchdrungen. Die Vitalität des Volksliedes und der volkstümlichen Schauspielkunst erwies sich jedoch als unwiderstehlich.
Volkskunst existierte auch im Bereich der bildenden und angewandten Kunst, obwohl letztere völlig den Interessen der Kirche untergeordnet waren und das Talent der Volkshandwerker in den Dienst der herrschenden Klasse der Feudalherren gestellt wurde. Es sind verschiedene kunstvoll hergestellte Gegenstände erhalten geblieben, die der Dekoration von Kirchengebäuden dienten oder während des Gottesdienstes verwendet wurden (reich verzierte Glocken; Schreine, die der Aufbewahrung von Reliquien dienten, die mit Schnitzereien aus Holz oder Bein verziert waren; verschiedene kirchliche Geräte - Schalen, Kreuze und Leuchter aus Edelmetallen; aus Bronze gegossene Kirchentore usw.).
Unbekannte, aber geschickte Handwerker, die diese Objekte schufen, strebten zweifellos nach der größtmöglichen Befriedigung des Kirchengeschmacks und gingen bei ihrer Arbeit nicht über die Grenzen biblischer Traditionen hinaus. Die Bilder selbst trugen jedoch in einer Reihe von Fällen Spuren volkstümlichen Einflusses, der sich in einer realistischen Interpretation menschlicher Figuren, in der Verwendung volkstümlicher Ornamente und in der Darstellung verschiedener real existierender oder fabelhafter Tiere ausdrückte.
Der Einfluss der Volkskunst wirkte sich auch auf die Ausführung von Miniaturen, Kopfbedeckungen aller Art und Großbuchstaben aus, die Kirchenhandschriften schmückten. Miniaturen waren normalerweise farbig, ebenso wie Großbuchstaben, die oft entweder in Form von Fischen oder Tieren, dann in Form von Vögeln aller Art (Störche mit einer Schlange im Schnabel, Pfauen, Hähnen, Enten) dargestellt wurden in Form von besonderen Kombinationen von Blättern, Rosetten usw. "Tierornamentik" hat sich in der Volkskunst seit der fernen vorgeschichtlichen Vergangenheit erhalten. Die Volksverzierung in Form von Bandgeflechten war auch in klösterlichen Manuskripten weit verbreitet. Ebenso bezeugten gemusterte Stoffe (Teppiche, Kirchenbettdecken), dass der Einfluss der Volkskunst für diesen Zweig der angewandten Kunst nicht spurlos geblieben ist.
und viele barbarische Stämme waren über das weite Territorium des Römischen Reiches verstreut: Goten, Franken, Burgunder, Alemannen, Angelsachsen usw. Die Römer setzten die Deutschen zunehmend als Lohnsoldaten ein und siedelten sie an ihren Grenzen an. Im 5. Jahrhundert wurden die höchsten Ränge der römischen Magistrate von den Anführern der Barbarenstämme getragen, die die verbündeten Armeen Roms anführten, die ein Abkommen über den Übergang unter die Herrschaft Roms schlossen.
EINLEITUNG
Bei der Niedergang der kaiserlichen Macht, die immer größer werdende Unbeliebtheit der römischen Herrschaft schuf günstige Bedingungen für die Könige – Verbündete Roms, um ihre Macht auszudehnen, um ihre politischen Ansprüche zu befriedigen. Sie eigneten sich oft unter Bezugnahme auf die kaiserliche Ordnung die volle Macht an, erhoben Steuern von der lokalen Bevölkerung usw.
BEI Die Estgoten zum Beispiel, die 412 von Rom als ihre Föderierten in Aquitanien (Südfrankreich) angesiedelt wurden, erweiterten anschließend das Territorium ihres Königreichs Toulouse durch territoriale Eroberungen, die 475 vom römischen Kaiser anerkannt wurden. 507 wurde dieses Königreich von den Franken erobert. 476 wurde die Macht im Weströmischen Reich von einem der barbarischen Feldherren Odoacer ergriffen. Er wurde 493 von Theoderich I., dem Gründer des ostgotischen Königreichs, getötet, der seine alleinige Herrschaft über ganz Italien errichtete. Dieses Königreich fiel 555. Andere "Stammesstaaten" der Barbaren entstanden und wurden infolge blutiger Kriege, Bürgerkriege absorbiert.
F Wunden werden erstmals im 3. Jahrhundert n. Chr. In römischen Quellen erwähnt. Es war eine große Stammesunion, die sich aus mehreren älteren germanischen Stämmen zusammensetzte. Die Franken lebten am Unter- und Mittellauf des Rheins und an der Meeresküste entlang der Schelde. Im 3.–4. Jahrhundert griffen die Franken oft das römische Gallien auf der Suche nach neuen Siedlungsplätzen an. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts besetzten sie Toxandria (das Gebiet zwischen Maas und Schelde) und siedelten sich hier als Reichsföderierte an. Mitte des 5. Jahrhunderts dehnten die salischen Franken ihren Besitz nach Süden und Westen bis an die Somme aus. Aber eine besondere Rolle in Westeuropa sollten die salischen (Meeres-)Franken spielen, die Teil des germanischen Stammesbundes waren, der sich im 3. Jahrhundert an der nordöstlichen Grenze Galliens, einer Provinz des Römischen Reiches, entwickelt hatte. Die salischen Franken, angeführt von ihrem Anführer Chlodwig (481 - 511), schufen infolge siegreicher Kriege in Gallien, mal in Konfrontation, mal im Bündnis mit Rom, ein riesiges Reich, das sich um 510 vom mittleren Rhein bis hin erstreckte die Pyrenäen. Clovis, der sich als Vertreter des römischen Kaisers etabliert hat, wird Herrscher der Länder, Herrscher eines einzigen, nicht mehr Stammes-, sondern Territorialkönigreichs, und eliminiert die Führer - die Könige der Salic Franks sowie andere Franken Stämme und vereinte alle Franken unter seiner Herrschaft. Er erwirbt das Recht, seine eigenen Gesetze zu diktieren, Steuern von der lokalen Bevölkerung zu erheben usw. Bei der Eroberung Galliens brachen die Franken im Gegensatz zu den Westgoten, Ostgoten und anderen germanischen Stämmen, die in das Reich eindrangen, nie die Verbindungen zu ihrer Heimat in Deutschland, was gewährleistet war sie in V - Anfang des VI Jahrhunderts, ein ständiger Zustrom frischer Kräfte von hinter dem Rhein.
G Allia blieb jedoch lange Zeit im Schatten des Oströmischen Reiches (Byzanz). Erst im 8. Jahrhundert wurde dem fränkischen König Karl dem Großen der römische Kaisertitel verliehen. Dank des Einflusses Roms und der römisch-christlichen Kirche bewahrte Gallien trotz geografischer Zersplitterung über die Jahrhunderte eine Art Einheit und wurde im Laufe eines langen Evolutionsprozesses zu jenem Franken, das zum Stammvater des zukünftigen Frankreich wurde und Deutschland, sowie die territoriale Grundlage der Entwicklung der westlichen christlichen Zivilisation.
Und Die Geschichte des fränkischen Staates erlaubt es uns, die Entwicklung der feudalen Verhältnisse von den Anfängen bis zu ihrer Vollendung zu verfolgen. Die wichtigsten Informationen über das Gesellschaftssystem der Franken gibt uns die sogenannte „Salic Truth“ („Lex Salica“) – eine Sammlung alter Gerichtsbräuche der Franken. Diese Sammlung wurde vermutlich zu Beginn des 6. Jahrhunderts zusammengestellt, d.h. während des Lebens (und möglicherweise im Auftrag) von Clovis. Der römische Einfluss war hier viel weniger ausgeprägt als bei anderen barbarischen Wahrheiten und findet sich hauptsächlich in äußeren Merkmalen: der lateinischen Sprache, Geldbußen in römischen Geldeinheiten.
« Mit Alicheskaya Pravda“ ist in Titel (Kapitel) unterteilt. Eine Vielzahl von Titeln sieht Strafen (Bußgelder) für alle Arten von Diebstählen vor. Von besonderem Interesse sind uns aber gerade im Rahmen dieser Arbeit Titel, die die wirtschaftliche und soziale Struktur der Franken beleuchten.
« Mit„alic truth“ gibt in mehr oder weniger reiner Form das wahre Bild des Lebens der Salic Franks wieder. Aber es enthält Informationen aus späterer Zeit (während des 6. bis 9. Jahrhunderts fügten die fränkischen Könige der Salic Truth immer mehr hinzu). Generell lässt sich der Übergangsprozess der Franken vom Stammeswesen zur Feudalisierung nachvollziehen.
KAPITEL 1. MERKMALE DER FREIEN WIRTSCHAFT NACH DER SALIC Pravda.
X Die Wirtschaftsstruktur der Franken war viel höher entwickelt als die der alten Germanen, die von Tacitus beschrieben wurde. In der Landwirtschaft, die im 6. Jahrhundert die Hauptbeschäftigung der Franken war, herrschte offenbar bereits die Zweifelderwirtschaft vor, die periodische Umverteilung von Ackerland, die die Entwicklung intensiverer Formen der Landwirtschaft behinderte, hörte auf. Die folgenden Getreidekulturen überwogen - Roggen, Weizen, Hafer, Gerste. Hülsenfrüchte und Flachs waren bei den Franken weit verbreitet. Gärten, Obst- und Weingärten wurden aktiv bewirtschaftet. Ein Pflug mit einer eisernen Pflugschar, die den Boden gut auflockert, ist weit verbreitet. Für die Bodenbearbeitung wurden zwei- oder dreimal Pflügen, Eggen, Jäten von Feldfrüchten und Dreschen mit Dreschflegeln verwendet. In der Landwirtschaft werden verschiedene Arten von Zugtieren verwendet: Bullen, Maultiere, Esel. Häufig wurden Wassermühlen verwendet. Auch die Viehzucht entwickelte sich bedeutend. Die Franken züchteten in großer Zahl Rinder und Kleinvieh – Schafe, Ziegen, aber auch Schweine und verschiedene Geflügelarten. Zu den üblichen Aktivitäten gehören Jagd, Fischfang, Imkerei.
P Der Fortschritt in der Wirtschaft war nicht nur das Ergebnis der inneren Entwicklung der fränkischen Gesellschaft, sondern auch das Ergebnis der Übernahme fortschrittlicherer landwirtschaftlicher Methoden durch die Franken und noch früher durch die Westgoten und Burgunder in Südgallien das eroberte römische Gebiet.
BEI In dieser Zeit verfügten die Franken über ein voll entwickeltes bewegliches Privateigentum. Zum Beispiel verhängt „Salicheskaya Pravda“ hohe Geldstrafen für den Diebstahl von Brot, Vieh, Geflügel, Booten, Netzen. Aber Salicheskaya Pravda weiß immer noch nichts über Privateigentum an Land, mit Ausnahme von persönlichen Grundstücken.
UND Analyse der Bestimmungen der barbarischen Prawda, Vergleich der Höhe der Geldbußen, die für die Verletzung der Eigentumsrechte an einzelnem Land (innerhalb des Haushalts - Ackerland (Ernte), Garten, Weinberg) von einer bestimmten Person erhoben wurden, A. I. Neusykhin in seinem Die Studie kommt zu dem Schluss, dass "... die salische Wahrheit die Rechte jedes Haushalts auf seine Ernte oder sein Ackerfeld am besten schützt. Das ist ganz natürlich, denn es ist für die Mitglieder eines landwirtschaftlichen Stammes von größtem Wert. Allerdings erklärt sich der Schutz der Rechte an Ackerfläche und Ernte offenbar nicht nur durch deren höheren wirtschaftlichen Wert, sondern auch durch die größere Gewissheit ihres Eigentums. Nicht ohne Grund bestraft die salische Wahrheit die bloße Verletzung der Grenze eines Ackerfeldes ... und verhängt verschiedene Geldstrafen für verschiedene Stadien seiner Entwicklung durch den Eindringling ... ". Der Eigentümer des Hauptlandfonds jedes Dorfes waren alle seine Einwohner - freie Kleinbauern, die die Gemeinde bildeten.
Ö Später stellte sich jedoch das Problem der Entstehung von Allod - frei veräußerbarem Landbesitz, dessen Erbrechte in der Zeit von König Chlodwig auf Männer (Söhne und Brüder) übertragen wurden, und in der Zeit von König Chilperic, so sein Edikt - auch an Frauen.
BEI Im Zusammenhang mit der Situation (Salicheskaya Pravda: Titel LIX, § 5), die die Vererbung von Land durch die männliche Linie charakterisiert, erklärt A. I. Neusykhin Folgendes: Verbindung, es ist zunächst wichtig, dass im Kapitel „Über Allods “, die diese Reihenfolge festlegt, wird die Frage, wer das Land in Ermangelung von Söhnen des verstorbenen Haushälters erhalten hat, nicht einmal gestellt. Offensichtlich stellten sich solche Fragen vor der Festsetzung des Erbrechts der Söhne überhaupt nicht in Bezug auf Immobilien, und nachdem ihnen dieses Recht gewährt wurde, traten sie nicht in Bezug auf verfallene Grundstücke auf. Zuvor gab es überhaupt kein Konzept der Landvererbung, und als es auftauchte, behielt die alte Tradition ihre Kraft in Bezug auf verfallene Grundstücke bei. Das Institut der Übertragung von Immobilien durch Erbschaft ... steckt noch in den Kinderschuhen, daher ist seine Wirkung auf den Kreis der direkten männlichen Nachkommen beschränkt. Somit stellt die Entstehung der Allod in Form der Erbschaft von Immobilien durch Söhne den ersten großen Schritt dar, um das Eigentum einzelner Haushalte an Land von dem gemeinsamen Eigentum der Villa (Dorf) zu trennen.
Bei Wenig später wurde der Prozess der Grundbesitzzuteilung teilweise durch das Edikt des Enkels von Clovis festgelegt, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Verbindung zwischen Gemeinde und Stamm in dieser Hinsicht zu beseitigen. „Das Edikt von Chilperic ... dehnt das Erbrecht auf Grundstücke auf die Töchter, Brüder und Schwestern des Verstorbenen aus und hebt gleichzeitig die Ansprüche der Nachbarn auf Verfall von Grundstücken auf, er formalisiert damit den Prozess der Zuweisung einzelner Familien Eigentum, das lange vorher begann und sich bereits in der salischen Wahrheit widerspiegelt. Die Annullierung von Ansprüchen der Nachbarn ist ganz natürlich: Sie könnten nur als gerechtfertigt angesehen werden, solange diese Nachbarn Verwandte waren; denn ihr Recht auf ein verfallenes Grundstück wurzelte in der Tatsache, dass zu der Zeit, als das Kapitel „Über Allods“ festgelegt wurde, das Recht, Land zu erben, nur Söhnen gewährt wurde, und daher das Land, in deren Abwesenheit, das Land nicht hatte überhaupt Objekt des individuellen Erbes innerhalb der Familie geworden sind und in der Familie verblieben sind“ .
T So „… fanden im 6. Jahrhundert große Veränderungen in der inneren Struktur der fränkischen Gesellschaft im Vergleich zu Clovis statt. Mit der weiteren Ausweitung der Stammesbeziehungen entstand privates Landeigentum, das bei der Bevölkerung der von den Franken eroberten gallo-römischen Gebiete seit langem bestand.
W Die Eroberung beschleunigte den Übergangsprozess der fränkischen Gesellschaft selbst vom angestammten Grundbesitz zum Privatbesitz. Das Land wurde entfremdet und nicht nur durch die männliche, sondern auch durch die weibliche Linie vererbt; das Recht der Verwandten, Eigentum zu vererben, wurde zerstört; Letzteres begann an seitliche Verwandte überzugehen, und in Ermangelung solcher in die Schatzkammer (Kapitular II, 1). Aus der Stammesgemeinschaft wurde eine benachbarte - die Marke, deren Mitglieder das Recht hatten, das Anwesen und die Ackerflächen zu besitzen, aber gemeinsam genutzte Wiesen, Wälder, Gewässer, die als Eigentum der Marke galten.
KAPITEL 2. FORM DER FAMILIE DER FRANKEN.
BEI In der ersten Zeit nach der Eroberung Galliens waren die fränkischen Gemeinden nach dem alten Text der Salischen Wahrheit Siedlungen sehr unterschiedlicher Größe, die aus verwandten Familien bestanden. In den meisten Fällen handelte es sich um große (patriarchalische) Familien, zu denen nahe Verwandte gehörten, normalerweise aus drei Generationen - der Vater und die erwachsenen Söhne mit ihren Familien, die gemeinsam den Haushalt führten. Mehrere eng miteinander verbundene Haushalte bildeten eine Siedlung - eine landwirtschaftliche Gemeinschaft.
H kleine einzelne Familien tauchten bereits auf. Häuser und Hausgrundstücke befanden sich im Privatbesitz einzelner Groß- oder Kleinfamilien, Acker- und teilweise Wiesengrundstücke befanden sich in deren erblicher Eigennutzung. Diese Schrebergarten waren normalerweise von einem Zaun, Flechtwerk umgeben und wurden durch hohe Geldstrafen vor Eindringlingen und Übergriffen geschützt. Das Recht zur freien Verfügung über erbliche Zuteilungen stand jedoch nur dem Gesamtkollektiv der Gemeinde zu. Ende des 5. und zu Beginn des 6. Jahrhunderts steckte der individuelle Familienbesitz an Grund und Boden bei den Franken noch in den Kinderschuhen und nahm Übergangsformen zum Privatbesitz an (siehe Kapitel 1 dieser Arbeit).
D Um die Natur zu verstehen und die Form der sozialen Vereinigungen unter den Franken der von uns beschriebenen Periode zu entdecken, ist es notwendig, sich den Entscheidungen der Salic Pravda zuzuwenden, obwohl sie indirekt die Form der sozialen Formationen der Franken bezeugen .
H Zum Beispiel war für Blutsbande im Fall von Blutfehden ein bestimmtes Merkmal charakteristisch, wenn die Angehörigen des Ermordeten Rache an den bedeutendsten Mitgliedern der Familie des Täters nahmen und nicht am Mörder selbst. Mit dem Zerfall der Stammesbeziehungen hat sich die Situation völlig verändert. Durch die Gelegenheit, den Schutz des Königs und seines Gefolges zu erhalten, begannen einzelne Familien, die Teil der Blutsgemeinschaft waren, durch die gegenseitige Verantwortung zwischen Verwandten belastet zu werden und versuchten, sich davon zu befreien. Wahrscheinlich wurde dieses Recht in erster Linie von wohlhabenderen Verwandten genutzt, die nicht für die verarmten Sippenmitglieder verantwortlich sein wollten. In diesem Fall genügt es, an den Titel LX „Salic Truth“ zu erinnern, der die Zeremonie des „Verwandtschaftsverzichts“ beschreibt. Diejenigen, die mit der Familie und den Verwandten brechen wollten, erschienen zur „Gerichtssitzung vor dem Tungin“, brachen dort „drei Äste im Maß einer Elle“ und verstreuten die Fragmente in vier Richtungen und erklärten, „dass er die Treue abschwört, Erbschaft und alle Konten mit ihnen. Und wenn später einer seiner Verwandten getötet wird oder stirbt, sollte er sich auf keinen Fall am Erbe oder an der Zahlung von Vira beteiligen, und sein eigenes Erbe sollte in die Staatskasse gehen.
« Zu Die Haftung für die Zahlung von Vira für den Mord an einem Verwandten wird sehr gut im Titel LVIII der salischen Wahrheit beschrieben – „Über eine Handvoll Erde“.
« E Wenn jemand - so lesen wir in diesem Titel - einer Person das Leben nimmt und nach Übergabe des gesamten Eigentums nicht in der Lage ist, die gesetzlich geschuldeten Beträge zu zahlen, muss er 12 Geschworene vorlegen (die das beschwören). weder auf der Erde noch unter der Erde hat er mehr als das, was er bereits gegeben hat. Und dann muss er sein Haus betreten, eine Handvoll Erde aus vier Ecken sammeln, auf der Schwelle stehen, sein Gesicht ins Haus drehen und diese Erde mit seiner linken Hand über seine Schultern auf den werfen, den er für seinen nächsten Verwandten hält. Wenn der Vater und die Brüder bereits bezahlt haben, muss er das gleiche Land alleine werfen, dh auf die drei nächsten Verwandten von Mutter und Vater. Dann muss er in (einem) Hemd, ohne Gürtel, ohne Schuhe, mit einem Pflock in der Hand über den Flechtzaun springen, und diese drei (Verwandten mütterlicherseits) müssen die Hälfte dessen bezahlen, was nicht ausreicht, um die Vira zu bezahlen gefolgt per Gesetz. Dasselbe sollten die anderen drei tun, die väterlicherseits verwandt sind. Wenn einer von ihnen zu arm ist, um den Anteil zu zahlen, der auf ihn fällt, muss er seinerseits eine Handvoll Land auf einen der Wohlhabenderen werfen, damit er alles nach dem Gesetz bezahlen kann. Wenn dieser aber nichts hat, um alles zu bezahlen, dann muss ihn der freigesprochene Mörder zur Gerichtsverhandlung vorführen und ihn sodann für vier Sitzungen auf Kaution nehmen. Wenn aber niemand die Zahlung der Vira garantiert, also die Entschädigung für das, was er nicht bezahlt hat, dann muss er die Vira mit seinem Leben bezahlen.
Und Aus dem zitierten Text geht hervor, dass neben dem Vater und den Brüdern des Mörders „seine drei engsten Verwandten von Mutter und Vater“, also offensichtlich Mitglieder der Blutsgemeinschaft, die wir die „große Familie“ nennen, teilnehmen die Zahlung der Vira für den Mord. Es ist davon auszugehen, dass sich zum Zeitpunkt der Herausgabe der Salic Pravda der Kreis der für die Zahlung der Vira verantwortlichen Verwandten erheblich verengt hatte: Was zuvor auf den gesamten Clan fiel, fiel nun auf seine Unterteilung - eine große Familie. Einerseits führte eine solche Einengung des Kreises der für den Mörder Verantwortlichen und andererseits eine Vermögensdifferenzierung innerhalb der Blutsgemeinschaft dazu, dass die Vira-Zahlungspflicht für die dazu verpflichteten Angehörigen sehr erschwert wurde So.
BEI In einem anderen Titel der Salic Pravda, „Über die Siedler“ („Salic Truth“: Titel XLV), der in direktem Zusammenhang mit dem obigen Titel steht, kann man die Präsenz von mehr fraktionierten (kleinen) Formationen im Umfeld der fränkischen Gesellschaft erkennen: „Wenn jemand von einer Villa (Dorf) in eine andere umziehen will und ein oder mehrere Bewohner der Villa ihn aufnehmen wollen, aber mindestens einer gegen die Umsiedlung ist, hat er kein Niederlassungsrecht dort. Lässt sich der Fremde dennoch im Dorf nieder, kann der Demonstrant rechtliche Schritte gegen ihn einleiten und ihn gerichtlich ausweisen. Die „Nachbarn“ fungieren hier also als Mitglieder der Gemeinschaft, die alle Landverhältnisse in ihrem Dorf regeln. Die Entwicklung der Eigentumsdifferenzierung unter den Verwandten führt zu einer Schwächung der Stammesbindung, zur Auflösung von Großfamilien in kleine Einzelfamilien.
B Darüber hinaus hat Gratsiansky N.P. auf der Grundlage einer Analyse des obigen Titels und anderer („Salic Truth“, Titel: XIV, § 6; XLII, § 5; III, § 5; XLV), sowie auf der Grundlage von a Studie indirekter Daten, die in den Dekreten der Salic Pravda enthalten sind, die die Anzahl der Rinder beim Diebstahl der einen oder anderen Herde nennen, heißt es eindeutig: „Es muss angenommen werden, dass sich die Franken wie die alten Germanen niedergelassen haben Blutsverwandtschaft - große Familien. Die Ansiedlung einer so großen Familie allein konnte keine sehr große Ansiedlung sein. Und da die Ausdehnung dieser Siedlung wegen des Waldreichtums oft für ein bestimmtes Gebiet unmöglich war, wurden andere kleine Siedlungen in einem, zwei, höchstens - mehreren Haushalten davon getrennt, irgendwo in der Nachbarschaft angesiedelt: in der Nähe einer Waldlichtung, in der Nähe eines Waldsees, im Tal eines Baches oder Flusses ... Manchmal könnte eine solche Siedlung den Charakter einer Art Bauernhof haben - die Siedlung einer einzelnen Familie mit einem wohlhabenden Franken ... die eine relativ große Wirtschaft führt.
Mit Daher können wir auf der Grundlage des Vorstehenden mit Sicherheit schlussfolgern, dass die fränkische Gesellschaft in dem Zeitraum, den wir betrachten, ein sozialer Zusammenschluss verwandter Familien – Großfamilien – war. Gleichzeitig fixiert Salic Pravda aber auch die Situation unter den Franken, die darauf hindeutet, dass die angedeutete Formation - eine große Familie - aufgrund ihres begonnenen Zerfalls in kleine Einzelfamilien nur teilweise überlebt hat.
KAPITEL 3. DIE FRANKISCHE GEMEINSCHAFT NACH DER "SALIC Pravda".
Ö Die Bestimmung der Eigentumsverhältnisse an Immobilien (insbesondere Land) in der fränkischen Gesellschaft des 5.–6 in den damaligen Franken.
Ö Gemeinschaft nach „salischer Wahrheit“ war die Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen Organisation der fränkischen Gesellschaft. Im 5. - 6. Jahrhundert stellte es eine Übergangsstufe von einer landwirtschaftlichen Gemeinde (es bestand Kollektivbesitz aller Ländereien, einschließlich Ackerflächen großer Familien) zu einer benachbarten Markgemeinde dar (es dominiert der Besitz einzelner Kleinfamilien auf Kleingartenland). unter Beibehaltung des kommunalen Eigentums an den Hauptfonds Wälder, Wiesen, Ödland, Weiden usw.).
D um die Eroberung Galliens war der Grundbesitzer bei den Franken der Clan, der sich in einzelne Großfamilien auflöste (das war die landwirtschaftliche Gemeinde). Lange Feldzüge während der Zeit der Eroberung und Besiedlung des neuen Territoriums beschleunigten den im 2.-4. Laut F. Engels „… wurde die Sippe in der Gemeinschaftsmarke aufgelöst, in der jedoch noch oft Spuren ihrer Herkunft aus den Verwandtschaftsverhältnissen der Gemeinschaftsmitglieder sichtbar sind.“
BEI Die „Salic Truth“ zeichnet die Stammesbeziehungen deutlich nach: Auch nach der Eroberung bestanden viele Gemeinschaften größtenteils aus Verwandten, die im Leben eines freien Frankens eine bedeutende Rolle spielten. Sie bestanden aus einer engen Vereinigung, deren Mitglieder in einer bestimmten Reihenfolge verpflichtet waren, vor Gericht als Geschworene (Eid zugunsten eines Verwandten) aufzutreten. Bei einem Frankenmord waren nicht nur die Angehörigen des Ermordeten oder Mörders, sondern auch deren nächste Angehörige, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, an der Entgegennahme und Auszahlung des Wergeldes beteiligt.
H aber gleichzeitig zeigt Salic Truth bereits den Prozess der Zersetzung und des Niedergangs von Stammesbeziehungen. Unter den Mitgliedern der Gattung wird eine Eigenschaftsschichtung skizziert. Der Titel „Über eine Handvoll Land“ sieht den Fall vor, dass ein verarmter Franken seinem Verwandten nicht bei der Zahlung des Wergelds helfen kann: In diesem Fall muss er „jemand aus den Wohlhabenderen eine Handvoll Land zuwerfen, damit er alles bezahlt laut Gesetz." Auf Seiten der wohlhabenderen Mitglieder besteht der Wunsch, die verwandte Gewerkschaft zu verlassen. Titel LX von Salic Pravda beschreibt ausführlich das Verfahren zum Verzicht auf die Verwandtschaft, bei dem eine Person öffentlich in einer Gerichtssitzung auf die Zugehörigkeit, die Teilnahme an der Zahlung und dem Erhalt von Wergeld, das Erbe und andere Beziehungen zu Verwandten verzichten muss. Im Falle des Todes einer solchen Person fällt ihr Erbe an die königliche Schatzkammer.
« BEI Ende des 6. Jahrhunderts wird aus der erblichen Zuteilung freier Franken ein vollständiger, frei veräußerbarer Grundbesitz kleiner Einzelfamilien - Allod. Früher bezeichnete dieser Begriff in der Salic Pravda jede Art von Erbschaft: Allod wurde damals in Bezug auf bewegliches Vermögen als Eigentum verstanden, in Bezug auf Land jedoch nur als erbliche Zuteilung, über die nicht frei verfügt werden kann. Das bereits oben erwähnte Edikt des Königs Hilperich, das das individuelle Erbrecht der Gemeindemitglieder erheblich erweitert hatte, entzog der Gemeinde im Wesentlichen das Recht, über das Kleingartenland ihrer Mitglieder zu verfügen. Es wird Gegenstand von Testamenten, Schenkungen und dann Verkauf und Kauf, d.h. wird Eigentum der Gemeinschaft. Diese Veränderung war grundlegender Natur und führte zu einer weiteren Vertiefung des Eigentums und einer sozialen Differenzierung in der Gemeinschaft, zu ihrer Auflösung.
«… BEI historische Bewegung Westeuropas, alt und neu, die Zeit der landwirtschaftlichen Gemeinschaft ist eine Übergangszeit vom Gemeineigentum zum Privateigentum. Mit der Entstehung der Allod vollzieht sich die Umwandlung der landwirtschaftlichen Gemeinde in eine Nachbar- oder Territorialgemeinde, meist Gemeindemark genannt, die nicht mehr aus Verwandten, sondern aus Nachbarn besteht. Jeder von ihnen ist das Oberhaupt einer kleinen individuellen Familie und fungiert als Eigentümer seiner Zuteilung - allod. Die Rechte der Gemeinschaft erstrecken sich nur auf ungeteilte Ländereien (Wälder, Ödland, Sümpfe, öffentliche Weiden, Straßen usw.), die weiterhin in der kollektiven Nutzung aller ihrer Mitglieder stehen. Bis zum Ende des 6. Jahrhunderts gehen oft auch Wiesen- und Waldflächen in allodialen Besitz einzelner Gemeindemitglieder über.
Ö Gemeinschaft - das Kennzeichen, das sich unter den Franken Ende des 6. Jahrhunderts entwickelte, ist die letzte Form kommunalen Grundbesitzes, innerhalb dessen die Zersetzung des primitiven Gemeinschaftssystems abgeschlossen ist und feudale Verhältnisse geboren werden.
FAZIT
H Abschließend ist folgendes festzuhalten. Der Prozess der Feudalisierung unter den Franken, der sich bereits vor dem Umzug in eine neue Heimat abgezeichnet hatte, beschleunigte sich durch die Eroberung Galliens stark.
BEI Im 5. - 6. Jahrhundert unterhielten die Franken noch kommunale Stammesbindungen, Ausbeutungsbeziehungen unter den Franken selbst waren nicht entwickelt, und der fränkische Dienstadel, der sich während der Feldzüge von Chlodwig zur herrschenden Elite formte, war nicht zahlreich.
Zu Jeder neue Feldzug vermehrte den Reichtum des fränkischen Militärstammadels. Bei der Aufteilung der militärischen Beute erhielt sie die besten Ländereien, eine beträchtliche Anzahl von Kolonnen, Vieh usw. Der Adel erhob sich über die einfachen Franken, obwohl letztere weiterhin persönlich frei blieben und zunächst nicht einmal eine verstärkte wirtschaftliche Unterdrückung erlebten. Sie ließen sich in ihrer neuen Heimat in Landgemeinden (Marken) nieder. Mark galt als Eigentümer des gesamten Landes der Gemeinde, das Wälder, Ödland, Wiesen und Ackerland umfasste. Mit der weiteren Ausweitung der Stammesbeziehungen entstand privates Landeigentum, das bei der Bevölkerung der von den Franken eroberten gallo-römischen Gebiete seit langem bestand.
G Die Allo-Römer wiederum befanden sich in der Position einer abhängigen Bevölkerung, die um ein Vielfaches größer war als die Franken. Aber die Einheit der Interessen markierte den Beginn einer allmählichen Annäherung zwischen dem fränkischen und dem gallo-römischen Adel, wobei ersterer dominant wurde. Und das machte sich besonders bei der Bildung einer neuen Regierung bemerkbar. Die ehemalige Stammesorganisation konnte die notwendigen Kräfte und Mittel zur Verwaltung des besetzten Landes nicht bereitstellen. Die Institutionen des Stammessystems beginnen einer neuen Organisation zu weichen, die von einem Militärführer angeführt wird – dem König und einer ihm persönlich ergebenen Truppe. Der König und sein Gefolge entscheiden tatsächlich über die wichtigsten Fragen des Lebens des Landes, obwohl Volksversammlungen und einige andere Institutionen des früheren Systems der Franken noch erhalten sind. Es entsteht eine neue „Behörde“, die nicht mehr direkt mit der Bevölkerung zusammenfällt. Die Genehmigung der neuen Staatsgewalt war mit der Einführung der territorialen Einteilung der Bevölkerung verbunden. Das von den Franken bewohnte Land wurde in Bezirke aufgeteilt, die aus kleineren Einheiten - "Hunderten" - bestanden. Die Regierung der Bevölkerung, die in Distrikten und Hunderten lebte, wird besonderen Treuhändern des Königs übergeben.
BEI gleichzeitig werden die Franken zum Katalysator sozialer Differenzierung Sklave. Ein Sklave galt im Gegensatz zu einem freien Gemeinschaftsfranken als Sache. Sein Diebstahl kam dem Diebstahl eines Tieres gleich. Die Heirat eines Sklaven mit einem Freien brachte den Freiheitsverlust des Letzteren mit sich.
« Mit alic truth“ weist auch auf das Vorhandensein solcher sozialer Gruppen unter den Franken hin wie: Adel dienen, freie Franken(Gemeinde) und halbfreie Litas. Die Unterschiede zwischen ihnen waren weniger wirtschaftlicher als sozio-rechtlicher Natur. Ein wichtiger Faktor, der die rechtlichen Unterschiede der Franken beeinflusste, war die Zugehörigkeit zum königlichen Dienst, zum königlichen Kader, zum entstehenden Staatsapparat. Am deutlichsten kamen diese Unterschiede im System der Geldentschädigung zum Ausdruck, das dem Schutz des Lebens, des Eigentums und anderer Rechte des Einzelnen diente.
H Neben Sklaven gab es eine besondere Kategorie von Personen - halbfreie Litas, deren Leben von einem halben freien Wergeld auf 100 Solidi geschätzt wurde. Lit war ein niederer Einwohner der fränkischen Gemeinde, der von seinem Herrn persönlich und materiell abhängig war. Litas konnte Vertragsbeziehungen eingehen, ihre Interessen vor Gericht verteidigen und zusammen mit ihrem Meister an Feldzügen teilnehmen. Lit konnte wie ein Sklave von seinem Herrn befreit werden, der jedoch sein Eigentum hatte. Für ein Verbrechen wurde dem Litu in der Regel die gleiche Strafe wie für einen Sklaven zugesprochen, zum Beispiel die Todesstrafe für die Entführung einer freien Person.
BEI Platz mit der Tatsache, wie bereits oben erwähnt, "Salicheskaya Pravda" zeugt von der ausreichenden Stärke der kommunalen Ordnungen, des kommunalen Eigentums an Feldern, Wiesen, Wäldern, Ödland, der Gleichberechtigung der kommunalen Bauern bei der kommunalen Landzuteilung. Das eigentliche Konzept des Privateigentums an Land fehlt in der Salic Pravda. Es legt nur den Ursprung der Zuteilung fest und sieht das Recht vor, die Zuteilung durch Erbschaft durch die männliche Linie zu übertragen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Allod jedoch zur ursprünglichen Form des privaten feudalen Landbesitzes. Allod – der veräußerliche, vererbbare Grundbesitz der freien Franken – entstand im Prozess der Zersetzung des kommunalen Grundbesitzes. Sie begründete einerseits die Entstehung des patrimonialen Landbesitzes der Feudalherren und andererseits den von ihnen abhängigen Landbesitz der Bauern.
Mit das Aufeinanderprallen der Kommunalordnungen der Franken und der spätrömischen Privateigentumsordnungen der Gallo-Römer, das Nebeneinander und Zusammenwirken so unterschiedlicher Gesellschaftsstrukturen beschleunigte die Entstehung neuer, feudaler Verhältnisse.
1.
Neusykhin A. I. Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühen feudalen Gesellschaft in Westeuropa im 6. – 8. Jahrhundert. Kapitel 2. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1956, p. 103
2.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky. Titel: IX; XVI, § 3; XXII, § 1; XXVII, § 15.
3.
Ebenda, Titel XXVII, § 7.
4.
Ebenda, Titel XXVII, § 8.
5.
Ebenda, Titel XXVII, § 7.
6.
Ebd., Titel VII, § 4: Anhang 8; XXVII, § 6 (Ergänzungen - 3,4,5,6).
7.
Ebd., Titel VII, § 4: Anhang 9; X, § 2: Anlage 4; XXVII (§ 13, § 14); IX, § 5: Anlage 2.
8.
Ebenda, Titel XXVII, § 25: Anhang 9; X, § 2: Anlage 4.
9.
Ebenda, Titel XXII, § 1: Anhang 2.
10.
Ebenda, Titel III.
11.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky. Titel IV.
12.
Ebenda, Titel V.
13.
Ebenda, Titel II.
14.
Ebenda, Titel VII (§ 3, § 4).
15.
Ebd., Titel: VI, § 1; VII (§1, §2, §3); XXIII.
16.
Ebd., Titel: XXI; XXVII (§ 20, § 21).
17.
Ebenda, Titel VIII.
18.
Neusykhin A.I. Freiheit und Eigentum in barbarischen Wahrheiten. Kapitel I. - In dem Buch: Neusykhin A. I. Probleme des europäischen Feudalismus. M.: Nauka, 1974, p. 54.
19.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky. Titel LIX, § 5.
20.
Ebenda, Kapitular V (Edikt des Souveränen Königs Chilperich), § 3.
21.
Neusykhin A.I. Freiheit und Eigentum in barbarischen Wahrheiten. Kapitel I. - In dem Buch: Neusykhin A. I. Probleme des europäischen Feudalismus. M.: Nauka, 1974, p. 61.
22.
Neusykhin A.I. Freiheit und Eigentum in barbarischen Wahrheiten. Kapitel I. - In dem Buch: Neusykhin A. I. Probleme des europäischen Feudalismus. M.: Nauka, 1974, p. 68-69.
23.
Gratsiansky N. P. Über die materiellen Strafen barbarischer Wahrheiten. - In dem Buch: Gratsiansky N.P. Aus der sozioökonomischen Geschichte des westeuropäischen Mittelalters. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1960, p. 297-298.
24.
Gratsiansky N. P. Über die materiellen Strafen barbarischer Wahrheiten. - In dem Buch: Gratsiansky N.P. Aus der sozioökonomischen Geschichte des westeuropäischen Mittelalters. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1960, p. 292-293.
25.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky. Titel: II, § 14 - 16; II, § 7; III, § 5; XXXVIII (§ 3, § 4).
26.
Gratsiansky N. P. Zur Interpretation des Begriffs "Villa" in "Salic Truth". - In dem Buch: Gratsiansky N. P. Aus der sozioökonomischen Geschichte des westeuropäischen Mittelalters. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1960, p. 332.
27.
Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. - Marx K., Engels F. Werke. T. 21, p. 150.
28.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky. Titel LVIII.
29.
Geschichte des Mittelalters (in zwei Bänden). - T. I. - Lehrbuch. - Hrsg. S. D. Skazkina und andere - Ed. 2., überarbeitet. - M.: "Higher School", 1977, Kapitel 4: § 1 (elektronische Version).
30.
Marx K. Entwurf der Antwort auf den Brief von V. I. Zasulich. - Marx K., Engels F. Werke. T. 19, p. 404.
LITERATURVERZEICHNIS
1.
Die Weltgeschichte. T. 3. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1957.
2.
Gratsiansky N. P. Über die materiellen Strafen barbarischer Wahrheiten. - In dem Buch: Gratsiansky N. P. Aus der sozioökonomischen Geschichte des westeuropäischen Mittelalters. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1960.
3.
Gratsiansky N. P. Zur Interpretation des Begriffs "Villa" in "Salic Truth". - In dem Buch: Gratsiansky N. P. Aus der sozioökonomischen Geschichte des westeuropäischen Mittelalters. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1960.
4.
Geschichte des Mittelalters (in zwei Bänden). - T. I. - Lehrbuch. - Hrsg. S. D. Skazkina und andere - Ed. 2., überarbeitet. - M .: "Higher School", 1977 (elektronische Version).
5.
Geschichte des Mittelalters: Lehrbuch für Schüler. Fälschung. päd. Institute - Ed. N. F. Kolesnitsky. – M.: Aufklärung, 1980.
6.
Marx K. Entwurf der Antwort auf den Brief von V. I. Zasulich. - Marx K., Engels F. Werke. T. 19, p. 402 - 404, 417 - 419.
7.
Neusykhin A. I. Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühen feudalen Gesellschaft in Westeuropa im 6. – 8. Jahrhundert. M.: Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, 1956, Kap. einer; CH. 2, § 1; CH. 3.
8.
Neusykhin A.I. Freiheit und Eigentum in barbarischen Wahrheiten. Kapitel I. - In dem Buch: Neusykhin A. I. Probleme des europäischen Feudalismus. Moskau: Nauka, 1974.
9.
Workshop zur Geschichte des Mittelalters / Comp. Abramson M. L., Slivko S. A., Freidenberg M. M., 2. Aufl. M.: Aufklärung, 1971, p. 43-61.
10.
Salische Wahrheit (Lex Salica). Versöhnt nach der Ausgabe: Salische Wahrheit. M.: Vorbildlicher Typ. Sie. Zhdanova, 1950. (Nach Lenin benanntes Moskauer Staatliches Pädagogisches Institut. Wissenschaftliche Notizen, Bd. LXII). Übersetzung von N. P. Gratsiansky (elektronische Version).
11.
Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. - Marx K., Engels F. Werke. T. 21, p. 150-151.