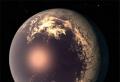Was ist ein deklarativer imperativer fragesatz. Aussage-, Frage- und Imperativsätze
Je nach Zweck der Aussage sind Sätze deklarativ, fragend und anregend.
Erzählsätze enthalten eine Botschaft über eine Tatsache der Realität, ein Phänomen, ein Ereignis usw., eine Beschreibung, sie drücken einen relativ vollständigen Gedanken aus, der auf einem Urteil basiert. Erzählsätze sind die häufigste Art von Sätzen, sie sind in Inhalt und Struktur sehr unterschiedlich und zeichnen sich durch eine relative Vollständigkeit des Gedankens aus, die durch eine bestimmte Erzähltonation vermittelt wird: eine Tonerhöhung bei einem logisch unterschiedenen Wort und eine ruhige Abnahme Ton am Ende des Satzes: Eine Person braucht ein Mutterland (M. Prishvin); Ich möchte frei von unnötigen Sorgen sein (V. Tendryakov); Stickiger Sommer vor den Fenstern (K. Simonov); Mit Stiefeln donnernd rannten sechs zum Haus (N. Ostrovsky); Kiefern werden jeden Tag frischer und jünger (I. Bunin).
Die Struktur eines Aussagesatzes hängt von seinem Inhalt ab. Wenn es in der Geschichte um die Handlung, den Zustand, die Bewegung von jemandem oder etwas geht, dann ist das Prädikat ein Verb: Grünes Rauschen kommt, summt ... (N. Nekrasov). Wenn ein Merkmal des Zeichens angegeben ist, ist das Prädikat nominell: Ruhige ukrainische Nacht (A. Puschkin).
Fragesätze werden Sätze genannt, die eine Frage zu etwas enthalten, das dem Sprecher unbekannt ist: Ist unsere Eberesche ausgebrannt und unter einem weißen Fenster zerbröckelt? (S. Yesenin); Was soll ich tun, Pjotr Jegorowitsch? (A. Ostrowski); Petschorin! Wie lange bist du schon hier? (M. Lermontow).
Die Mittel der Fragestellung sind:
- fragende Intonation - eine Erhöhung des Tons bei einem Wort, mit der die Bedeutung der Frage verbunden ist, zum Beispiel: Waren Sie an der Westfront? (K. Simonov) (vgl.: Waren Sie an der Westfront?; Waren Sie an der Westfront?);
- Wortstellung (normalerweise steht das Wort, mit dem die Frage verbunden ist, am Satzanfang): Möchtest du Wasser mit Eis? (W. Weresajew);
- Fragewörter - Fragepartikel, Adverbien, Pronomen: Wäre es nicht besser, wenn Sie selbst hinter diese kämen? (A. Puschkin); Gibt es wirklich keine Frau auf der Welt, der Sie etwas als Andenken hinterlassen möchten? (M. Lermontow); Warum stehen wir hier? (A. Tschechow).
Plädoyerangebote zielen darauf ab, Informationen über die Gesamtsituation zu erhalten. Die Antwort * darauf wird „ja“ oder „nein“ sein: Willst du deine Schuhe ausziehen, dein Hemd ausziehen – und so durch das Dorf laufen? (W. Schukshin); Haben Sie Bäume zu Hause? (Ju. Kuranov); Fragst du, wie er heißt? (Ju. Kuranov). Fragesätze verlangen eine Antwort über den Akteur, über das Zeichen, über bestimmte Umstände, d.h. sie verlangen die Botschaft neuer Informationen in der Antwort: „Warum bist du so nachdenklich?“ - fragte der Junge (Yu. Kuranov); Wer schwimmt im Fluss? Wer singt das Lied? (Ju. Kuranov); Dein Bier ist gut, Melanja Wassiljewna. Wie kochst du es? (W. Schukshin).
Fragesätze werden ihrer Natur nach in folgende Kategorien eingeteilt:
a) eigentliche Fragesätze. Sie enthalten eine Frage, die zwingend beantwortet werden muss. Diese Sätze drücken den Wunsch des Sprechers aus, etwas Unbekanntes herauszufinden: Warum verschließt du deinen düsteren Blick wieder mit einem Zottelhut? (M. Lermontow); Was für Leute, welche Typen? (W. Belinsky); Wie weit weg von hier wohnst du? (A. Puschkin);
b) Frage-bejahende Sätze. An den Gesprächspartner gerichtet, bedürfen sie nur der Bestätigung dessen, was in der Frage selbst zum Ausdruck kommt: Bist du ein Dorfbewohner, warst du kein Bauer? (S. Yesenin); Na, wer von uns freut sich nicht über den Frühling? (A. Scharow); Waren es nicht Ihre Klänge, die die Süße in jenen Jahren inspirierten? War es nicht deine, Puschkin, die uns damals begeisterte? (A. Block);
c) verneinende Fragesätze. Sie enthalten die Verneinung dessen, was gefragt wird: Lieber! Nun, wie kann man in einem Schneesturm einschlafen? (S. Yesenin); Aber werde ich dich vergessen? (S. Yesenin); Ente, warum zieht sich der Narr dann so viele Jahre die Adern aus? (W. Schukschin);
d) Frage- und Motivationssätze. Sie enthalten einen Aufruf zum Handeln, ausgedrückt durch die Frage: "Wirst du aufhören zu schreien?" Sofya Ivanovna (V. Shukshin) fragte erneut; "Lass uns das Blut schmecken?" - schlug den Sohn vor (V. Shukshin); "Willst du keine Milch für unterwegs trinken?" - sagte Yakov (M. Gorki);
e) fragend-rhetorische Sätze. Sie enthalten Bejahung oder Verneinung. Diese Sätze erfordern keine Antwort, da sie in der Frage selbst enthalten ist; sie werden als Ausdrucksmittel verwendet: Wünsche ... Was nützt es, vergebens und für immer zu wünschen? (M. Lermontow); Aber wer wird in die Tiefen der Meere und ins Herz vordringen, wo Sehnsucht, aber keine Leidenschaften sind? (M. Lermontow); Wer außer dem Jäger hat schon erlebt, wie beglückend es ist, im Morgengrauen durch die Büsche zu streifen? (I. Turgenew). Zu den fragend-rhetorischen Fragen gehören im Wesentlichen auch Gegenfragen (die Antwort erfolgt in Form einer Frage): „Sag mir, Stepan, hast du aus Liebe geheiratet?“ - fragte Mascha. „Was für eine Liebe haben wir im Dorf?“ - Stepan antwortete und grinste (A. Chekhov).
Anreize sind Sätze, die den Willen des Sprechers ausdrücken. Ihr Ziel ist es, zum Handeln anzuregen. Sie enthalten verschiedene Schattierungen von Willensäußerungen: einen Befehl, eine Bitte, ein Gebet, einen Wunsch: „Schweige!, du!“ - rief der Schrott in einem bösen Flüstern und sprang auf seine Füße (M. Gorki); "Geh, Petrus!" - kommandiert von einem Studenten (M. Gorki); Onkel Grigory ... bücken Sie sich mit Ihrem Ohr (M. Gorky); Rat, Vorschlag, Warnung, Protest, Drohung: Diese Arina ist eine originelle Frau; Sie bemerken, Nikolai Petrovich (M. Gorki); Haustiere des windigen Schicksals, Tyrannen der Welt! Zittern! Und du, fasse Mut und höre, erhebe dich, gefallene Sklaven! (A. Puschkin); Zustimmung, Erlaubnis: Tun Sie dies, wie Sie möchten; Sie können dorthin gehen, wo Ihre Augen hinsehen; Aufruf, Einladung zur gemeinsamen Aktion: Nun, versuchen wir mit aller Kraft, die Krankheit zu besiegen (M. Gorki); Mein Freund, lasst uns mit wunderbaren Impulsen unsere Seelen der Heimat widmen! (A. Puschkin).
Die grammatikalischen Mittel zum Bilden von Anreizsätzen sind: Anreizintonation; Prädikat in Form von Imperativ; spezielle Partikel, die eine anregende Konnotation in den Satz einführen (komm schon, komm schon, komm schon, ja, lass es): Sing nicht, Schönheit, mit mir bist du traurige Lieder Georgiens ... (A. Puschkin); Ab in den Salon! (A. Tschechow); Nun, komm zu mir (L. Tolstoi).
Mehr zum Thema ERKLÄRUNGS-, INTERESSANT- UND ANREIZSÄTZE:
- 14. Aussage-, Frage- und Anreizsätze
- § 148. Erzähl-, Frage- und Anreizsätze
Angebotsarten
Aussage-, Frage- und Anreizsätze (nach Art der Aussage)
Abhängig von Zweck der Äußerung Die Sätze sind deklarativ, interrogativ und imperativ.
Erzählsätze sind Sätze, die eine Botschaft über eine Tatsache der Realität, ein Phänomen, ein Ereignis usw. enthalten. (genehmigt oder abgelehnt). Erzählsätze sind die häufigste Art von Sätzen, sie sind in ihrem Inhalt und ihrer Struktur sehr unterschiedlich und unterscheiden sich in der relativen Vollständigkeit des Gedankens, die durch eine bestimmte narrative Intonation vermittelt wird: eine Tonerhöhung bei einem logisch unterschiedenen Wort (oder zwei oder mehr, aber eine der Erhöhungen wird die größte sein) und eine ruhige Verringerung ertönt am Ende eines Satzes: Der Wagen fuhr vor die Veranda des Hauses des Kommandanten. Die Leute erkannten Pugachevs Glocke und die Menge lief ihm nach. Shvabrin traf den Betrüger auf der Veranda. Er war als Kosak verkleidet und trug einen Bart (P.).
Als Fragesätze werden Sätze bezeichnet, die darauf abzielen, den Gesprächspartner dazu zu bringen, eine Idee auszudrücken, die den Sprecher interessiert, d.h. Ihr Zweck ist pädagogisch.
Die grammatikalischen Mittel zur Bildung von Fragesätzen sind wie folgt:
1) fragende Intonation- eine Erhöhung des Tons des Wortes, mit dem die Bedeutung der Frage verbunden ist;
2) Flexion(normalerweise steht das Wort, mit dem die Frage verbunden ist, am Anfang des Satzes);
3) Fragewörter- zum Beispiel Fragepartikel, Adverbien, Pronomen.
Fragesätze sind unterteilt in
eigentlich fragend,
fragend-impellativ
und fragend-rhetorisch.
Richtiges Fragewort Sätze enthalten eine Frage, die zwingend beantwortet werden muss.
Eine besondere Vielfalt von Fragesätzen, die den eigentlichen Fragesätzen nahestehen, sind diejenigen, die, wenn sie an den Gesprächspartner gerichtet sind, nur eine Bestätigung dessen erfordern, was in der Frage selbst gesagt wird. Solche Vorschläge werden aufgerufen fragend bejahend.
Fragesätze können die Verneinung des Gefragten enthalten, das ist es fragend-negative Sätze.
Frage-bejahende und fragen-negative Sätze können kombiniert werden fragend-erzählerisch, da sie Übergangscharakter haben - von einer Frage zu einer Nachricht.
Interrogativ-Impellativ Sätze enthalten einen Handlungsaufruf, der durch eine Frage ausgedrückt wird.
In Frage-Rhetorik Sätze enthalten Bejahung oder Verneinung. Diese Vorschläge erfordern keine Antwort, da sie in der Frage selbst enthalten ist. Fragend-rhetorische Sätze sind vor allem in der Belletristik verbreitet, wo sie zu den Stilmitteln emotional gefärbter Rede gehören.
Zu den fragend-rhetorischen Fragen gehören im Wesentlichen auch Gegenfragen (eine Antwort in Form einer Frage).
Fragesätze können auch die Form von Einfügungskonstruktionen haben, die ebenfalls keine Antwort erfordern und beispielsweise nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners zu erregen.
Eine Frage in einem Fragesatz kann von zusätzlichen modalen Nuancen begleitet sein - Unsicherheit, Zweifel, Misstrauen, Überraschung usw.
Zusätzliche Schattierungen können emotional sein, zum Beispiel,
Konnotation des negativen Ausdrucks: Bist du taub, oder was?;
ein Hauch von Höflichkeit (eine Milderung der Frage wird normalerweise mit dem Partikel nicht erreicht): Kommst du morgen nicht zu mir? Mi: Kommst du morgen zu mir?
Anreize sind Sätze, die den Willen des Sprechers ausdrücken, ihr Ziel ist es, eine Handlung herbeizuführen.
Sie können ausdrücken:
1) Bestellung, Bitte, Gebet, zum Beispiel;
2.) Rat, Vorschlag, Warnung, Protest, Drohung,
3) Zustimmung, Erlaubnis, zum Beispiel;
4) Aufruf, Einladung zum Beispiel zu gemeinsamen Aktionen;
5) Wunsch.
Viele dieser Bedeutungen von Anreizsätzen sind nicht klar abgegrenzt (z. B. ein Flehen und eine Bitte, eine Einladung und ein Befehl usw.), da dies häufiger intonatorisch als strukturell zum Ausdruck kommt.
Grammatik zur Registrierung Incentive-Angebote sind:
1) motivierende Intonation;
2) das Prädikat in Form des Imperativs;
3) spezielle Partikel, die dem Satz einen motivierenden Ton hinzufügen (komm schon, komm schon, komm schon, ja, lass).
Incentive-Angebote variieren je nach Ausdrucksweise des Prädikats:
Der häufigste Ausdruck des Prädikats zwingendes Verb.
Der Bedeutung des Verbs kann eine Anreizkonnotation hinzugefügt werden spezielle Teilchen.
Als Prädikat kann ein Anreizsatz verwendet werden Verb im Indikativ (Vergangenheits- und Zukunftsform).
Als Prädikat - konjunktiv verb. Unter diesen Vorschlägen sind Vorschläge mit dem Wort zu, und das Verb kann weggelassen werden. Solche Sätze charakterisieren die Umgangssprache.
Das Prädikat im Imperativsatz kann sein Infinitiv.
Infinitiv mit Partikel würde drückt eine sanfte Bitte, einen Rat aus.
In der Umgangssprache Anreize werden oft verwendet ohne verbalen Ausdruck des Prädikats- ein Verb in Form eines Imperativs, klar aus dem Kontext oder der Situation. Dies sind besondere Formen lebendiger Sprachsätze mit einem führenden Wort - einem Substantiv, einem Adverb oder einem Infinitiv. Zum Beispiel: Wagen für mich, Wagen! (GR).
Das strukturelle Zentrum von Anreizsätzen (auch in der Umgangssprache) kann das entsprechende sein Zwischenrufe: lass uns gehen, marschieren, tsyts usw.
Ausrufesätze
Ausrufesätze sind emotional gefärbt, was durch eine besondere Ausrufe-Intonation vermittelt wird.
Emotionale Färbung kann verschiedene Arten von Sätzen haben: erzählend, fragend und anregend.
Zum Beispiel,
erzählerisch-ausrufend:Er begegnete dem Tod von Angesicht zu Angesicht, wie es ein Kämpfer im Kampf tun sollte! (L.);
fragend-ausrufend:Wer hätte es gewagt, Ismael danach zu fragen?! (L.);
Anreiz-Ausruf:- Oh, verschone ihn! ... warte! - rief er aus (L.).
Grammatik-Design-Tools Ausrufesätze lauten wie folgt:
1) Intonation, die eine Vielzahl von Gefühlen ausdrückt: Freude, Ärger, Ärger, Wut, Überraschung usw. (Ausrufesätze werden in einem höheren Ton ausgesprochen, wobei das Wort betont wird, das die Emotion direkt ausdrückt), zum Beispiel.
2) Zwischenrufe, zum Beispiel: Oh, ach, Wow, Ahti, Ugh;
3) Ausrufepartikel Interjektion, pronominale und adverbiale Herkunft, die die ausgedrückte emotionale Färbung angibt: na ja, na ja, wo, wie, wie, was, was usw.
Häufige und ungewöhnliche Vorschläge
Ungewöhnlich Es wird ein Satz aufgerufen, der nur die Positionen der Hauptelemente enthält - das Subjekt und das Prädikat.
Sätze, die zusammen mit den Hauptsätzen Positionen sekundärer Mitglieder haben, werden aufgerufen weit verbreitet.
Ein Satz kann durch vereinbarte, kontrollierte und angrenzende Wortformen (nach den Regeln der Bedingungsbeziehungen) erweitert werden, die durch Phrasen in den Satz aufgenommen werden, oder durch Wortformen, die sich auf den gesamten Satz als Ganzes beziehen. Die Verteiler des Gesamtangebots werden genannt Determinanten. In der Regel sind verschiedene Umstände und Zusätze maßgebend, die ein semantisches Subjekt oder Objekt ausdrücken.
So können die Verbreiter des Satzes in den Prädikativstamm des Satzes aufgenommen werden und entweder die Subjektbildung oder die Prädikatsbildung erweitern, oder sie können Verbreiter des gesamten Stammes sein. Der Begriff "Determinante" wurde von N.Yu eingeführt. Schwedova.
Einfache und komplexe Sätze
Ein einfacher Satz hat ein prädikatives Zentrum, das ihn organisiert, und enthält daher eine prädikative Einheit.
Ein komplexer Satz besteht aus zwei oder mehr prädikativen Einheiten, die bedeutungsmäßig und grammatikalisch kombiniert sind. Jeder Teil eines komplexen Satzes hat seine eigenen grammatikalischen Zusammensetzungen.
Ein komplexer Satz ist eine strukturelle, semantische und intonatorische Einheit. Diese Vorstellung von der Integrität eines komplexen Satzes wurde in den Arbeiten von N.S. Pospelov.
Obwohl Teile eines komplexen Satzes strukturell ähneln einfachen Sätzen (bedingt werden sie manchmal so genannt), sie kann außerhalb eines zusammengesetzten Satzes nicht existieren, d.h. außerhalb dieser grammatikalischen Assoziation als eigenständige kommunikative Einheiten. Dies wird besonders deutlich in einem komplexen Satz mit abhängigen Teilen. Zum Beispiel in einem Satz Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass wir dich immer noch nicht kennen (L.) Keiner der bestehenden drei Teile kann als separater unabhängiger Vorschlag existieren, jeder von ihnen bedarf einer Erklärung. Als Analoga zu einfachen Sätzen können Teile eines komplexen Satzes, wenn sie kombiniert werden, strukturelle Änderungen erfahren, d.h. sie können eine Form annehmen, die für einen einfachen Satz nicht charakteristisch ist, obwohl diese Teile gleichzeitig ihre eigene Aussagekraft haben.
Teile eines komplexen Satzes können kombiniert werden
als gleich,grammatikalisch unabhängig, zum Beispiel: Zweige blühender Kirschen schauen zu mir aus dem Fenster, und der Wind bestreut manchmal meinen Schreibtisch mit ihren weißen Blüten (L.);
und als Süchtige, zum Beispiel: An drei Seiten schwärzten die Kämme der Klippen und Äste von Mashuk, auf denen eine bedrohliche Wolke lag (L.).
Der Hauptunterschied zwischen einfachen und komplexen Sätzen ist der ein einfacher Satz ist eine monoprädikative Einheit, ein komplexer eine polyprädikative.
Die russische Sprache ist ein komplexes, facettenreiches, multistrukturelles Phänomen. Jeder Abschnitt der Linguistik untersucht einen separaten Abschnitt der Sprache unter Verwendung eines wissenschaftlichen Systemansatzes. Das Studium des Satzes als Hauptthema befasst sich mit der Syntax.
Ein Satz auf Russisch zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus. In Bezug auf die Menge ist es einfach und komplex. Durch das Vorhandensein von prädikativen Einheiten wird es als vollständig (es gibt sowohl ein Subjekt als auch ein Prädikat) und unvollständig (eines der Hauptmitglieder des Satzes wird weggelassen, kann aber leicht aus dem Kontext des Satzes wiederhergestellt werden) betrachtet werden. In der Zusammensetzung kann es zweiteilig (beide Hauptmitglieder des Satzes sind vorhanden) und einteilig (bei Vorhandensein nur des Subjekts oder nur des Prädikats) sein. wiederum sind sie unterteilt in nominal (das Hauptmitglied ist das Subjekt) und verbal - definitiv persönlich, unbestimmt persönlich, verallgemeinert persönlich und unpersönlich (mit einem Hauptmitglied - Prädikat).
Es ist üblich, zwischen einem Aussagesatz, einem Fragesatz und einem Anreizsatz zu unterscheiden.
Aussagesatz - dies ist ein Satz, der eine Botschaft über jemanden oder etwas enthält: über eine Tatsache, ein Ereignis, ein Phänomen, ein Objekt oder ein Lebewesen, zum Beispiel: "Draußen vor dem Fenster schien heute den ganzen Tag die Sonne, die in diesen Breiten so selten ist." Diese Botschaft kann negativ oder positiv sein: „Wie sehr wir Vater nicht erwartet haben, heute ist er nicht gekommen
". "Regen strömte vom frühen Morgen an, wie von den Prognostikern versprochen."
Aussagesatz - am häufigsten im Russischen. Sie zeichnen sich durch inhaltliche und strukturelle Vielfalt aus, solche Sätze drücken immer einen vollständigen Gedanken aus. In der mündlichen Rede wird dies durch besondere Schattierungen der narrativen Intonation vermittelt - bei einem Schlüsselwort oder einer Phrase steigt der Ton an, das signifikanteste Fragment wird logisch hervorgehoben, dann fällt der Ton auf Ruhe ab, gefolgt von der Intonation des Satzendes .
Ein Aussagesatz umfasst alle Haupttypen von Sätzen:
- einfach: "Mama kam von der Arbeit nach Hause";
- Komplex: "Ich schaute auf die Straße und sah, dass der Himmel mit einer riesigen Wolke bedeckt war";
- vollständig: "Der Schneesturm hat sich ernsthaft aufgelöst";
- unvollständig: "Ein falscher Freund verrät dich bei der ersten Gefahr, ein echter niemals!"
- zweiteilig: "Er ging, ohne zurückzublicken";
- einstimmig - Denominativ: "Draußen vor dem Fenster ist eine stille Frühlingsnacht"; verbal: "Ich träume von dir"; "Sie klopfen immer wieder an meine Tür"; "Es riecht süß" Klettere den Hügel hinauf und fahre schön auf dem ersten gewalzten Schnee.
Vorschläge zur Intonation im Russischen sind Ausrufezeichen, d.h. emotional gefärbt und nicht ausrufend - emotional neutral: Oh, wie herrlich im Sommer im Wald! Die Sonne brennt sanft, Vögel singen von irgendetwas, Mücken flattern umständlich im Gras.
Sätze ohne Ausrufe drücken keine Emotionen aus - Wut, Freude, Wut, Verzweiflung usw. Inhaltlich sind sie entweder erzählend oder fragend: Ein hungriger Welpe wanderte niedergeschlagen eine dunkle Straße entlang; Können Sie mir sagen, wie spät es ist?
Ausrufesätze drücken die unterschiedlichsten Emotionen aus – Freude, Wut, Überraschung, Staunen usw. In der mündlichen Rede wird ein Ausruf durch eine spezielle Intonation, eine Erhöhung des Tons, ausgedrückt. Schriftlich - mit Hilfe eines Ausrufezeichens.
Ausrufesätze können Sätze enthalten wie:
- Erzählsätze, zum Beispiel: "Da kam sie, Mutter Winter!"
- Anreizsätze: „Vorsicht, keine Fehler beim Komponieren!“
- Fragesätze: „Und warum schweigen wir?! Woran denken wir?!“
Neben der Intonation kann ein Ausruf durch solche Serviceteile der Sprache wie Interjektionen und Partikel ausgedrückt werden: was, oh, gut, gut, wofür und andere:
Ö! Wie freue ich mich, Sie zu sehen!
Was für eine Freude dieser Schnee ist!
Nun, Sie haben sich bereits einen Witz ausgedacht!
Hey! Meister, öffnet das Tor!
Nun, Sie haben sich bereits einen Witz ausgedacht!
Hey! Meister, öffnet das Tor!
Aussagesätze
Je nach Zweck der Aussage sind Sätze deklarativ, fragend und anregend.
Erzählsätze sind Sätze, die eine Botschaft über eine Tatsache der Realität, ein Phänomen, ein Ereignis usw. enthalten. (genehmigt oder abgelehnt). Erzählsätze sind die häufigste Art von Sätzen, sie sind in ihrem Inhalt und ihrer Struktur sehr unterschiedlich und zeichnen sich durch die Vollständigkeit des Gedankens aus, die durch eine bestimmte Erzählmelodie übertragen wird: eine Tonerhöhung bei einem logisch unterschiedenen Wort (oder zwei oder mehr, aber einer der Anstiege wird der größte sein) und ein ruhiger Tonfall am Ende eines Satzes. Zum Beispiel: Kibitka fuhr vor die Veranda des Hauses des Kommandanten. Die Leute erkannten Pugachevs Glocke und die Menge lief ihm nach. Shvabrin traf den Betrüger auf der Veranda. Er war als Kosak verkleidet und trug einen Bart (P.).
Fragesätze sind Sätze, die den Gesprächspartner dazu bringen sollen, eine Idee auszudrücken, die den Sprecher interessiert. Zum Beispiel: Warum musst du nach Petersburg? (P.); Was wirst du dir jetzt sagen? (P.).
Die grammatikalischen Mittel zur Bildung von Fragesätzen sind wie folgt:
a) fragende Intonation - eine Erhöhung des Tons eines Wortes, mit der die Bedeutung der Frage verbunden ist, zum Beispiel: Haben Sie Glück mit einem Lied gerufen? (L.) (Vergleiche: Hast du das Glück mit einem Lied gerufen? - Hast du das Glück mit einem Lied gerufen?);
b) Wortstellung (meistens wird das Wort, mit dem die Frage verbunden ist, an den Anfang des Satzes gestellt), z. B.: Brennt ein feindlicher Hagel? (L.); Aber wird er bald mit einem reichen Tribut zurückkehren? (L.);
c) Fragewörter - Fragepartikel, Adverbien, Pronomen, zum Beispiel: Wäre es nicht besser, wenn Sie selbst dahinterkämen? (P.); Gibt es wirklich keine Frau auf der Welt, der Sie etwas als Andenken hinterlassen möchten? (L.); Warum stehen wir hier? (CH.); Woher strahlt das Leuchten? (L.); Was hast du in meinem Garten gemacht? (P.); Was sollst du tun? (P.).
Fragesätze werden in selbstfragende, fragend-anregende und fragend-rhetorische Sätze unterteilt.
Selbstbefragungssätze enthalten eine Frage, die eine obligatorische Antwort erfordert. Zum Beispiel: Haben Sie Ihr Testament geschrieben? (L.); Sag mal, passt mir die Uniform gut? (L.).
Eine besondere Art von Fragesätzen, die den eigentlichen Fragesätzen nahe stehen, sind solche, die, an den Gesprächspartner gerichtet, nur eine Bestätigung dessen erfordern, was in der Frage selbst gesagt wird.
Solche Sätze nennt man Frage-Bestätigungssätze. Zum Beispiel: Also gehst du? (bl.); Also ist es entschieden, Herman? (bl.); Also jetzt nach Moskau? (CH.).
Fragesätze schließlich können eine Verneinung des Gefragten enthalten, das sind Frage-Negativ-Sätze. Zum Beispiel: Was gefällt dir hier? Es scheint nicht besonders angenehm zu sein (Bl.); Und selbst wenn er sprechen würde... Was kann er Neues sagen? (bl.).
Sowohl fragend-bejahende als auch fragend-negative Sätze können zu fragend-deklarativen Sätzen kombiniert werden, da sie einen Übergangscharakter von einer Frage zu einer Nachricht haben.
Fragesätze enthalten einen Handlungsanreiz, der durch eine Frage ausgedrückt wird. Zum Beispiel: Vielleicht setzt unser wunderbarer Dichter die unterbrochene Lesung fort? (bl.); Sollen wir zuerst übers Geschäft reden? (CH.).
Frage-rhetorische Sätze enthalten Bejahung oder Verneinung. Diese Vorschläge erfordern keine Antwort, da sie in der Frage selbst enthalten ist. Fragend-rhetorische Sätze sind vor allem in der Belletristik verbreitet, wo sie zu den Stilmitteln emotional gefärbter Rede gehören. Zum Beispiel: Ich wollte mir jedes Recht geben, ihn nicht zu verschonen, wenn das Schicksal mir gnädig wäre. Wer hat solche Bedingungen nicht mit seinem Gewissen gemacht? (L.); Wünsche ... Was nützen vergebens und ewig wünschen? (L.); Aber wer wird in die Tiefen der Meere und ins Herz vordringen, wo Sehnsucht, aber keine Leidenschaften sind? (L).
Fragesätze können auch die Form von Einfügungskonstruktionen haben, die ebenfalls keiner Antwort bedürfen und nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners zu erregen, zum Beispiel: Der Ankläger fliegt kopfüber in die Bibliothek und – kannst du dir das vorstellen? - Weder eine ähnliche Zahl noch ein solches Datum des Monats Mai findet sich in Senatsbeschlüssen (Fed.).
Eine Frage in einem Fragesatz kann von zusätzlichen Nuancen modaler Art begleitet werden - Unsicherheit, Zweifel, Misstrauen, Überraschung usw. Zum Beispiel: Wie hast du aufgehört, sie zu lieben? (L.); Erkennst du mich nicht? (P.); Und wie konnte sie zulassen, dass Kuragin dazu kam? (L. T.).
Anreize sind Sätze, die den Willen des Sprechers ausdrücken. Sie können ausdrücken: a) einen Befehl, eine Bitte, eine Bitte, zum Beispiel: - Schweigen! Sie! - rief der Überbleibsel in einem bösen Flüstern und sprang auf seine Füße (M. G.); - Los, Petrus! - kommandiert von einem Studenten (M. G.); - Onkel Gregory ... bücken Sie sich mit Ihrem Ohr (M. G.); - Und Sie, mein Lieber, brechen Sie es nicht ... (M. G.); b) Rat, Vorschlag, Warnung, Protest, Drohung, zB: Die ursprüngliche Frau ist diese Arina; Sie bemerken, Nikolai Petrowitsch (M. G.); Haustiere eines windigen Schicksals, Tyrannen der Welt! Zittern! Und du, fasse Mut und höre, erhebe dich, gefallene Sklaven! (P.) Schau, öfter gehören meine Hände mir - Vorsicht! (MG); c) Zustimmung, Erlaubnis, zum Beispiel: Wie Sie möchten, tun Sie dies; Sie können dorthin gehen, wo Ihre Augen hinsehen; d) ein Aufruf, eine Aufforderung zum gemeinsamen Handeln, zum Beispiel: Nun, versuchen wir mit aller Kraft, die Krankheit zu besiegen (M. G.); Mein Freund, lasst uns mit wunderbaren Impulsen unsere Seelen der Heimat widmen! (P.); e) Wunsch, zum Beispiel: Gib ihm holländischen Ruß mit Rum (M. G.).
Viele dieser Bedeutungen von Anreizsätzen sind nicht klar abgegrenzt (z. B. ein Flehen und eine Bitte, eine Einladung und ein Befehl usw.), da dies häufiger intonatorisch als strukturell zum Ausdruck kommt.
Die grammatikalischen Mittel zum Bilden von Anreizsätzen sind: a) Anreizintonation; b) das Prädikat in Form des Imperativs; c) spezielle Partikel, die eine motivierende Konnotation in den Satz einbringen (komm schon, komm schon, komm schon, ja, lass).
Anreizsätze unterscheiden sich in der Art und Weise, wie das Prädikat ausgedrückt wird:
A) Der häufigste Ausdruck des Prädikats ist ein Verb in Form eines Imperativs, zum Beispiel: Du wirst zuerst den Kapitän wecken (L. T.); Also nimmst du den Tag (M. G.).
Mit speziellen Partikeln lässt sich der Bedeutung des Verbs eine motivierende Konnotation hinzufügen: Lasst den Sturm stärker kommen! (MG); Es lebe die Sonne, es lebe die Dunkelheit! (P.).
B) Als prädikatmotivierender Satz kann ein Verb in Form des Indikativs (Vergangenheit und Futur) verwendet werden, zB: Reden wir über die stürmischen Tage des Kaukasus, über Schiller, über Ruhm, über Liebe! (P.); Ausweichen! (MG); - Lass uns gehen, - sagte er (Kosake.).
C) Als Prädikat - ein Verb in Form eines Konjunktivs, zum Beispiel: Würdest du hören, welche Art von Musik ich in meiner Seele habe ... (M. G.). Unter diesen Sätzen stechen zum Beispiel Sätze mit dem Wort so hervor: Damit ich nie wieder von dir höre (Gr.), und das Verb kann weggelassen werden: Damit keine einzige Seele - nein, nein! (M. G.).
D) Die Rolle des Prädikats im Anreizsatz kann der Infinitiv spielen, zum Beispiel: Call Bertrand! (bl.); Wage es nicht, mich zu ärgern! (CH.).
Der Infinitiv mit einem Partikel würde eine sanfte Bitte ausdrücken, einen Ratschlag: Du solltest mindestens einmal zu Tatyana Yuryevna (Gr.) gehen.
E) In der Umgangssprache werden Anreizsätze oft ohne den verbalen Ausdruck des Prädikat-Verbs in Form eines aus dem Kontext oder der Situation ersichtlichen Imperativs verwendet. Dies sind besondere Formen von Live-Sprachsätzen mit einem führenden Wort, einem Substantiv, einem Adverb oder einem Infinitiv. Zum Beispiel: Wagen zu mir, Wagen! (GR.); Der diensthabende General bald! (L. T.); Seien Sie vorsichtig. In die Steppe, wo der Mond nicht scheint! (bl.); Herr! Schweigen! Unser schöner Dichter wird uns sein schönes Gedicht (Bl.) vorlesen; Wasser! Bring sie zur Vernunft! - Noch! Sie kommt zur Besinnung (Bl.).
E) Das strukturelle Zentrum von Anreizsätzen (auch in der Umgangssprache) können auch die entsprechenden Interjektionen sein: komm schon, marsch, tsyts usw.: - Komm zu mir! rief er (M. G.).