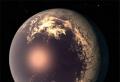Prädikat auf deutsch. Satztypen im Deutschen. Unabhängig davon sind die Wortarten zu erwähnen, die sich zwischen den Komponenten eines komplexen Prädikats befinden
Um Ihre Gedanken mündlich oder schriftlich klar und prägnant auszudrücken, reicht es nicht aus, solche grammatikalischen Normen wie Verbkonjugation, Deklination bei Substantiven und Adjektiven usw. zu beherrschen. Der deutsche Satz hat eine gut organisierte Struktur, die in der Anfangsphase des Lernens für Menschen, die kein Deutsch sprechen, unverständlich sein kann.
Bevor Sie mit der grammatikalisch korrekten Konstruktion eines Satzes fortfahren, müssen Sie feststellen, was der Sprecher sagen möchte welcher Satz wird für den Zweck der Aussage sein:
Narrativ- gibt dem Gesprächspartner die verfügbaren Informationen;
fragend- der Vorschlag stellt eine Frage, um Informationen zu erhalten;
Anreiz- enthält einen Aufruf an den Gesprächspartner, eine Aktion auszuführen.
Um die Struktur des deutschen Satzes visuell zu verstehen, vergleichen die Einwohner Deutschlands ihn selbst mit einem Orchester, in dem Dirigent ist Verb-Prädikat. Er "gibt den Ton an" für jedes Instrument im Orchester - ein Mitglied des Vorschlags.
 In einem deklarativen einfachen Satz
Verb-Prädikat lohnt sich immer auf Platz 2.
Aber was vor ihm liegt, spielt überhaupt keine Rolle. Das muss nicht Gegenstand sein, durch ein Nomen oder Pronomen ausgedrückt. Platz 1 platziert werden können und minderjährige Mitglieder.
In einem deklarativen einfachen Satz
Verb-Prädikat lohnt sich immer auf Platz 2.
Aber was vor ihm liegt, spielt überhaupt keine Rolle. Das muss nicht Gegenstand sein, durch ein Nomen oder Pronomen ausgedrückt. Platz 1 platziert werden können und minderjährige Mitglieder.
Zum Beispiel:
Wenn der Vorschlag verwendet zusammengesetztes Prädikat, dann an 2. Stelle unbedingt setzen sein veränderlicher Teil und sein unveränderlicher Teil sich aufmachen Schlussendlich.
Es gibt solche Varianten des zusammengesetzten Prädikats:
1. Sozusagen modales Prädikat (bedeutet >> Modalverb + Semantik).
Z.B,
- Wir können heute arbeiten. Wir können heute arbeiten.
! können, can- Modalverb/ arbeiten, arbeiten ist ein semantisches Verb. !
2. Vorläufige Form(Hilfsverb + Semantik).
Z.B,
- Ich habe Zwei Jahre deutsch gelernt. — Ich habe 2 Jahre Deutsch gelernt.
! haben- Hilfsverb / lernen- semantisches Verb. !
3. Infinitivkonstruktion (Verb + Verb/Infinitiv mit Partikel zu oder sonst zusammengesetzter Infinitiv).
Z.B,
- Frau Horst beginnt zu sprechen. Frau Horst beginnt zu sprechen.
! beginnen- Verb / sprechen- Infinitiv mit Partikel zu!
- Ich verspreche zu kommen. Ich verspreche zu kommen.
! versprechen Verb / kommen- Infinitiv mit Partikel zu!
4. Verbalphrasen(festgelegte Wortverbindungen, bei denen es ein Verb und einen dazugehörigen Teil gibt).
Z.B,
Ich Weiss Bescheid. — Ich bin informiert/informiert.
! Bescheid Wissen- Verbalphrase!
Frauen Legende mehr Wert auf Vertrauen und Loyalität als Männer. „Frauen schätzen Vertrauen und Loyalität mehr als Männer. / Frauen schätzen Vertrauen und Loyalität mehr als Männer.
! Wert-Legende- Verbalphrase!
5. Ein Verb mit einem trennbaren Präfix.
Z.B,
Dominik macht die Augen zu. Dominik schließt die Augen.
! zu machen - schließen- Vb. mit abtrennbarem Präfix!
Unabhängig davon sind die Wortarten zu erwähnen, die sich zwischen den Komponenten eines komplexen Prädikats befinden.
Dieser Teil des Satzes auf Deutsch klingt wie Mittelfeld. Die Wörter in diesem Segment können nicht beliebig angeordnet werden, sie gehorchen auch bestimmten Regeln:
Pronomen stehen immer vor Substantiven, egal in welchem Kasus sie stehen.
Zum Beispiel:
- Linda hat ihm mein Auto geliehen! Linda hat ihm mein Auto geliehen!
- Helga hat mir diese Uhr geschenkt. Helga hat mir diese Uhr geschenkt.
Mehrere aufeinander folgende Substantive sind nach Kasus geordnet - Nominativ, Dativ, Akkusativ, Genetiv.
Zum Beispiel:
- Heute hat meine Mutter (Nom.) mir (Dat.) etwas besonderes (A) gekauft. Meine Mutter hat mir heute etwas Besonderes gekauft.
Auch mehrere Pronomen hintereinander sind nach Kasus geordnet: Nominativ, Akkusativ, Dativ.
Zum Beispiel:
- Heute hat sie(N) es(A) mir (D) gekauft. Sie hat mir das heute gekauft.
Ein solcher Satzteil ist als Umstand im deutschen Text vorschriftsmäßig verortet TEKAMOLO. Was bedeutet das? TE (oder temporal) bedeutet Zeit, KA (oder kausal) ist Ursache, MO (oder modal) bedeutet Handlungsablauf, LO (oder lokal) bedeutet Ort. Das heißt, es werden zunächst die Umstände genannt, die die Fragen „wie lange / wann / wie oft?“ beantworten, dann – aus welchem Grund? / warum, der nächste Ort – wie? / auf welche Weise?, und die endgültige Position - wo? / wo? / woher?.
Zum Beispiel:
- Wir fahren morgen ( zeitlich) mit dem Zug ( modal) nach Frankreich ( lokal). Morgen fahren wir mit dem Zug nach Frankreich.
- Sven wurde gestern ( TE) wegen einer Infektion ( KA) schnell ( MO) ins Krankenhaus ( LO) gebracht. Sven wurde gestern wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert.
Substantive mit bestimmten Artikeln werden in einem deklarativen einfachen Satz vor Substantive mit Artikel gestellt. eine, eine.
Zum Beispiel:
- ich habe dem Sohn meiner Tante ein Hemdgekauft. — Ich habe ein Hemd für den Sohn meiner Tante gekauft.
- Kimmi-Hut Höhle Eltern ein Neues Café empfohlen. Kimmy empfahl ihren Eltern ein neues Café.
Ein indirektes Objekt, bestehend aus einem Objekt und einer Präposition, wird vor ein direktes Objekt gestellt, das verlangt Dativ und Akkusativ.
Zum Beispiel:
- Die Mutter hat ihre Tochter (D) ein neues Kleid (EIN) aus Baumwolle (Präposition/präposition + D) genaht. Die Mutter nähte für ihre Tochter ein Baumwollkleid.
Eventuelle Umstände werden normalerweise zwischen die Zusätze gestellt.
Zum Beispiel:
Du musst dir ungebettet diese Serie anschauen! Diese Serie sollte man sich unbedingt ansehen!
Ich danke Ihnen herzlich für deine Glückwünsche, juhuuu! „Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Glückwünsche, yuhoo!“
Beim Studium der Frage nach dem Aufbau eines deutschen Satzes kommt man nicht umhin, den Aufbau eines komplexen Satzes zu berühren.
Komplexer Satz und seine Struktur
Ein aus zwei oder mehr Stämmen (Subjekt + Prädikat) bestehender Satz wird genannt schwierig. Im Deutschen werden solche Sätze wie im Russischen in zwei Arten unterteilt:
Zusammengesetzt, bei dem einfache Sätze durch Vereinigungen verbunden sind aber und und. Die Anordnung der Wörter in ihnen ist traditionell;
Zum Beispiel:
Ich fliege nach Spanien und meine Kinder bleiben zu Hause (natürlich mit Oma haha). - Ich fliege nach Spanien und meine Kinder bleiben zu Hause (natürlich bei ihrer Großmutter, haha).
Ich habe Magdalena eingeladen, aber sie ist nicht gekommen. - Ich habe Magdalena eingeladen, aber sie ist nicht gekommen.
Kompliziert - bestehend aus 2 Teilen: dem Hauptteil - Hauptsatz, und der Untergebene Nebensatz. Im Hauptteil sollte die Anordnung der Wörter gerade sein. Der untergeordnete Teil hat die umgekehrte Wortstellung - das Verb wird bis zum Ende getragen.
Zum Beispiel:
Markus ist nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen, obwohl ich ihn eingeladen habe (Verb am Ende).„Marcuss kam nicht zu meinem Geburtstag, obwohl ich ihn eingeladen hatte.
2. Fragesatz
Satzfragen in der deutschen Sprache werden in zwei Kategorien unterteilt:
Allgemein- impliziert eine spezifische Antwort "ja / nein";
Speziell , in deren Struktur das Wort Frage vorhanden sein muss.
 In einer allgemeinen Frage
an der 1. Position sollte der gebeugte Teil des Verbprädikats stehen, an der 2. Stelle - das Subjekt, dann die restlichen Satzglieder. Wenn das Prädikat komplex ist, wird sein unveränderlicher Teil an das Ende der Frage gestellt.
In einer allgemeinen Frage
an der 1. Position sollte der gebeugte Teil des Verbprädikats stehen, an der 2. Stelle - das Subjekt, dann die restlichen Satzglieder. Wenn das Prädikat komplex ist, wird sein unveränderlicher Teil an das Ende der Frage gestellt.
Zum Beispiel:
Kommt Helena Morgen? Kommt Helena morgen?
Magst du Heine nichts? - Du magst Heine nicht?
Hut Erik dir mein Buch gegeben? Hat Eric dir mein Buch gegeben?
Spezielle Fragesätze beginnen mit Fragewörter. Die zweite Position in der Struktur wird vom Prädikat eingenommen, das durch das Verb bezeichnet wird, dann das Subjekt (Substantiv oder Pronomen) und alle verbleibenden sekundären Elemente.
Zum Beispiel:
Wanner Hut Erik dir mein Buch gegeben? — Wann Eric hat dir mein Buch gegeben?
Wir m gehort diese Kaffeetasse? — Wem/wem gehört es diese Kaffeetasse?
Warum kommen du so früh? — Warum kommst du so früh?
3. Anreizangebot
 Der Zweck der Äußerung eines Anreizsatzes ist ein Aufruf, eine Handlung auszuführen. Im Deutschen werden Imperativsätze in der Regel im Imperativ formuliert. Ein Merkmal der Struktur ist die Tatsache, dass ein Prädikat-Verb an Position 1 steht und am Ende ein Ausrufezeichen anstelle eines Punktes steht. Bei der Aussprache wird der Ausruf von der Stimme betont. Das Subjekt in dieser Art von Satz kann fehlen. Wenn dies der Fall ist, wird es nach dem Prädikat platziert.
Der Zweck der Äußerung eines Anreizsatzes ist ein Aufruf, eine Handlung auszuführen. Im Deutschen werden Imperativsätze in der Regel im Imperativ formuliert. Ein Merkmal der Struktur ist die Tatsache, dass ein Prädikat-Verb an Position 1 steht und am Ende ein Ausrufezeichen anstelle eines Punktes steht. Bei der Aussprache wird der Ausruf von der Stimme betont. Das Subjekt in dieser Art von Satz kann fehlen. Wenn dies der Fall ist, wird es nach dem Prädikat platziert.
Zum Beispiel:
Komm! - Kommen!
Schließ Bitte sterben Tur! - Schließen Sie die Tür bitte!
Zeig Mir bitte das Foto! Zeig mir bitte das Foto!
Das war's erstmal 😉
Im Deutschen enthält jedes Prädikat zwangsläufig ein Verb: vgl. der russische Satz „I am froh“ und der deutsche „Ich binfroh". Das zweite Merkmal des deutschen Prädikats ist die konstante Stelle des Prädikats und seiner Teile in verschiedenen Satztypen. Das Prädikat mit Zusätzen und Umständen bildet eine Gruppe Prädikat.
Es gibt folgende Arten von Prädikaten:
1) verbales Prädikat;
2) ein Prädikat, das durch eine stabile Verbphrase ausgedrückt wird;
3) nominelles Prädikat.
Verb Prädikat.
Einfaches Verbprädikat besteht aus einem Verb in beliebiger Form von Zeitform, Stimme und Stimmung: Ich lesen. - Ich lese. Ich las.- Ich habe gelesen. Ich werde lesen. - Ich werde lesen. Ich habe gelesen. - Ich habe gelesen. Dieses Buch wild viel gelesen. - Dieses Buch wird viel gelesen..
Es gibt zwei Arten von zusammengesetzten Verbprädikaten:
a) Ein zusammengesetztes verbales Prädikat besteht aus einem Verb mit einer bestimmten Bedeutung (das den Anfang, das Ende, die Wiederholung einer Handlung ausdrückt) und einem Infinitiv eines signifikanten Verbs, das mit verwendet wird zu : Er begann zu sprechen. - Er sprach. Er begann zu sprechen. Er verordnet früh aufzustehen. - Er hat die Angewohnheit, früh aufzustehen. Es horte auf zu regnen. - Der Regen hörte auf.
b) Ein zusammengesetztes Verbprädikat besteht aus einem Modalverb ( können, dürfen, müssen usw.) oder ein Verb mit modaler Bedeutung ( scheinen, brauchen usw.) und der Infinitiv des signifikanten Verbs; bei Modalverben wird der Infinitiv ohne Partikel verwendet zu , mit Modalverben mit Partikel zu : Er muss arbeiten.- Er muss arbeiten. Er braucht heute nicht zu kommen. - Er muss heute nicht kommen..
c) Ein zusammengesetztes verbales Prädikat besteht aus Verben haben und sein und der Infinitiv des signifikanten Verbs, das mit verwendet wird zu- : Ich habe Ihnen viel zu sagen. - Ich habe dir viel zu erzählen. Der Text ist zu übersetzen. - Der Text kann (sollte) übersetzt werden.
Die Verwendung von Modalverben, um die Bedeutung von Möglichkeit, Notwendigkeit, Wunsch auszudrücken). Verb können bedeutet die aufgrund bestimmter Bedingungen verfügbare Möglichkeit: Es regnet nicht mehr, er kann nach Hause gehen. - Es regnet nicht mehr, er kann (er kann) nach Hause gehen. Es regnet, er kann nicht nach Hause gehen. - Es regnet, er kann nicht nach Hause gehen. Es regnet nicht mehr, man kann nach Hause gehen. - Kein Regen mehr, du kannst nach Hause gehen. Es regnet, man kann nicht nach Hause gehen. - Es regnet, du kannst nicht nach Hause gehen. Könn bedeutet auch "können": Ich kann Schach spielen. - Ich kann Schach spielen.
Verb dürfen bedeutet eine Gelegenheit, die aufgrund der Erlaubnis einer Person besteht. Zum Beispiel in Sätzen, die Erlaubnis, Verbot, Befehl enthalten: Sie dürfen hier nicht bleiben! - Sie sollten nicht hier bleiben! Du kannst nicht hier bleiben. Sie dürfen hier nicht bleiben. Man darf hier nicht rauchen! - Sie können hier nicht rauchen. Hier darf nicht geraucht werden!
Durfen Wird häufig in Fragesätzen verwendet, in denen um Erlaubnis gebeten wird, etwas zu tun: Darf ich nach Hause gehen? - Kann ich nach Hause gehen? Darf ich nach Hause gehen? Darf ich nach Hause gehen? Darf man hier rauchen? - Darf man hier rauchen? Darf hier geraucht werden?
Verb müssen hat die Bedeutung "sollte" (aufgrund objektiver Notwendigkeit oder Überzeugung): Es ist spät, er muß nach Hause gehen. - Es ist spät, er muss nach Hause. Es ist spät, er muss (er muss, er muss) nach Hause gehen. Es ist spät, man muss nach Hause gehen. - Es ist spät, du musst (müssen) nach Hause gehen.
Mit Ablehnung müssen fast nie benutzt; Anstatt von müssen ein Verb mit modaler Bedeutung verwendet wird brauchen - brauchen: Sie brauchen morgen nicht zu kommen. - Du musst morgen nicht kommen. Vergleiche: Sie müssen morgen kommen. - Du musst morgen kommen.
Verb Sollen hat die Bedeutung "sollte" (aufgrund von jemandes Befehl, Befehl usw.): Er soll bleiben. Er muss bleiben. Lass ihn bleiben. Er soll nicht bleiben. - Er sollte nicht bleiben. Sollen oft in Fragesätzen verwendet, die nach der Notwendigkeit fragen, etwas zu tun: Sollen wir hier bleiben? - Sollen wir hier bleiben? Sollen wir hier bleiben? Müssen wir hier bleiben? Soll man bleiben? Müssen Sie bleiben? bleibe?
Bitte beachten Sie, dass russische einteilige Sätze mit „kann“, „kann nicht“, „brauchen“ etc. + Infinitiv im Deutschen immer zweiteiligen Sätzen (also Sätzen mit Subjekt und Prädikat) entsprechen: Soll ich gehen? - Darf ich gehen? Ich muss gehen. - Ich muss gehen. Du kannst nicht gehen! - Man darf nicht gehen.
Auch russische einteilige Sätze mit Infinitiv im Deutschen entsprechen zweiteiligen Sätzen: Transfer? - Soll ich übersetzen? Sollen wir übersetzen? Soll man übersetzen? Soll ich lesen? - Soll ich lesen? Sie verstehen das nicht. - Das können sie nicht verstehen.
Verb wollen bedeutet Wunsch oder Absicht: Er will das wissen.- Er will es wissen. Am Abend wollen wir ins Theater gehen. - Abends gehen (wollen, beabsichtigen) wir ins Theater . Wolle Wollen wir nach Hause gehen! Gehen wir nach Hause! Gehen wir nach Hause!(Vergleiche die Verwendung der 1. Person Plural des Imperativs. Gehen wir nach Hause! - Gehen wir nach Hause! Gehen wir nach Hause).
Verb wollen kann eine abgeschwächte modale Bedeutung haben; in diesem Fall die Kombination wollen mit dem Infinitiv kommt dem Futurum nahe: Ich Wille alles tun, was ich kann. - Ich werde alles tun, was kann.
Verb mogen hat zwei Hauptbedeutungen:
a) mögen bedeutet „lassen, müssen; kann sein": Er mag morgen kommen. - Lassen Sie ihn morgen kommen. (Er sollte morgen kommen.)(vgl. auch verwenden mogen in diesem Sinne in Nebensätzen mit indirekter Rede).
6) mogen bedeutet in diesem Sinne "wollen, begehren". mogen Die Bindehaut wird im Präteritum verwendet: Ich möchte Sie etwas fragen. - Ich würde dich gerne etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie etwas fragen.
Verb lassen - ließ-gelassen Es wird auf zwei Arten als Modalverb verwendet:
a) lasen vt hat die Bedeutung "befehlen, fragen, erzwingen": Der Dekan läßt Sie morgen kommen.- Der Dekan sagt Ihnen (bittet Sie) morgen zu kommen. Der Lektor lässt uns viel lesen. - Der Lehrer lässt uns viel lesen.
Achten Sie auf die Übereinstimmung lassen Russisch „lassen“: Lassen Sie ihn sprechen. - Lassen Sie ihn sagen. In diesem Fall wird im Russischen auch folgende Variante verwendet: Lassen Sie ihn sprechen. - Lassen Sie ihn reden. Lassen Sie mich sprechen. - Lass es mich erzählen.
Außerdem das Verb lassen in den folgenden Ausdrücken enthalten: sich (Dat.) etw. nähen lassen - etwas für sich selbst nähen (oder: sich hingeben was -l. nähen): Ich lasse mir ein neues Kleid nähen.- Ich nähe mir ein neues Kleid. Ich habe mir ein neues Kleid geschenkt. usw. reparieren fassen - zur Reparatur geben: Er ließ seine Uhr reparieren. - Er gab seine Uhr zur Reparatur, sich (Akk.) rasieren lassen - zum Rasieren (beim Friseur): Er letzte sich immer hier rasieren. - Er rasiert sich immer hier..
Lassen Es wird auch in Anreizsätzen verwendet: Laß(t) uns nach Hause gehen! - Gehen wir nach Hause, (vgl.: die gleichbedeutende Verwendung des Modalverbs wollen ).
b) sich lassen - hat die Bedeutung von Möglichkeit (d.h. ist ein Synonym für können ): Das lässt sich machen.- It can done. Das lässt sich nicht machen. - Das geht nicht. Dieser Text läßt sich leicht übersetzen. - Dieser Text ist leicht zu übersetzen.
Verb Kombination lassen mit einem anderen Verb, wenn es ins Russische übersetzt wird, ist es oft unzerlegbar, d.h. ihre Bedeutung ergibt sich nicht aus der Summe der Bedeutungen dieser beiden semantischen Verben (zum Beispiel: Äh letzte uns viel lesen.- Er macht uns viel lesen ), hat aber ein anderes russisches Äquivalent, in dem die Bedeutung lassen nicht direkt reflektiert, z.B.: mit sich reden lassen - to be accommodating, sich (Dat.) etwas gefallen lassen - to ertragen, etwas ertragen. Im Wörterbuch sollte die Übersetzung solcher Kombinationen ins Russische im Wörterbucheintrag eingesehen werden lassen . Lassen kann auch mit anderen Verben ein zusammengesetztes Verb bilden: fallenlassen - fallen lassen.
Modalverben werden häufiger in einfachen Zeitformen verwendet als in komplexen; daher wird das Präteritum häufiger verwendet , als perfekt. Modalverben können, mögen, dürfen (letzteres in Präteritumform Bindehaut dürfte ), Mussen, Sollen und wollen in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, kann verwendet werden, um verschiedene Arten von Annahmen auszudrücken; In diesem Sinne werden Modalverben wie folgt ins Russische übersetzt:
a) können, mogen in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, werden mit den Worten „vielleicht, vielleicht, es scheint“ und der persönlichen Form des Verbs ins Russische übersetzt: Er kann (mag) nach Hause gegangen sein. - Vielleicht (vielleicht, vielleicht scheint es) ist er nach Hause gegangen. Er kann (mag) krank sein. - Vielleicht (vielleicht, vielleicht scheint es) ist er krank.
Bei der Übersetzung eines Fragesatzes werden „vielleicht, vielleicht“ usw. jedoch normalerweise weggelassen: Wann kann (mag) er nach Hause gegangen sein? - Wann ist er nach Hause gegangen? (Wann konnte er nach Hause gehen?).
b) dürfen im Preter die Bindehaut (d.h. in der Form dürfte ) in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, wird mit den Worten „anscheinend, anscheinend, vielleicht scheint es“ und der persönlichen Form des Verbs ins Russische übersetzt: Er dürfte schon nach Hause gegangen sein. - Er ist anscheinend (anscheinend, vielleicht, so scheint es) bereits nach Hause gegangen. Er dürfte krank sein. - Er ist anscheinend (scheinbar, vielleicht, so scheint es) krank.
(Wenn es eine Verneinung gibt, ist es auch möglich, die Wörter „kaum“ zu übersetzen: Das dürfte nicht richtig sein. - Es ist kaum richtig..)
Bei der Übersetzung des Fragesatzes „anscheinend, scheinbar“ etc. meist weggelassen: Dürfte es richtig sein? -Das ist richtig? Dürfte er sich geirrt haben? - Er hat sich nicht geirrt?
in) müssen in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, wird es mit den Worten „muss, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, offensichtlich“ und der Personalform des Verbs ins Russische übersetzt: Er muß nach Hause gegangen sein. - Er muss (wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, offensichtlich) nach Hause gegangen sein. Er muss krank sein. - Er muss (wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, offensichtlich) krank sein.
G) Sollen in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, wird es mit den Worten „sie sagen, berichten“ usw. ins Russische übersetzt. und folgendem Nebensatz: Er soll nach Hause gegangen sein. Sie sagen, er sei nach Hause gegangen. Er soll krank sein. Sie sagen, er ist krank. Die Delegation soll Moskau schon verlassen haben. - Es wird berichtet, dass die Delegation Moskau bereits verlassen hat.
Die angegebene Kombination kann auch durch die Worte "nach Informationen, nach Berichten" usw. ins Russische übertragen werden. und die Personalform des Verbs. Die Delegation soll Moskau schon verlassen haben.- Nach vorliegenden Informationen hat die Delegation Moskau bereits verlassen. Sollen in der oben angegebenen Bedeutung kann es in einem Satz verwendet werden, in dem bereits aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, dass fremde Worte übermittelt werden: Es wird gemeldet, die Delegation soll nach Kiew gefahren sein. - Es wird berichtet, dass die Delegation nach Kiew abgereist ist.
e) wollen in Kombination mit dem Infinitiv II, seltener mit dem Infinitiv I, wird es ins Russische übersetzt mit den Worten „er behauptet“, „er sagt“ und dem anschließenden Nebensatz, der das Wort „angeblich“ enthalten kann: Er (sie) wird selbst dabei gewesen sein. - Er (sie) behauptet, dass er (angeblich) gleichzeitig anwesend war.
Verben haben und sein kann in Sonderzügen auch im modalen Sinne verwendet werden:
1) haben+zu+ der Infinitiv hat in der Regel die Bedeutung von Verpflichtung, Notwendigkeit: Ich habe noch zu arbeiten. - Ich muss (ich muss) arbeiten. Wir haben noch eine Stunde zu fahren. - Wir (müssen) noch eine Stunde gehen. Ich hatte noch zu arbeiten. - Ich musste (ich musste) noch arbeiten.
Synonym für Kombination haben + zu + Infinitiv sind Modalverben müssen und Sollen mit Infinitiv: Ich habe noch zu arbeiten. = Ich muss (soll) noch arbeiten.
weniger oft haben + zu + der Infinitiv hat die Bedeutung der Möglichkeit: Er hat nichts zu sagen.- Er kann nichts sagen. Er hat nichts zu sagen. Er hat viel zu berichten. - Er hat viel zu sagen. Er hat etwas zu sagen.
2) sein + zu + der Infinitiv drückt je nach Kontext aus: a) die Bedeutung von Verpflichtung, Notwendigkeit, b) die Bedeutung von Möglichkeit; Kombination sein + zu + der Infinitiv hat eine passive Bedeutung.
a) Die Rechnung ist gleich zu bezahlen.- Die Rechnung muss sofort bezahlt werden. Die Rechnung ist sofort zu bezahlen. Die Rechnung war gleich zu bezahlen. - Die Rechnung musste sofort bezahlt werden. Die Versammlung ist von allen zu besuchen. - Jeder sollte zu dem Treffen kommen.
b) Das ist leicht zu tun. - Es (kann) leicht gemacht werden. Diese alte Maschine ist nicht mehr zu benutzen. - Dieses alte Auto kann nicht mehr verwendet werden. Das war leicht zu tun. - Es (könnte) einfach sein.
Synonyme für sein + zu + Infinitiv sind Modalverben Mussen, Sollen, Könn mit passivem Infinitiv: Die Rechnung ist gleich zu bezahlen. = Die Rechnung muss (soll) gleich bezahlt werden. - Die Rechnung muss sofort bezahlt werden. Das ist leicht zu tun. = Das kann leicht getan werden.- It (can) be done easy.
Übersetzung ins Russische von Verben mit modaler Bedeutung: glauben, scheinen, suchen, verstehen, wissen . Diese Verben werden Modalverben genannt, weil Im Gegensatz zu Modalverben ist ihre grundlegende Bedeutung nicht modal. Also zum Beispiel der Hauptwert suchen „suchen“ und seine modale Bedeutung ist „versuchen“.
Mit dem Infinitiv eines anderen Verbs erhalten sie eine modale Bedeutung und werden wie folgt übersetzt:
1) glauben - scheinen (+ Zusatz im dänischen Fall): Ich glaube, Sie zu kennen. - Ich glaube ich kenne Sie. Erglaubte diesen Mann zu kennen. Er glaubte, diesen Mann zu kennen. Er glaubt alles verstanden zu haben. Er schien alles zu verstehen.
2) Ketten - scheinen: Er scheint diesen Mann zu kennen. Er scheint diese Person zu kennen. Äh schien diesen Mann zu kennen. - Es schien (dass) er diese Person kannte. Er scheint, alles vergessen zu haben. - Anscheinend hat er alles vergessen. Er scheint klug (zu sein). - Er scheint schlau zu sein.
3) suchen - Versuch es Er sucht uns zu helfen. Er versucht (versucht), uns zu helfen. Er sucht uns zu überzeugen. - Er versuchte (versuchte), uns zu überzeugen.
4) verstehen - in der Lage sein: Er versteht zu überzeugen. - Er weiß zu überzeugen.
5) Wissen - in der Lage sein: Er weiß zu schweigen. - Er weiß, wie man schweigt. Er weiß zu überzeugen. - Er weiß zu überzeugen. Ich weiß Ihnen nicht zu helfen. - Ich kann dir nicht helfen.
Was ein deutscher Nebensatz ist, können Sie anhand der folgenden Grafik anhand eines Beispiels verstehen:
Wie Sie sehen können, kann der Nebensatz vor oder nach dem Hauptsatz stehen.
In einem Nebensatz das Prädikat ist wert letzte. Wenn das Prädikat zusammengesetzt ist, steht der konjugierte Teil an letzter Stelle und der unveränderliche Teil davor. Die Verneinung „nicht“ steht vor dem Prädikat. Abnehmbare Aufsätze sind nicht abnehmbar. Das Subjekt kommt unmittelbar nach der Konjunktion.
Sie können die Wortstellung in einem deutschen Nebensatz in diesem Diagramm sehen:

Daher ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Prädikat am Ende des Präpositionalsatzes steht. Das Prädikat ist meistens ein Verb. Die unveränderlichen und konjugierten Teile erscheinen zum Beispiel, wenn wir ein Modalverb haben. Ich kann kommen. kann ist der konjugierte Teil, kommen ist der invariante Teil.
Es gibt ein paar Arten von Nebensätzen. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Arten von Nebensätzen, die einleitende Wörter (Konjunktionen, Pronomen) enthält, gefolgt von der oben beschriebenen Wortstellung im Nebensatz.
Die wichtigsten Arten von Nebensätzen:
1) Gründe:
Ich komme nichts, Weil ich bin krank. Ich komme nicht, weil ich krank bin.
Ich mache das Fenster auf, da es mir zu heiss ist. Ich mache das Fenster auf, weil es mir zu heiß ist.
2) Ziele:
Ich lerne Deutsch, damit ich eine gute arbeit finden kann. Ich lerne Deutsch, um einen guten Job zu finden.
Ich arbeite viel, damit meine kinder alles haben. Ich arbeite hart, damit meine Kinder alles haben.
Wenn die Zeichen in Haupt- und Nebensatz gleich sind, dann kannst du Umsatz mit verwenden ähm... zu:
damit ich Deutsch lerne. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen.
Ich bin nach Deutschland gekommen, Äh Deutsch zu lernen. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen.
3) Bedingungen:
Wenn es morgen nicht regnet, gehen wir in die Berge. Wenn es morgen nicht regnet, gehen wir in die Berge.
Stürze Sie Kinder haben, bekommen Sie eine Ermäßigung. Wenn Sie Kinder haben, erhalten Sie einen Rabatt.
4) Zeit:
Wenn du nach hause kommst, ruf mich bitte an. Wenn Sie nach Hause kommen, rufen Sie mich bitte an.
Wahrend Ich arbeite, sind meine Kinder im Kindergarten. Während ich arbeite, gehen meine Kinder in den Kindergarten.
Als ich acht war, habe ich das Schwimmen gelernt. Als ich acht Jahre alt war, lernte/lernte ich schwimmen.
Seitdem Ich wohne in Moskau, habe ich immer einen guten Job. Da ich in Moskau lebe, habe ich immer einen guten Job.
Wir haben noch eine Stunde Zeit, bis die Gäste kommen. Wir haben noch eine Stunde, bis die Gäste ankommen.
Sobald du fertig bist, fangen wir an. Sobald Sie bereit sind, fangen wir an.
vor ich einkaufen gehe, schreibe ich mir immer eine Einkaufsliste. Bevor ich einkaufen gehe, schreibe ich mir immer eine Einkaufsliste.
Nachdem ich die Prüfung bestanden habe, kann ich mich erholen. Nachdem ich die Prüfung bestanden habe, kann ich mich ausruhen.
5) Orte und Anfahrt:
Ich mag wissen, weh wir sind. Ich würde gerne wissen, wo wir sind.
Ich weiß nichts, wohin dieser Weg führt. Ich weiß nicht, wohin dieser Weg führt.
6) Zugeständnisse:
Obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Auch wenn es regnet, gehe ich spazieren.
7) Vergleiche:
Je mehr Geld ich verdiene, destruktiv mehr Steuern muss ich bezahlen. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Steuern muss ich zahlen.
Sie sprechen besser Deutsch, als wir erwartet haben. Sie sprechen besser Deutsch als wir erwartet haben.
8) Zusätzlicher Nebensatz:
Mann sagt, Klasse Benzin bald wieder wird teurer. Sie sagen, dass der Benzinpreis bald wieder steigen wird.
Könnt ihr mir bitte sagen, wie Funktioniert dieses Gerät? Können Sie mir sagen, wie dieses Gerät funktioniert?
Ich weiß noch nichts, ob ich morgen ins Schwimmbad gehe. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen ins Schwimmbad gehe.
9) Definitiver Nebensatz:
Ich möchte einen Mann heiraten, der mich immer verstehen WIRD. Ich möchte einen Mann heiraten, der mich immer versteht.
Ich mag eine Frau heiraten, sterben mich nie betrügen wird. Ich möchte eine Frau heiraten, die mich niemals betrügen wird.
Ich möchte ein Kind haben, das mich niemals enttäuschen wird. Ich möchte ein Kind haben, das mich nie enttäuschen wird.
Ich möchte diesen Film sehen, von dem alle sprechen. Ich würde gerne diesen Film sehen, über den alle reden.
Und hier sind die Gewerkschaften, die NICHT BEEINTRÄCHTIGEN auf die Wortstellung des Satzes, den sie eingeben:und, aber, denn, oder, aber
Die Wortstellung nach diesen Vereinigungen ist genau die gleiche wie im Hauptsatz: Der konjugierte Teil des Prädikats steht an zweiter Stelle.
Er sagte sicher, denn er hatte sich auf die Prüfung gut vorbereitet.
Er antwortete selbstbewusst, da er sich gut auf die Prüfung vorbereitete.
Ich habe keine Zeit und ich gehe nicht zum Fußball.
Ich habe keine Zeit und gehe nicht zum Fußball.
Übung: Setze passende Konjunktionen ein
1) ... du willst, begleite ich dich nach Hause.
2) Ich muss viel arbeiten,... ich habe genug Geld.
3) ... ich krank bin, muss ich meine Arbeit erledigen.
4) Ich weiß nicht,... wir machen sollen.
5) ... du das nicht machst, rede ich nicht mehr mit dir.
6) Ich gehe nach Hause,... ich müde bin.
Die Struktur eines einfachen gemeinsamen deklarativen Satzes (PRPP).
Formale Zeichen und Ausdrucksmöglichkeiten von Subjekt und Prädikat.
Direkte und umgekehrte Wortstellung in einem Satz.
Die Grundlage der grammatikalischen Struktur und des logischen Inhalts des PRPP bilden die Hauptsatzglieder - das Subjekt und das Prädikat, sie werden ergänzt durch die Nebensatzglieder - Zusatz, Definition, Umstand, zum Beispiel:
Subjekt Prädikat Objekt Objekt
Die Firma liefert heute dem Kunden die Ware nicht. -
Die Firma liefert heute keine Waren an den Kunden aus.
Formale Merkmale und Ausdrucksmöglichkeiten des Themas.
Das Subjekt ist die Person (Sache), die die Handlung ausführt, oder die Person (Sache), die die Handlung durchmacht. Das Thema beantwortet die Fragen Wer? oder was? und kann im deutschen Satz an 1. oder 3. Stelle stehen, zum Beispiel:
Wenn das Subjekt durch ein Substantiv mit einer Definition ausgedrückt wird, sollten wir über die Gruppe des Subjekts sprechen, zum Beispiel:
Formale Zeichen und Ausdrucksmöglichkeiten des Prädikats.
Das Prädikat ist das Hauptglied des Satzes, das die mit dem Subjekt verbundene Handlung ausdrückt und die Fragen beantwortet, was das Subjekt (die Person) tut? Was passiert mit ihm? Was ist er? Was ist er? Das Prädikat stimmt mit dem Subjekt in Person und Zahl überein.
Das Prädikat kann sein: ein einfaches Verb (ausgedrückt durch ein Verb), ein zusammengesetztes Verb (besteht aus mehreren Verben) und ein zusammengesetztes Nominal (besteht aus einem verbindenden Verb und einem Nominalteil).
Das Prädikat in einem deutschen Satz steht immer an zweiter Stelle. Wenn der Satz ein zusammengesetztes verbales Prädikat enthält, steht sein gebeugter Teil an zweiter Stelle und der unveränderliche Teil an letzter Stelle.
An zweiter Stelle (dem variablen Teil des Prädikats) können stehen:
a) semantische Verben (reisen, wohnen, studieren):
Viele Touristen reisen über Leipzig nach Berlin.
b) Hilfsverben (haben, werden, sein):
Maiers haben den Mietvertrag unterschrieben. Sie sind schon ausgezogen. Herr Maier wird die neue Stellung wahrscheinlich bekommen.
c) Modalverben (können, dürfen, wollen, sollen, mößen, mögen):
Herr Müller will ein Haus bauen. Er muI lange sparen. Der Architekt soll ihm einen Plan für einen Bungalow machen.
d) die Verben stehen, lassen, bleiben, helfen, hören, lehren, verwendet als Teil zusammengesetzter Verben mit Infinitiv:
Er bleibt bei der Begräung sitzen.
An letzter Stelle (invarianter Teil) kann stehen:
a) die unbestimmte Form des Verbs - der Infinitiv (lernen, kommen, gehen):
Nach dem Unfall muYaten wir zu FuYa nach Hause gehen. Ich werde dich nicht vergessen.
b) Partizip II (gegangen, gelernt, gekommen):
Der Käufer hat einen günstigen Preis geboten. Ich wurde im Unterricht viel gefragt.
c) die komplexe Form des Aktiv-Infinitivs (gelernt haben, gekommen sein):
Sie werden ihre Bücher ganz sicher mitgenommen haben.
d) eine komplexe Form des passiven Infinitivs (gelernt werden, übersetzt werden)
Der Vertrag wird ins Deutsche übersetzt.
c) trennbares Präfix des Verbs:
Die Studenten geben die Prüfungen ab. Füllen Sie bitte die Zolldeklaration aus!
Direkte und umgekehrte Wortreihenfolge in PRPP.
Wie Sie bereits wissen, enthält der Satz die Hauptglieder - das Subjekt und das Prädikat, und die Nebenglieder - den Zusatz, die Definition und den Umstand. Die Stellung von Subjekt und Prädikat im Deutschen ist streng geregelt.
Das Prädikat (ein einfaches verbales Prädikat oder ein gebeugter Teil eines zusammengesetzten verbalen Prädikats) steht immer an zweiter Stelle! Das Fach kann den 1. oder 3. Platz belegen.
Bei der direkten Wortstellung steht das Subjekt an erster Stelle, das Prädikat an zweiter Stelle, dann folgt der Rest des Satzes. In umgekehrter Reihenfolge der Wörter steht das sekundäre Element des Satzes an erster Stelle (häufiger Zeit- oder Ortsumstände), an zweiter Stelle in der Regel das Prädikat, an dritter Stelle - das Subjekt, dann die verbleibende sekundäre Glieder des Satzes.