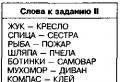König Heinrich VIII.: Reformator, Lebenslustiger und Polygamist. Heinrich VIII. litt unter seinem blauen Blut
Großbritannien nimmt historisch einen besonderen Platz in Europa ein. Durch das Meer von Kontinentaleuropa getrennt, weist Foggy Albion, obwohl es Teil der Alten Welt bleibt, gleichzeitig viele kardinale Unterschiede zu seinen Nachbarn auf.
Heinrich VIII. als junger Mann im Jahr der Thronbesteigung (1509). Foto: commons.wikimedia.org
Zu diesen Unterschieden gehört die anglikanische Kirche – eine christliche Konfession, die nicht nur und weniger als Ergebnis religiöser Diskussionen, sondern aufgrund des stürmischen Temperaments und der Ambitionen von König Heinrich VIII. entstanden ist.
Geboren 1491 als jüngster Sohn Heinrich VII sollte kein Monarch, sondern Priester werden. Schon in jungen Jahren studierte er Theologie, besuchte täglich bis zu sechs Messen und verfasste sogar selbst Abhandlungen zu religiösen Themen.
Die Pläne seines Vaters für den Prinzen änderten sich 1502 dramatisch, als Henrys älterer Bruder starb. Arthur.
Ein 11-jähriger Junge, der sich darauf vorbereitete, sein Leben dem Dienst Gottes zu widmen, musste sich fortan darauf vorbereiten, den Staat zu regieren.
Außerdem kündigte Heinrich VII. seinem Sohn an, dass er heiraten würde ... die Witwe seines Bruders, der spanischen Prinzessin Katharina von Aragon. Der König wollte die Bindungen zu Spanien um jeden Preis festigen, und selbst der Tod seines ältesten Sohnes nur wenige Monate nach der Hochzeit änderte nichts an seinen Absichten.
Außerdem wollte der verwitwete König Katharina selbst heiraten, aber die Spanier waren dagegen.
Für den jungen Prinzen steht die Welt Kopf. Gestern noch war er fünf Minuten entfernt Priester, gebunden an ein Keuschheitsgelübde, und heute ist er bereits fünf Minuten entfernt König mit seiner rechtmäßigen Frau.
Verteidiger des Glaubens
Der unter dem Namen Heinrich VIII. gekrönte Prinz bestieg den Thron im Alter von 17 Jahren. In den ersten Jahren seiner Herrschaft stand er unter dem Einfluss des Bischofs Richard Fuchs und Erzbischof William Wareham.
Katharina von Aragon. Foto: commons.wikimedia.org
In den frühen Jahren der Herrschaft Heinrichs VIII. schien die Position der katholischen Kirche in England unerschütterlich zu sein, und der Wind der Reformation, der auf dem Kontinent an Stärke gewann, würde den Engländern nichts anhaben.
Der junge König blieb fromm, besuchte mehrmals täglich die Messe und wurde 1521 von einem anderen seiner Mentoren, Kardinal, inspiriert Thomas Wolsey, schrieb das Buch „Zur Verteidigung der sieben Sakramente“, in dem er sich für die Verteidigung der katholischen Kirche gegenüber Kirchenreformern aussprach.
Für dieses Buch, der Papst Leo X ehrte Heinrich VIII. mit dem Titel „Verteidiger des Glaubens“.
Aber je weiter, desto mehr veränderte sich der König. Er kostete die Reize weltlicher Macht, schloss sich den verschiedenen Freuden des irdischen und nicht des geistlichen Lebens an und ärgerte sich bald über verschiedene Einschränkungen und Hindernisse, die sich aus den breiten Rechten des Klerus ergaben, für die der Hauptherrscher nicht war der König von England, sondern der Papst.
Papa verbietet!
In seiner Ehe mit Katharina von Aragon hatte er mehrere Kinder, aber alle Jungen starben im Säuglingsalter, nur Tochter Maria überlebte.
Der englische König wollte nicht zustimmen, dass „alles der Wille Gottes ist“, und entschied, dass der richtige Ausweg aus der Situation darin bestehen würde, die Königin zu wechseln.
Außerdem hatte er bereits den „Nachfolger“ abgeholt - der Sohn Heinrichs VIII. Sollte einen Favoriten zur Welt bringen
Anna Bolein. Foto: commons.wikimedia.org
Die theologische Schule der Jugend war nicht umsonst: Der König erklärte, der Grund für seinen Mangel an Söhnen sei die Illegalität seiner ersten Ehe. Heinrich VIII. argumentierte, dass die Heirat mit der Witwe eines Bruders nicht in die Kanonen passe und dass die Ehe die Erlaubnis des Papstes benötige, die nicht erhalten wurde. Und wenn es keine Erlaubnis gab, sollte die Ehe annulliert werden.
Aber alle Argumente des Königs wurden durch die Entscheidung von Papst Clemens VII. zunichte gemacht, der sich weigerte, die Ehe Heinrichs VIII. mit Katharina von Aragon zu annullieren.
Revolution von oben
Die legitime Königin und ihre Anhänger feierten den Sieg, und Heinrich VIII. war wütend. Warum entscheidet ein römischer Heiliger über das Schicksal des englischen Königshauses? Warum sollte er, der König, auf die Meinung eines Mönchs angewiesen sein?
Ja, aus dem frommen Jungen wurde ein gebieterischer und entschlossener Monarch, der bereit war, das gewünschte Ziel zu erreichen.
Die Kirchenreformer, die bis dahin in England wenig Einfluß gehabt hatten, erhoben die Köpfe. Dennoch hatten sie die einmalige Chance, ihre Position im Land zu ändern.
1529 berief Heinrich VIII. das englische Parlament ein und suchte bereits von ihm aus eine Lösung für die Frage der Annullierung der Ehe. Im Parlament zeigte sich eine Spaltung - die Anhänger Roms und die Anhänger der Reformation standen jeder für sich. Aber der König verstand selbst klar, auf wen er sich weiter verlassen konnte und wer sein schlimmster Feind werden würde.
Das erste Opfer des Kampfes des Königs war sein ehemaliger Mentor und Berater. Thomas Wolsey, ein glühender Anhänger des Katholizismus, der des Hochverrats beschuldigt wurde. Wolsey wurde mit einem Schafott bedroht, aber im Gegensatz zu anderen hatte er bis zu einem gewissen Grad Glück - er starb eines natürlichen Todes vor dem Prozess.
Und Heinrich VIII. beschloss, den gordischen Knoten zu durchschlagen, beschuldigte alle englischen Geistlichen auf einmal des Hochverrats. Der König sagte, dass die Treue der Priester zu Rom in der gegenwärtigen Situation nichts anderes als ein Angriff auf die königliche Macht sei.
1532 wurde in England ein Gesetz verabschiedet, das es englischen Untertanen verbietet, sich der Autorität ausländischer Souveräne, einschließlich des Papstes, zu unterwerfen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes gingen Hunderte von einflussreichen Anhängern des Katholizismus ins Gefängnis und ins Hackklotz.
Im selben Jahr, 1532, wurde der oberste Priester von England, der Erzbischof von Canterbury, ernannt Thomas Kranmer, ein offener Anhänger des Protestantismus. Er erfüllte den Wunsch Heinrichs VIII. und annullierte vor dem Kirchengericht die Ehe des Königs, woraufhin er Anne Boleyn heiratete.
Papst Clemens VII. exkommunizierte den englischen König aus der Kirche, was Heinrich VIII. nur verärgerte und ihn zu weiteren Maßnahmen drängte.
1534 wurde das vielleicht wichtigste Dokument der englischen Reformation, der Act of Supremacy, verabschiedet. Seiner Meinung nach war das Oberhaupt der englischen Kirche nicht der Papst, sondern der regierende Monarch. Der Papst in England beeinflusste nichts mehr.
Um den Widerstand der Gegner zu brechen, griff Heinrich VIII. die Klöster an, schloss sie und beschlagnahmte das Land. Gleichzeitig führten Cranmer und seine Anhänger innerkirchliche Reformen im Geiste des Protestantismus durch und unterdrückten Gegner rücksichtslos.
Eine Frau, zwei Frauen, drei Frauen...
Leider wurde das Hauptziel, für das der König trotz allem vorging, nicht erreicht - Anna Boleyn gebar ihm keinen Sohn, sondern eine Tochter namens Elisabeth.
Heinrich VIII. war furchtbar enttäuscht. Außerdem erwies sich Anna als sehr eigensinnig und erlaubte sich viel mehr, als sich die Königin laut ihrem Ehemann leisten konnte.
Jane Seymour. Foto: commons.wikimedia.org
Sehr bald fand der König eine neue Leidenschaft, eine Trauzeugin. Aber wenn Heinrich VIII., Als er die erste Frau loswurde, einen gewissen Humanismus zeigte, handelte er grausam mit Anna, die ihn enttäuschte - wegen Staats- und Ehebruchs angeklagt, die zweite Frau des Königs wurde enthauptet.
Danach geriet Heinrich VIII. in ernsthafte Schwierigkeiten, brachte am Ende seines Lebens die Zahl seiner Frauen auf sechs, von denen er sich von zweien scheiden ließ, und richtete zwei weitere wegen Hochverrats hin.
Gleichzeitig war der König, der aus politischen Gründen die Kirchenreform initiierte, kein überzeugter Anhänger des Protestantismus, sodass sich die Kirchenpolitik je nach religiösen Ansichten der nächsten Frau änderte.
Henry VIII setzte sich durch - Jane Seymour gebar ihm einen Sohn. Aber der König fand nie heraus, dass er es versäumt hatte, das Aussterben der Dynastie zu verhindern. Der einzige Sohn Heinrichs VIII., der im Alter von neun Jahren unter dem Namen Eduard VI. den Thron bestieg, starb im Alter von 15 Jahren, nachdem er es jedoch geschafft hatte, eine Reihe von Gesetzen zu erlassen, die die Position des Protestantismus stärkten.
Das goldene Zeitalter der Queen Elizabeth
Nach dem Tod von Eduard VI. wurde Maria, die Tochter von Katharina von Aragon, die von Heinrich VIII. verstoßen wurde, Königin von England. Als eifrige Katholikin, die ihren Vater hasste, war sie entschlossen, alle Reformen Heinrichs VIII. rückgängig zu machen und England in den Schoß des Katholizismus zurückzuführen.
Der Hauptreformer der englischen Kirche, Thomas Cranmer, der sich weigerte, seinen Glauben aufzugeben, wurde auf Befehl der Königin auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Auch viele seiner Unterstützer bezahlten ihren Glauben mit ihrem Leben. Als Maria ging ich in die Geschichte ein Maria Blutig.
Vielleicht wäre die von ihr begonnene Gegenreformation beendet worden, aber nach fünf Jahren Regierungszeit starb sie während einer der Epidemien.
Thronfolgerin war Elisabeth I. – die Tochter von Anne Boleyn, deren Geburt ihren Vater Heinrich VIII. so enttäuschte.
Obwohl die Königin kein großes Mitgefühl für ihren Vater hatte, beschloss sie dennoch, ihre Macht auf der Grundlage der unter Heinrich VIII. eingeleiteten Kirchenreformen zu stärken.
Die 35-jährige Regierungszeit von Elisabeth I., die als „Goldenes Zeitalter Englands“ bezeichnet wird, besiegelte schließlich den Sieg der Anhänger der anglikanischen Kirche.
Bis heute ist das Oberhaupt der Kirche in England der regierende Monarch – dank des leidenschaftlichen Temperaments und der Entschlossenheit Heinrichs VIII.
1509 starb König Heinrich VII. Tudor, nachdem er den englischen Thron mit Gewalt erobert hatte. Sein Sohn, der siebzehnjährige Heinrich VIII., nimmt die Macht selbst in die Hand. Damals hätte sich niemand vorstellen können, wie die Herrschaft dieses engelsgleichen Königs aussehen würde. Ursprünglich sollte die Krone an Henrys älteren Bruder Arthur gehen, aber nur wenige Monate nach seiner Hochzeit starb Arthur. Der älteste Sohn von Heinrich VII. und Elizabeth von York zeichnete sich immer durch eine sehr schlechte Gesundheit aus. Es wird behauptet, dass der junge Mann und die junge Frau all diese wenigen Monate vor dem Tod des Erben auf Wunsch des Königs getrennt lebten, da Arthur laut Heinrich VII Hochzeit, der Junge war bereits 15 Jahre alt, damals galt dieses Alter als normal für den Beginn einer ehelichen Beziehung). Das königliche Paar arrangierte lange Zeit eine Ehe zwischen dem englischen Thronfolger und Catalina (Catherine) von Aragon, der Tochter des Königs von Aragon. Durch diese vom Bürgerkrieg gequälte und von Frankreich ständig bedrohte Ehe wollte England diplomatische Beziehungen zu Spanien aufnehmen. Der zehnjährige Heinrich fiel bei der Hochzeit sehr auf: Ein aktives Kind hörte nicht auf, Spaß zu haben und tanzte sogar einen Tanz mit der sechzehnjährigen Frau seines Bruders. Damals hätte sich niemand vorstellen können, dass Catherine in 7 Jahren Henry heiraten würde.
Damals konnte die Ehe nur dann als offiziell angesehen werden, wenn die Braut ihrer Jungfräulichkeit beraubt wurde. Nach dem Tod des Erben wurde bewiesen, dass die endgültige Konsolidierung der Ehe zwischen Arthur und Catherine nicht stattgefunden hat.
Sieben Jahre lang lebte Catherine abseits des königlichen Hofes in England. Am Ende wurde sie nicht einmal zu den festlichen Veranstaltungen eingeladen. Aber in den diplomatischen Beziehungen zu Spanien musste etwas getan werden, außerdem bestanden Ferdinand und Isabella, Catherines Eltern, unerbittlich auf ihrer Heirat mit Henry. Sterbend sagte Heinrich VII. zu seinem Sohn: "Heirate Katharina." Im Jahr der Thronbesteigung heiratete der 17-jährige Heinrich VIII. die 23-jährige Katharina von Aragon.
Henrys Außenpolitik schwankte von einem Extrem zum anderen: Um eine Art Gleichgewicht zu erreichen, kämpfte er zuerst mit Frankreich, schloss dann Frieden und kämpfte dann erneut. Gleichzeitig versuchte er, die Beziehungen zu den Habsburgern, den Feinden Frankreichs, aufrechtzuerhalten, was ihm ebenfalls nicht sehr gut gelang.
Die Ehe mit Catherine war erfolglos: Heinrich, der davon besessen war, einen männlichen Erben zu finden, bekam von Catherine nur totgeborene Kinder. Für 33 Jahre Ehe (obwohl ihre intime Beziehung lange vor der Auflösung der Ehe aufhörte) hatten sie nur ein lebendes Kind - das Mädchen Maria, das später unter dem Spitznamen Bloody in die Geschichte eingehen sollte. Als der König 31 Jahre alt war, stellte ihn der Lordkanzler von England, Thomas Wolsey, der jungen Hofdame der Königin, Anne Boleyn, vor. Tatsächlich bereitete Wolsey, der mächtigste Mann in England nach dem König, durch diese Aktion die Voraussetzungen für seinen eigenen Sturz und den anschließenden Tod vor. Heinrich fiel sofort eine junge und aufgeweckte Trauzeugin auf. Aber Anne Boleyn wollte in den Armen des Königs nicht so schnell aufgeben, also spielte sie mehrere Jahre lang ein Spiel namens „Heirate mich und ich gehöre dir“. Aber als sie eine solche Bedingung stellte, konnte sie nicht anders, als zu verstehen, dass dann die Ehe mit Königin Catherine annulliert werden sollte. Zeitgenossen behaupteten, dass Henry von Boleyn völlig den Kopf verloren habe. Keine Schönheit, sie strahlte eine unglaubliche sexuelle Energie aus, die den König plagte. Anna wuchs am französischen Hof auf, wo sie offenbar charmanten Charme, feine Umgangsformen sowie Fremdsprachen, den Besitz mehrerer Musikinstrumente und ein hervorragendes Tanzvermögen erlernte.
Wie Wolsey, der den König gut kannte, einmal sagte: „Sei immer vorsichtig, welche Idee du in den Kopf des Königs steckst, denn du wirst sie dort nicht wieder herausnehmen.“ Heinrich war entschlossen, sich von Catherine scheiden zu lassen. In seiner Kindheit, vor dem Tod seines älteren Bruders, wurde er auf eine kirchliche Laufbahn vorbereitet (so war die damalige Tradition: Der älteste Sohn ist der Thronfolger, und einer der nachfolgenden bekleidet das kirchliche Hauptamt in der Kirche Land), das heißt, Heinrich VIII. musste sich auch als Erwachsener in Sachen Religion auskennen. 1521 schrieb Heinrich (mit Hilfe von Thomas More) sogar eine Abhandlung gegen den Protestantismus, in der er die Rechte des katholischen Glaubens verteidigte, mit dem Titel „Zur Verteidigung der sieben Sakramente“. Für diese Abhandlung verlieh der Papst von Rom Heinrich den Titel „Verteidiger des Glaubens“.
1525 machte sich Heinrich ernsthaft daran, die Ehe mit seiner jetzigen Frau loszuwerden. Der Papst, Clemens VII., hatte jedoch nie die Absicht, einer Scheidung zuzustimmen, da ein ausreichend begründeter Grund fehlte. Katharina von Aragon wird dem König definitiv keinen Erben geben, das haben 18 Jahre Beziehung gezeigt, aber für die katholische Kirche ist das kein Grund, eine im Himmel fixierte Ehe aufzulösen. Der entschlossene Heinrich umgab sich mit talentierten Theologen und Legaten (Anwälten), deren Ziel es war, in der Heiligen Schrift irgendetwas zu finden, das die Unehelichkeit seiner Ehe mit Katharina rechtfertigen würde.
Am Ende war die gewünschte Linie gefunden. Ein Sprichwort aus dem Buch Levitikus lautet: „Wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, ist das abscheulich; Er hat die Blöße seines Bruders offenbart, sie werden kinderlos sein." Henry befiehlt Wolsey sofort, die notwendigen Dokumente für eine Petition an Clement VII vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt kommt die Nachricht, dass Kaiser Karl V. von Habsburg Rom erobert hat und der Papst tatsächlich in seiner Gewalt ist. Unglücklicherweise für Henry war Charles Catherines Neffe, weshalb der tatsächlich als Geisel gehaltene Clemens VII. Einer Scheidung nicht zustimmte, sondern stattdessen einen Prozess anordnete, der schließlich mehrere Jahre dauerte. Bei einem der Treffen sagte Catherine: „Sir, ich beschwöre Sie, im Namen der Liebe, die zwischen uns war ... berauben Sie mich nicht der Gerechtigkeit, haben Sie Mitleid und Mitgefühl mit mir ... Ich greife auf Sie zurück als das Oberhaupt der Gerechtigkeit in diesem Königreich ... Herr und alle, ich rufe die Welt zu Zeugen, dass ich dir eine treue, demütige und gehorsame Frau war ... und ich habe viele Kinder für dich geboren, obwohl es den gefallen hat Herr, sie von dieser Welt zu mir zu rufen ... Als du mich zum ersten Mal angenommen hast, dann - ich rufe den Herrn als Richter - Ich war ein makelloses Mädchen, das ihren Mann nicht kannte. Ob das stimmt oder nicht, überlasse ich Ihrem Gewissen. Wenn es nach dem Gesetz einen fairen Fall gibt, den Sie gegen mich anklagen ... dann stimme ich zu, zu gehen ... Wenn es keinen solchen Fall gibt, dann flehe ich Sie an, lassen Sie mich in meinem früheren Zustand bleiben.
Der Oberste Richter aus Rom, Kardinal Lorenzo Campeggio, sagte daraufhin: „Ich werde kein Urteil fällen, bis ich einen Antrag beim Papst gestellt habe ... Die Anklage ist zu zweifelhaft, und die an dem Verfahren beteiligten Personen sind zu hoch in Position ... Was kann ich erreichen, indem ich den Zorn Gottes auf Ihre Seele ziehe, um jeden Herrscher oder edlen Menschen auf dieser Welt zufrieden zu stellen. Heinrich VIII. war es als kleines Kind gewohnt, alles, was er wollte, so schnell wie möglich zu bekommen. Nach einem solchen "Nichts" ergriff er die Waffen gegen Wolsey und beschuldigte ihn, mit dem Papst keine Scheidung aushandeln zu können. Der mächtigste Mann des Königreichs wurde nach York verbannt und durch seinen Sekretär Thomas Cromwell ersetzt. Er und einige andere nahestehende Personen fanden einen "Ausweg" aus der Situation: Schaffen wir den Katholizismus in England ab, machen den König zum Oberhaupt der neuen Kirche, und dann kann er die Dekrete erlassen, die er will. Von diesem Augenblick an brachen für England wirklich blutige Zeiten an.
Der Anglikanismus wurde im Königreich erklärt. 1532 heirateten Heinrich VIII. und Anne Boleyn heimlich. Im Januar des folgenden Jahres wiederholten sie das Verfahren in formellerer Form. Fortan galt Anna als Königin von England. Am 11. Juni 1533 exkommunizierte Clemens VII. den König aus der Kirche.
Kurz nach der Hochzeit bringt Anne Boleyn ein Mädchen zur Welt. Damals wussten sie noch nicht, dass dieses Kind die größte Königin in der Geschichte Englands werden würde, also wurde die kleine Elizabeth kalt empfangen. Da die Ehe mit Katharina von Aragon für unehelich erklärt wurde, wurde Maria, Heinrichs ältestes Kind, für unehelich erklärt, und Elisabeth wurde Thronfolgerin. Anne Boleyn hatte noch einmal die Chance, ihren „Fehler“ zu korrigieren: 1534 wird sie erneut schwanger, alle hoffen, dass es sich dabei endlich um einen Jungen handelt. Aber bald verliert die Königin ihr Kind, und dieser Moment kann als Beginn des Countdowns bis zu ihrem Tod angesehen werden.
Der Sturz von Anne Boleyn war flüchtig. Enttäuscht von seiner neuen Frau beginnt Heinrich den absurdesten Prozess. Aber diesmal ist er nicht geschieden: Er will Anna hinrichten. Plötzlich wurden mehr als fünf Liebhaber gefunden, mit denen die Königin angeblich geschlafen hatte (ihr Bruder wurde als einer von ihnen erkannt). All dies geschieht vor dem Hintergrund endloser Hinrichtungen von denen, die mit der neuen Religion und der Politik des "Fechtens" nicht einverstanden sind (da England sehr hochwertige Schafwolle produzieren konnte, waren der König und seine Berater zufrieden die Entscheidung, Manufakturen zu bauen und die Bauern von ihren Ländereien zu vertreiben, damit sie 14 Stunden am Tag in diesen Manufakturen zur Arbeit gehen würden.) Bei den gegnerischen Katholiken und wandernden getriebenen Bauern gab es nur eine Frage - hängen. Während der Regierungszeit von Heinrich VIII. wurden 75.000 Menschen gehängt. Viele machten daraufhin Anna Boleyn dafür verantwortlich, die zur Ursache der Kirchenreform im Land und damit zu einer der Schuldigen der meisten Todesfälle wurde. Auch ein langjähriger Freund des Königs, Thomas More, wurde Opfer des Terrors. Als glühender Katholik weigerte er sich, den neuen Glauben anzunehmen, weshalb Henry befahl, ihm den Kopf abzuschlagen.
Der Prozess gegen die Königin dauerte nicht lange. Vor dem Prozess hatte der König bereits eine neue Favoritin, Jane Seymour, mit der er nicht zögerte, offen in der Öffentlichkeit aufzutreten und ihr seine Sympathie zu zeigen. Am 2. Mai 1536 wurde die Königin verhaftet und in den Tower gebracht. Zuvor wurden ihre mutmaßlichen Liebhaber verhaftet, einige von ihnen gefoltert, um „wahrheitsgemäße“ Aussagen zu erpressen. Am 17. Mai 1536 wurden der Bruder der Königin, George Boleyn, und andere „Liebhaber“ hingerichtet. Am 19. Mai wurde Königin Anne Boleyn zum Schafott geführt. Ihr Kopf wurde mit einem einzigen Schwerthieb abgetrennt.
Sechs Tage nach der Hinrichtung seiner Frau heiratete Henry Jane Seymour, und bald erfreute die neue Königin alle mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Jane war eine sanfte, nicht konfrontative Frau, die ein gemütliches Familienumfeld für den König schaffen wollte. Sie versuchte, alle Kinder von Heinrich zu vereinen. Im Oktober 1537 begann für Jane eine Geburt, die für die zerbrechliche Königin wahrhaft schmerzhaft war: Sie dauerte drei Tage und endete mit der Geburt des englischen Thronfolgers Edward. Wenige Tage nach der Geburt starb die Königin an Wochenbettfieber.
Heinrich behauptete, dass er niemanden so sehr liebte wie Jane. Fast unmittelbar nach ihrem Tod befahl er Thomas Cromwell jedoch, sich eine neue Frau zu suchen. Aber wegen des Rufs des Königs wollte eigentlich niemand die neue Königin von England werden. Prominente Damen Europas hatten sogar verschiedene Witze, zum Beispiel: „Mein Hals ist zu dünn für den König von England“ oder „Ich würde zustimmen, aber ich habe keinen Ersatzkopf.“ Nachdem er von allen geeigneten Bewerbern abgelehnt worden war, machte sich der König auf die Überzeugung von Thomas Cromwell hin daran, die Unterstützung eines protestantischen Staates zu gewinnen. Heinrich wurde darüber informiert, dass der Herzog von Kleve zwei unverheiratete Schwestern hatte. Zu einem von ihnen wurde ein Hofmaler geschickt, der das Porträt anscheinend auf Befehl von Cromwell leicht verschönerte. Als der König Anna von Kleve sah, wollte er sie heiraten. Der Bruder der Braut war zunächst dagegen, aber als er hörte, dass Anna keine Mitgift verlangte, stimmte er zu. Ende 1539 begegnete der König seiner Braut unter dem Deckmantel eines Fremden. Henrys Enttäuschung kannte keine Grenzen. Nach einem Treffen mit Anna teilte er Cromwell wütend mit, dass er ihm anstelle seiner Frau eine "kräftige flämische Stute" mitgebracht hatte. Von dieser Zeit an begann der Fall von Cromwell, weil er eine Frau schlecht gewählt hatte.
Am nächsten Morgen nach der Hochzeitsnacht erklärte Heinrich öffentlich: „Sie ist überhaupt nicht süß und sie riecht schlecht. Ich habe sie so zurückgelassen, wie sie war, bevor ich bei ihr lag." Trotzdem hielt sich Anna mit Würde. Sie beherrschte schnell die englische Sprache und die Hofmanieren, wurde eine gute Stiefmutter für Henrys kleine Kinder und freundete sich sogar mit Mary an. Alle mochten Anna außer ihrem Mann. Bald leitete Henry ein Scheidungsverfahren ein, da Anna einst mit dem Herzog von Lothringen verlobt war und daher die jetzige Ehe keine Bestandsberechtigung habe. Der nicht mehr gesuchte Thomas Cromwell wurde 1540 zum Verräter erklärt. Cromwell wurde zuerst gefoltert, um ihn dazu zu bringen, sich selbst zu belasten, aber er bekannte sich nicht schuldig. Am 28. Juli 1540 bestieg er das Schafott und wurde durch Enthauptung hingerichtet.
Königin Anne unterzeichnete das Dokument, mit dem ihre Ehe mit Henry annulliert wurde. Der König hinterließ ihr eine anständige Zulage und mehrere Ländereien in England, und er selbst heiratete nach dem bereits langweiligen Muster bald Annas Trauzeugin Catherine Howard.
Die neue Königin (fünfte in Folge) war ein sehr fröhliches und süßes Mädchen. Heinrich schwärmte für sie, nannte seine neue Frau „eine Rose ohne Dornen“. Im Gegensatz zu früheren Königinnen machte sie jedoch einen undenkbaren Fehler – sie betrog ihren Ehemann mehr als einmal. Als der König darüber informiert wurde, dass seine Frau ihm untreu war, traf die Reaktion alle: Statt der üblichen Wutäußerung begann Heinrich zu weinen und zu klagen und sich darüber zu beschweren, dass das Schicksal ihm kein glückliches Familienleben beschert hatte, so auch alle seine Frauen betrügen oder sterben oder einfach ekelhaft sein Am 13. Februar 1542 wurde Katharina vor einer neugierigen Menge hingerichtet.
Auch im Alter wollte Henry nicht ohne Frau sein. Im Alter von 52 Jahren hielt der schlappe, fast unbewegliche König um die Hand von Catherine Parr an. Ihre erste Reaktion war erschrocken, aber am Ende war sie gezwungen, das Angebot anzunehmen. Nach der Hochzeit versuchte die neue Königin, das Familienleben des gebrechlichen Heinrich zu verbessern. Wie Jane Seymour vereinte sie alle legitimen Kinder des Königs, Elizabeth genoss ihre besondere Lage. Als hochgebildete Frau könnte sie Elizabeth durchaus ein Stück von dem bringen, was ihr geholfen hat, in Zukunft die größte Königin Englands zu werden.
Der Tod kam zu Heinrich, als er 55 Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sich nur noch mit Hilfe von Dienern fortbewegen, da er an starker Fettleibigkeit (sein Taillenumfang betrug 137 cm) und mehreren Tumoren litt. Mit der raschen Verschlechterung der Gesundheit wuchsen das Misstrauen und die Tyrannei des Königs. Catherine ging buchstäblich auf Messers Schneide: Wie alle Königinnen hatte sie vor Gericht ihre Feinde, die Henry regelmäßig über sie flüsterten. Der König hatte jedoch keine Zeit, etwas zu tun, selbst wenn er es wollte.
Heinrich VIII. Tudor
Englischer König Henry VIII Tudor.
Fragment eines Porträts von Hans Holben Jr.
Thyssen-Bournemouth-Sammlung.
Heinrich VIII. (Henry VIII. Tudor) (28. Juni 1491, Greenwich - 28. Januar 1547, London), Englisch König seit 1509, aus der Tudor-Dynastie, einer der prominentesten Vertreter des englischen Absolutismus.
Heinrich VIII. (1451-1547). König von England von 1509 bis 1547, Sohn Heinrich VII, Vater Elisabeth. Obwohl er selbst nicht dem Klerus angehörte, wurde Heinrich 1534 zum Initiator der Kirchenspaltung. Der König wollte eine besondere englische Form des Katholizismus schaffen, in der er selbst die Rolle des Papstes spielen sollte und die Dogmen und Rituale der römischen Kirche – einschließlich der lateinischen Anbetung, der sieben Sakramente und des Zölibats der Priester – bewahrt werden sollten . Der von Henry begonnene Prozess führte jedoch zu etwas anderen Ergebnissen als seinen ursprünglichen Plänen.
Syuami A. Elisabethanisches England / Henri Syuami. – M.: Veche, 2016, p. 337.
In der Regierung verließ sich Heinrich VIII. auf seine Favoriten: Thomas Wolsey, Thomas Cromwell, Thomas Cranmer. Während seiner Regierungszeit wurde in England die Reformation durchgeführt, die der König als Mittel zur Stärkung seiner Autokratie und zur Auffüllung der Staatskasse betrachtete. Der unmittelbare Anlass für die Reform der englischen Kirche war die Weigerung des Papstes Clemens VII genehmigen die Scheidung von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon und seine Ehe mit Anne Boleyn. Nach einem Bruch mit dem Papst proklamierte das Parlament 1534 den König zum Oberhaupt der englischen Kirche. Die renovierte Kirche behielt die katholischen Riten bei und erhielt den Namen der anglikanischen Kirche. Kanzler Thomas More, der sich dem Bruch mit dem Papst widersetzte, wurde des Hochverrats angeklagt und 1535 hingerichtet.
Heinrich VIII. säkularisierte 1536 und 1539 das Klosterland, von dem ein bedeutender Teil in die Hände des neuen Adels überging. Widerstand, besonders stark im Norden Englands ("Blessed Pilgrimage"), wurde von den königlichen Truppen brutal niedergeschlagen. Im Zusammenhang mit der Säkularisierung verschärfte sich der Prozess der Enteignung bäuerlicher Kleingärten und des Verderbens der Bauern. Um Vagabunden und Bettler zu bekämpfen, erließ Heinrich VIII. die Blutige Gesetzgebung gegen die Enteigneten. Unter den Bedingungen der begonnenen Agrarrevolution versuchte der König jedoch, die alte feudale Grundbesitzstruktur zu bewahren, insbesondere ergriff er Maßnahmen gegen Einfriedungen. Während der Regierungszeit Heinrichs VIII. führte England verheerende Kriege mit Frankreich und Schottland, die zusammen mit den enormen Kosten des königlichen Hofes zu einem völligen Zusammenbruch der öffentlichen Finanzen führten.
Urheberrecht (c) "Cyril und Methodius"
Henry VIII (28.VI.1491 - 28.I.1547) - englischer König von 1509, 2. der Tudor-Dynastie; einer der klügsten Vertreter des englischen Absolutismus. In seiner Jugend unterstützte er die Humanisten (T. More und seine Freunde). In den Jahren 1515-1529 wurde die Staatsverwaltung in den Händen von Kanzler Kardinal T. Woolsey konzentriert. Ab Ende der 20er Jahre begann die Regierungszeit Heinrichs VIII., verbunden mit der Reformation, die er als wichtiges Mittel zur Stärkung des Absolutismus und der königlichen Schatzkammer ansah; die rechte Hand Heinrichs VIII. war sein engster Lieblings-„Erster Minister“ T. Cromwell. Die Verschlechterung der Beziehungen zum Papst wurde durch das Scheidungsverfahren Heinrichs VIII. Mit Katharina von Aragon erleichtert, in dem der Papst eine kompromisslose Position einnahm, und seine Ehe mit der Favoritin Anne Boleyn. 1534 brach Heinrich VIII. mit dem Papst und wurde vom Parlament zum Oberhaupt der englischen (anglikanischen) Kirche ernannt ("Act of Supremacy", 1534); T. Mehr(Lordkanzler von 1529), der sich dieser Politik widersetzte, wurde hingerichtet (1535). 1536 und 1539 folgten die Schließung der Klöster und die Säkularisierung ihrer Ländereien. Der Widerstand gegen diese Politik wurde vor allem im Norden brutal niedergeschlagen (siehe „Gesegnete Pilgerreise“). In Sachen Reformation war Heinrich VIII. jedoch nicht konsequent; 1539 forderte er unter Todesstrafe von seinen Untertanen die Einhaltung der alten katholischen Riten. 1540 wurde Cromwell verhaftet und dann hingerichtet. Die enormen Ausgaben des Hofes, die Kriege mit Frankreich und Schottland führten am Ende der Regierungszeit Heinrichs VIII. zu einem völligen Zusammenbruch der Finanzen, trotz der enormen Einnahmen, die der König aus der Säkularisierung und dem Verkauf von Klostergütern erhielt. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Enteignung der Bauernschaft infolge der Säkularisation erließ er Gesetze gegen Landstreicher und Bettler (1530, 1536).
Obwohl die Politik Heinrichs VIII. bis zu einem gewissen Grad den Interessen des neuen Adels und der wachsenden Bourgeoisie entsprach, war seine Klassenstütze der feudale Adel (die Versuche Heinrichs VIII., die alte feudale Struktur des Landbesitzes in der Ära der beginnenden Agrarrevolution zu bewahren spiegelten sich insbesondere in seinen Maßnahmen zur Begrenzung von Gehegen wider).
In der modernen englischen bürgerlichen Literatur werden Tätigkeit und Persönlichkeit Heinrichs VIII. unterschiedlich betrachtet. So betont J. Macnee die Fülle an Macht, Kraft und Energie Heinrichs VIII., der angeblich die große Liebe des ganzen Volkes genoss. Im Gegenteil, Elton entwickelt die Idee, dass Henry VIII überhaupt kein besonders aktiver Herrscher war, dass sogar die Reformation – das wichtigste Werk von Henry VIII – im Wesentlichen das Werk von T. Cromwell war. Bei der Beurteilung des Absolutismus Heinrichs VIII. neigen englische bürgerliche Historiker, obwohl sie die Präsenz der „starken Macht“ Heinrichs VIII. und die Unterwürfigkeit der unter ihm tagenden Parlamente anerkennen, überwiegend dazu, Heinrich VIII. als „konstitutionellen König“ zu betrachten (dies Konzept wird vom Laboristen Elton geteilt). Dies widerspricht jedoch den tatsächlichen Verhältnissen, da das Parlament unter Heinrich VIII. eine eindeutig untergeordnete und keine führende Rolle spielte (er erließ 1539 sogar ein Gesetz, das königliche Verordnungen in ihrer Bedeutung mit parlamentarischen Akten gleichstellte).
V. F. Semenov. Moskau.
Sowjetische historische Enzyklopädie. In 16 Bänden. - M.: Sowjetische Enzyklopädie. 1973-1982. Band 4. DEN HAAG - DVIN. 1963.
Reformierte die Kirche
Henry (Henry) VIII (1491-1547) - der englische König seit 1509, während dessen Regierungszeit die Church of England geboren wurde und der Anglikanismus als eine spezifische Variante des Christentums Gestalt annahm. Die Entfernung der Katholischen Kirche von England aus der Kontrolle der Päpste, die von ihm durch eine Reihe von Staatsgesetzen durchgeführt wurde, wurde hauptsächlich durch politische Gründe verursacht, die mit der Notwendigkeit verbunden waren, die Macht Englands angesichts einer solchen Bedrohung zu stärken Katholische Länder wie Frankreich und Spanien. Das Verbot der Zahlung von Kirchensteuern an Päpste, die Beschlagnahme von Klostervermögen und andere Maßnahmen füllten die Staatskasse erheblich auf, was es ermöglichte, die Marine zu stärken und neue Diözesen zu gründen. Aus diesem Grund wurden die Reformen Heinrichs VIII. Vom örtlichen Klerus im Allgemeinen nicht abgelehnt. Der unmittelbare Grund für den Bruch mit Rom war die Scheidung von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon und seine Heirat mit Anne Boleyn. 1533 exkommunizierte Papst Clemens VII. Heinrich VIII. von der katholischen Kirche. 1534 wurde Heinrich VIII. zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche ernannt. Das Bemerkenswerte an der „Palastreform“ Heinrichs VIII. ist, dass mit Ausnahme des Wechsels der obersten Kirchengewalt in England der katholische Charakter der Kirchenstruktur, Dogmatik und Rituale keine wesentlichen Änderungen erfahren hat. Einige der protestantischen Neuerungen waren sehr gering.
Protestantismus. [Wörterbuch eines Atheisten]. Unter total ed. L. N. Mitrochin. M., 1990, p. 79.
Hans Holben jr. Heinrich der Achte. Palast. Berberini. Rom
Heinrich VIII., Tudor-König von England, der von 1509-1547 regierte. Sohn von Heinrich VII. und Elisabeth von York.
1) ab 1509 Katharina, Tochter von Ferdinand V., König von Spanien (geb. 1485 + 1536);
2) ab 1533 Anna Boleyn (geb. 1501 + 1536);
3) ab 1536 Jane Seymour (geb. 1500 + 1537);
4) ab 1539 Anna Klevekal (+ 1539);
5) ab 1540 Catherine Howard (+ 1542);
6) von 1543 Catherine Parr (+ 1548).
Henry war der jüngste Sohn von Henry VII, dem ersten Tudor-König. Sein älterer Bruder, Prinz Arthur, war ein gebrechlicher und kränklicher Mann. Im November 1501 heiratete er die aragonesische Prinzessin Catherine, konnte aber keine ehelichen Pflichten erfüllen. Bettlägerig hustete er, litt unter Fieber und starb schließlich im April 1502. Seine junge Witwe blieb in London. 1505 wurde zwischen den englischen und spanischen Gerichten eine Vereinbarung getroffen, dass Catherine ihren jüngeren Bruder heiraten würde, wenn er 15 Jahre alt wäre. Papst Julius II. Erließ trotz des Gebots der Bibel eine Ausnahmegenehmigung - eine Sondergenehmigung für die zweite Ehe von Katharina: „Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, ist dies abscheulich; Er hat die Nacktheit seines Bruders offenbart, sie werden kinderlos sein ... "
Im April 1509 starb Heinrich UNO und im Juni, kurz vor seiner Krönung, Heinrich UNO! Verheiratet mit Katharina. Kein König vor ihm ließ bei seiner Thronbesteigung freudigere Hoffnungen aufkommen: Heinrich war bei bester Gesundheit, von hervorragender Statur, galt als ausgezeichneter Reiter und erstklassiger Bogenschütze. Außerdem war er im Gegensatz zu seinem melancholischen und kränklichen Vater fröhlich und agil. Seit den ersten Tagen seiner Herrschaft wurden am Hof unaufhörlich Bälle, Maskeraden und Turniere veranstaltet. Die unter dem König stehenden Grafen klagten über die enormen Ausgaben für den Ankauf von Samt, Edelsteinen, Pferden und Theatermaschinen. Gelehrte und Reformer liebten Henry, weil er einen freien und aufgeklärten Geist zu haben schien; Er sprach Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch und spielte gut Laute. Wie bei vielen anderen Herrschern der Renaissance verbanden sich beim König jedoch Bildung und Liebe zur Kunst mit Laster und Willkür. Henry hatte eine sehr hohe Meinung von seinen Talenten und Fähigkeiten. Er bildete sich ein, alles von Theologie bis Militärwissenschaften zu wissen. Trotzdem machte er keine Geschäfte und delegierte sie ständig an seine Favoriten. Der erste Favorit unter ihm war Thomas Wolsey, der Kardinal und Kanzler der königlichen Kapläne wurde.
1513 war Heinrich in die Intrigen von Kaiser Maximilian und seiner Tochter Margarete im Krieg mit Frankreich verwickelt. Im Sommer landete der König in Calais und belagerte Terwanni. Maximilian, der sich ihm anschloss, besiegte die Franzosen bei Gingat. Henry selbst eroberte die Stadt Tournai. 1514 verließen die Verbündeten, Maximilian und Ferdinand von Spanien, Heinrich und schlossen Frieden mit Frankreich. Heinrich geriet in furchtbare Wut und konnte ihnen diesen Verrat lange nicht verzeihen. Er nahm sofort Verhandlungen mit Ludwig XII schloss mit ihm Frieden und schenkte ihm seine jüngere Schwester Maria. Tournay blieb in den Händen der Briten. Dieser Vorfall lehrte den englischen König jedoch die Feinheiten der Politik. In der Zukunft pflegte er mit seinen Verbündeten auch heimtückisch zu handeln, ging hin und wieder von einer Seite zur anderen, brachte England aber keine großen Vorteile.
In den theologischen Auseinandersetzungen der Zeit verhielt sich Heinrich ebenso. 1522 sandte er seine Schrift gegen die Reformatoren an den Papst. Für diese Arbeit erhielt er von Rom den Titel „Verteidiger des Glaubens“, und von Luther wurde er mit Beleidigungen überhäuft. Aber dann änderte der König unter dem Einfluss der Umstände seine Ansichten ins Gegenteil. Der Grund dafür waren seine Familienangelegenheiten. Königin Katharina war in den Jahren ihrer Ehe mehrmals schwanger, konnte aber 1516 nur ein gesundes Mädchen namens Mary zur Welt bringen. Nach zwanzigjähriger Ehe hatte der König immer noch keinen Thronfolger. So konnte es nicht weitergehen. Allmählich entstand eine Abkühlung zwischen den Ehepartnern. Ab 1525 teilte Henry kein Bett mehr mit seiner Frau. Katharina beschäftigte sich immer mehr mit Frömmigkeitsfragen. Sie trug ein Franziskaner-Sacktuch unter ihren königlichen Gewändern, und moderne Chroniken waren voll von Hinweisen auf ihre Pilgerreisen, Almosen und ständigen Gebete. Inzwischen war der König noch voller Kraft und Gesundheit und hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere uneheliche Kinder. Seit 1527 war er sehr vernarrt in die Hofdame der Königin, Anne Boleyn. Dann erteilte er Kardinal Wolsey einen verantwortungsvollen Auftrag – die Bischöfe und Anwälte des Königreichs zu versammeln, um über die rechtliche Widersprüchlichkeit des Edikts von Papst Julius II. zu urteilen, wonach er Katharina heiraten durfte. Dies stellte sich jedoch als äußerst schwierig heraus. Die Königin wollte nicht ins Kloster gehen und verteidigte hartnäckig ihre Rechte. Papst Clemens VII. wollte nicht einmal von einer Scheidung hören, und Kardinal Wolsey wollte die Heirat des Königs mit Anne Boleyn nicht zulassen und zog die Angelegenheit auf jede erdenkliche Weise in die Länge. Annas Cousin Francis Brian, der englische Botschafter in Rom, gelang es, einen geheimen Brief des Kardinals an den Papst zu bekommen, in dem er Clemens riet, Henrys Scheidung nicht voreilig zuzustimmen. Der König beraubte den Günstling all seiner Gefälligkeiten und verbannte ihn in ein fernes Outback und begann, Catherine grob und hart zu behandeln.
Thomas Cromwell, der Wolseys Platz einnahm, schlug Henry vor, sich von Catherine ohne päpstliche Erlaubnis scheiden zu lassen. Warum, sagte er, wolle der König nicht dem Beispiel der deutschen Fürsten folgen und sich mit Hilfe des Parlaments zum Oberhaupt der Landeskirche erklären? Diese Idee erschien dem despotischen König äußerst verlockend, und er ließ sich sehr bald überreden. Der Grund für den Angriff auf die Kirche war der Eid auf den Papst, der seit der Antike von den englischen Prälaten geleistet wurde. In der Zwischenzeit hatten sie nach englischem Recht nicht das Recht, jemandem außer ihrem Souverän die Treue zu schwören. Im Februar 1531 wurde auf Geheiß Heinrichs das höchste Strafgericht Englands wegen Gesetzesverstoßes gegen den gesamten englischen Klerus angeklagt. Die Prälaten, die sich zur Einberufung versammelt hatten, boten dem König eine große Geldsumme an, um den Prozess zu stoppen. Henry antwortete, dass er etwas anderes brauche – nämlich, dass der Klerus ihn als Beschützer und alleiniges Oberhaupt der englischen Kirche anerkenne. Bischöfe und Äbte konnten dem Eigensinn des Königs nichts entgegensetzen und willigten in unerhörte Forderungen ein. Daraufhin verabschiedete das Parlament eine Reihe von Resolutionen, die Englands Beziehungen zu Rom abbrachen. Einer dieser zu Gunsten des Papstes einzureichenden Status wurde auf den König übertragen.
Aufgrund seiner neuen Rechte ernannte Henry Anfang 1533 Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury. Im Mai erklärte Cranmer die Ehe des Königs mit Katharina von Aragon für ungültig, und wenige Tage später wurde Anna Boleyn zur rechtmäßigen Ehefrau des Königs erklärt und gekrönt. Papst Clemens forderte Heinrich auf, sich Rom zu stellen. Darauf antwortete der König mit stolzem Schweigen. Im März 1534 exkommunizierte der Papst Heinrich von der Kirche, erklärte seine Ehe mit Anna für illegal und die inzwischen geborene Tochter Elisabeth für unehelich. Als würde er den Hohepriester verspotten, nannte Henry durch sein Dekret seine erste Ehe ungültig, und ihre Tochter Mary, die von ihr geboren wurde, wurde aller Rechte auf den Thron beraubt. Die unglückliche Königin wurde im Kloster von Emphitelle eingesperrt. Es war eine komplette Pause. Allerdings stimmten nicht alle in England der Kirchenspaltung zu. Um den englischen Klerus in die neue Ordnung zu zwingen, bedurfte es strenger Repression. Eines der ersten Opfer religiöser Verfolgung waren die Klöster. 1534 verlangte Cromwell von den englischen Mönchen einen besonderen Eid – dass sie den König als oberstes Oberhaupt der englischen Kirche betrachten und sich weigern, dem Bischof von Rom zu gehorchen, der „illegal den Namen des Papstes in seine Bullen aufgenommen habe. " Wie zu erwarten war, stieß diese Forderung bei den Mönchsorden auf starken Widerstand. Cromwell befahl die Erhängung der Anführer der klösterlichen Opposition. 1536 wurde ein Gesetz über die Säkularisierung des Besitzes von 376 kleinen Klöstern verabschiedet.
Unterdessen behielt der Hauptschuldige der englischen Reformation mit allem seine hohe Position nicht lange. Anne Boleyns Verhalten war alles andere als perfekt. Nach der Krönung begannen Bewunderer, die viel jünger als ihr Ehemann waren, sich um sie zu scharen. Der misstrauische König bemerkte dies und seine Zuneigung zu seiner Frau schmolz jeden Tag. Zu diesem Zeitpunkt war Henry bereits von der neuen Schönheit fasziniert – Jane Seymour. Grund für den endgültigen Bruch war ein Vorfall bei einem Turnier Anfang Mai 1536. Die Königin, die in ihrer Loge saß, ließ ihr Taschentuch auf den vorbeigehenden hübschen Höfling Norris fallen, und er war so unvorsichtig, dass er es aufgriff Am nächsten Tag wurden Anna, ihr Bruder Lord Rochester sowie mehrere Herren, die Gerüchten zufolge Liebhaber der Königin waren, festgenommen -Ehemann, dass ihr Verhalten immer mehr als verwerflich gewesen sei; schließlich, dass es zwischen ihren Komplizen Personen gebe, mit denen sie in einer kriminellen Beziehung stehe. Es begannen Folter und Verhöre. Der Musiker Smitton, der Anna mit dem Lautenspiel amüsierte, gestand dies genoss die uneingeschränkte Gunst seiner Geliebten und besuchte sie dreimal bei einem geheimen Treffen.Am 17. Mai erkannte eine Untersuchungskommission aus zwanzig Peers die ehemalige Königin für schuldig an und beschloss, sie durch den Tod hinzurichten.Am 20. Mai wurde sie enthauptet am nächsten Tag nach der Hinrichtung Heinrich heiratete Jane Seymour. Sie war ein ruhiges, sanftmütiges, unterwürfiges Mädchen, das am wenigsten nach der Krone strebte. Im Oktober 1537 starb sie, nachdem sie den Sohn des Königs, Edward, zur Welt gebracht hatte. Ihre Ehe mit Heinrich dauerte 15 Monate.
In der Zwischenzeit wurde die Kirchenreform fortgesetzt. Heinrich wollte zunächst nichts an den Lehren und Dogmen der Kirche ändern. Aber das Dogma der päpstlichen Autorität war von der scholastischen Theologie so eng mit dem gesamten System des Katholizismus verflochten, dass es bei seiner Abschaffung notwendig war, einige andere Dogmen und Institutionen abzuschaffen. 1536 genehmigte der König die zehn vom Konvoi ausgearbeiteten Artikel; Dieses Gesetz verfügte, dass nur die Heilige Schrift und die drei alten Glaubensbekenntnisse die Quellen der Lehre sein sollten (wodurch die Autorität der kirchlichen Tradition und des Papstes abgelehnt wurde). Nur drei Sakramente wurden anerkannt: Taufe, Abendmahl und Buße. Das Dogma des Fegefeuers, Gebete für die Toten, Gebete zu den Heiligen wurden abgelehnt, die Anzahl der Riten wurde reduziert. Dieser Akt war ein Signal für die Zerstörung von Ikonen, Reliquien, Statuen und anderen heiligen Relikten. 1538-1539 große Klöster wurden säkularisiert. Ihr gesamter kolossaler Besitz ging in den Besitz des Königs über. Außerdem begann man, den Zehnten und andere Kirchensteuern an die Staatskasse zu überweisen. Diese Mittel gaben Henry die Möglichkeit, die Flotte und die Truppen erheblich zu verstärken, viele Festungen an der Grenze zu bauen und Häfen in England und Irland zu bauen. Dann wurde ein solides Fundament für die zukünftige Macht der englischen Nation gelegt. Aber bei alledem war die Zeit Heinrichs VIII. eine Ära schwerster religiöser Verfolgung. Jeder Widerstand gegen die fortschreitende Reformation wurde mit gnadenloser Härte niedergeschlagen. Es wird angenommen, dass in den letzten siebzehn Jahren der Herrschaft Heinrichs mehr als 70.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, hingerichtet und in Kerkern gestorben sind. Die Willkür dieses Königs im öffentlichen wie im privaten Leben kannte keine Grenzen. Das Schicksal seiner sechs unglücklichen Ehefrauen ist dafür ein anschauliches Beispiel.
Nach dem Tod von Jane Seymour begann der König über eine vierte Ehe nachzudenken. Nachdem er viele Parteien durchlaufen hatte, entschied er sich schließlich für die Tochter des Herzogs von Kleve, Anna, die ihm nur von einem Porträt Holbeins bekannt war. Im September 1539 wurde ein Ehevertrag unterzeichnet, woraufhin Anna in England ankam. Als der König sie direkt mit eigenen Augen sah, war er verärgert und enttäuscht. "Das ist eine echte flämische Stute!" er sagte. Widerstrebend heiratete er am 6. Januar 1540 seine Braut, dachte aber sofort an eine Scheidung. Mit der Auflösung der Ehe hatte er keine Schwierigkeiten. Im Sommer desselben Jahres ordnete der König eine Untersuchung an und gab bekannt, ob seine Frau Jungfrau war oder nicht. "Schon in der ersten Nacht", sagte er, "fühlte ich ihre Brüste, ihren Bauch und erkannte, dass sie keine Jungfrau war und ihr daher nicht fleischlich nahe kam." Wie erwartet stellte sich heraus, dass die Königin keine Jungfrau war. Auf dieser Grundlage erklärte der Rat des Höheren Klerus am 9. Juli die Ehe mit Anna für ungültig. Die geschiedene Königin erhielt eine anständige Zulage und ein Anwesen, wo sie sich mit dem gleichen unerschütterlichen Phlegmatismus zurückzog, mit dem sie den Gang hinunterging.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der König bereits eine neue Favoritin – Catherine Gotward, die 30 Jahre jünger war als er. Er heiratete sie drei Wochen nach der Scheidung von seiner vierten Frau, was seine Untertanen sehr überraschte: Gotwards Ruf war allen bekannt.
Ein gewisser Leshlier präsentierte bald eine Denunziation der Königin und beschuldigte sie der Ausschweifung vor und nach ihrer Heirat mit Henry. Die Betrügerin rief ihre Liebhaber des persönlichen Sekretärs Francis Derem und des Musiklehrers Henry Mannock an. Heinrich weigerte sich zunächst, dies zu glauben, ordnete aber eine verdeckte Untersuchung an. Bald wurden die schlimmsten Gerüchte bestätigt. Henry Mannock gab zu, dass er „die Geschlechtsteile“ seines Schülers „streichelte“. Derem sagte, dass er sie mehr als einmal „fleischlich kannte“. Die Königin selbst leugnete nicht. Bei der Sitzung des Rates schluchzte Henry vor Groll. Wieder getäuscht! Und wie arrogant! Anfang Februar 1542 wurde Catherine Gotward im Tower enthauptet.
Anderthalb Jahre später, im Juni 1543, heiratete Henry zum sechsten Mal die 30-jährige Witwe Catherine Parr. Offensichtlich jagte er diesmal nicht mehr einem schönen Gesicht hinterher, sondern suchte einen sicheren Hafen für sein Alter. Die neue Königin war eine Frau mit einer starken unabhängigen Lebenseinstellung. Sie kümmerte sich um die Gesundheit ihres Mannes und erfüllte erfolgreich die Rolle der Herrin des Hofes. Leider war sie zu sehr mit religiösen Streitigkeiten beschäftigt und zögerte nicht, dem König ihre Meinung zu sagen. Diese Freiheit kostete sie fast den Kopf. Anfang 1546 betrachtete Henry sie, nachdem er sich mit seiner Frau über ein religiöses Problem gestritten hatte, als "Ketzerin" und erhob eine Anklage gegen sie. Glücklicherweise gelang es dem Projekt der Staatsanwaltschaft, die Königin zu zeigen. Sie fiel in Ohnmacht, als sie die Unterschrift ihres Mannes unter ihrem eigenen Satz sah, aber dann nahm sie ihre Kräfte zusammen, eilte zu Henry und schaffte es dank ihrer Eloquenz, um Vergebung zu bitten. Sie schreiben, dass die Wachen in diesem Moment bereits gekommen waren, um die Königin zu verhaften, aber Henry wies sie auf die Tür.
Der schreckliche König starb ein Jahr nach diesem Ereignis. Seine Krankheit war die Folge einer monströsen Fettleibigkeit. Noch fünf Jahre vor seinem Tod war er so dick, dass er sich nicht bewegen konnte: Er wurde in Stühlen auf Rädern gefahren.
Alle Monarchen der Welt. Westeuropa. Konstantin Ryschow. Moskau, 1999
Heinrich der Achte.
Porträt von Hans Holbein dem Jüngeren
Reproduktion von der Website http://monarchy.nm.ru/
Heinrich der Achte
Heinrich VIII. Tudor
Heinrich VIII. Tudor
Lebensjahre: 28. Juni 1491 - 28. Januar 1547
Regierte: 21. April 1509 - 28. Januar 1547
Vater: Heinrich VII
Mutter: Elisabeth von York
Ehefrauen: 1) Katharina von Aragon (Ehe annulliert)
2) Anne Boleyn (Ehe annulliert)
3) Jane Seymour
4) Anna Klevskaya (Ehe annulliert)
5) Catherine Howard (Ehe annulliert)
6) Katharina Parr
Söhne: Eduard
Töchter: Maria, Elisabeth
In Klammern steht die Seriennummer der Frau, von der das Kind geboren wurde. Weitere 7 Kinder starben im Säuglingsalter.
Uneheliche Kinder: Henry FitzRoy, Herzog von Richmond und Somerset
Katharina Carey
Henry Carey, Baron Hunsdon
Thomas Stackley, Herr
John Perrot, Herr
Etheldreda-Malz
Apropos uneheliche Kinder, nur in Bezug auf Heinrich Fitzroy kann man sich der Vaterschaft Heinrichs zu 100 % sicher sein.
Heinrichs älterer Bruder Arthur war ein gebrechlicher und kränklicher Mann. Nachdem er im Herbst 1501 Katharina von Aragon geheiratet hatte, konnte er keine ehelichen Pflichten erfüllen. Bettlägerig litt er an Fieber und starb sechs Monate später. Zwischen den spanischen und englischen Gerichten wurde vereinbart, dass Catherine Henry heiraten würde, sobald er 15 Jahre alt war. Aus diesem Grund wurde trotz des biblischen Verbots, die Witwe eines Bruders zu heiraten, eine Sondergenehmigung von Papst Julius II. Eingeholt. Heinrich heiratete Catherine kurz nach dem Tod seines Vaters, kurz vor seiner Krönung.
Anders als sein Vater und sein älterer Bruder war Heinrich körperstark, fröhlich, liebte Bälle, Maskeraden und Ritterturniere. Außerdem war der neue König gebildet, beherrschte mehrere Sprachen, liebte die Kunst, konnte Laute spielen, Lieder und Gedichte komponieren. Gleichzeitig war er jedoch äußerst selbstbewusst, despotisch und kümmerte sich nicht gern um Staatsangelegenheiten, sondern vertraute sie seinen Günstlingen an. Der erste Favorit unter ihm war Thomas Wolsey, der Kardinal und Kanzler der königlichen Kapläne wurde.
1513 trat Heinrich in den Krieg mit Frankreich ein, wurde aber bald von seinen Verbündeten im Stich gelassen. Henry musste damit Frieden schließen Ludwig XII und ihm seine jüngere Schwester Maria zur Frau geben. Dieser Vorfall hat Henry viel beigebracht, und in Zukunft begann er, genauso heimtückisch zu handeln.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts breitete sich die reformatorische Bewegung in Europa aus. Heinrich hielt sich für einen großen Kenner der Theologie und verfasste ein Pamphlet gegen die Reformatoren, wofür ihm der Papst den Titel „Verteidiger des Glaubens“ verlieh und Luther Beleidigungen überschüttete. Bald kam es jedoch zu einem Bruch in Heinrichs Beziehung zum Papst. Schuld daran war seine Frau Katharina. Für die ganze Zeit ihrer Ehe konnte sie Henry nur eine gesunde Tochter, Mary, zur Welt bringen. Der Rest der Babys starb kurz nach der Geburt. Catherine widmete den Gebeten immer mehr Zeit. Heinrich verlor das Interesse an seiner Frau und verliebte sich in ihre Hofdame Anne Boleyn. Gleichzeitig wurde Kardinal Wolsey angewiesen, Dokumente zu sammeln, die die Rechtswidrigkeit der Erlaubnis von Papst Julius II. zur Eheschließung von Heinrich und Katharina bestätigen. Catherine wollte jedoch nicht ins Kloster, Papa Clemens VII wollte sich nicht scheiden lassen, und Wolsey war nicht erpicht darauf, Anne Boleyn als Königin zu sehen, und zog den Fall auf jede erdenkliche Weise in die Länge. Wütend entließ Henry Wolsey und ernannte stattdessen Thomas Cromwell, der Henry vorschlug, sich nach dem Vorbild der deutschen Fürsten zum Oberhaupt der Kirche in England zu erklären und ohne Zustimmung des Papstes die Scheidung einzureichen. Heinrich gefiel die Idee. Auf seinen Befehl beschuldigte das Gericht alle Priester Englands, dass sie der Überlieferung nach dem Papst die Treue schworen, obwohl sie niemandem außer dem König die Treue schwören sollten. Auf einer Sonderversammlung im Februar 1531 wurden die Bischöfe gezwungen, dem eigensinnigen Monarchen nachzugeben und ihn als Oberhaupt der englischen Kirche anzuerkennen. Das Parlament nimmt Entschließungen zum Abbruch der Beziehungen zwischen England und Rom an. Die zuvor an den Papst gezahlten Steuern begannen in die Einnahmen des Königreichs zu fließen.
Henry nutzte seine neuen Rechte und ernannte Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury, der wenige Tage später die Ehe von Henry und Catherine als ungültig anerkannte und den König mit Anne Boleyn heiratete. Der wütende Papst exkommunizierte Heinrich aus der Kirche und erklärte seine Ehe mit Anna für illegal. Als Reaktion darauf entzog Henry seiner Tochter aus erster Ehe alle Rechte auf den Thron und verbannte seine Ex-Frau in ein Kloster, wo sie einige Jahre später starb.
Henry musste einige Zeit mit Widerstand unter den Kirchenmännern kämpfen. Die Mönche wurden gezwungen, dem päpstlichen Bischof den Gehorsam zu verweigern und Heinrich einen Treueid zu leisten. Einige Führer der Opposition mussten gehängt werden, und 1536 wurden 376 kleine Klöster geschlossen.
Unterdessen benahm sich Anne Boleyn auf eine Weise, die alles andere als königlich war. Heinrich erfuhr von ihren vielen Liebschaften. Als der Kelch seiner Geduld überlief, wurden Anna und mehrere ihrer Freier wegen des Verdachts der Verschwörung gegen den König festgenommen. Die Untersuchungskommission befand Anna für schuldig und am 19. Mai 1536 wurde sie enthauptet. Es sei darauf hingewiesen, dass kurz vor der Urteilsverkündung die Ehe von Heinrich und Anna annulliert wurde und es daher absurd war, Anna vorzuwerfen, ihren Ehemann betrogen zu haben, da sie anscheinend keinen Ehemann hatte.
Fast sofort heiratete Henry seine neue Leidenschaft. Jane Seymour war ein ruhiges und sanftmütiges Mädchen ohne große Ambitionen. Sie gebar Heinrich, Edwards Erben, und starb zwei Wochen später. Ihre Ehe dauerte 15 Monate.
1536 wurde der Act of Union unterzeichnet, der England und Wales formell zu einem einzigen Staat vereinte, und Englisch wurde zur einzigen Amtssprache erklärt, was bei den Walisern zu Unzufriedenheit führte.
In der Zwischenzeit führte Henry die Kirchenreform weiter durch. Viele Bestimmungen der katholischen Kirche waren eng mit dem Dogma der päpstlichen Autorität verbunden, weshalb Heinrich gezwungen war, sie zu revidieren. 1536 erließ er ein Dekret, wonach nur die Heilige Schrift und die drei alten Glaubensbekenntnisse Quellen der Lehre sein sollten (womit er die Autorität der kirchlichen Tradition und des Papstes ablehnte). Nur drei Sakramente wurden anerkannt: Taufe, Abendmahl und Buße. Das Dogma des Fegefeuers, Gebete für die Toten, Gebete zu den Heiligen wurden abgelehnt, die Anzahl der Riten wurde reduziert. Es folgte die Massenvernichtung von Ikonen, Relikten und anderen Reliquien. Äbte und Priore wurden ihrer Sitze im House of Lords beraubt. Die restlichen Klöster wurden aufgehoben. Ihr Eigentum ging an den Staat. Ebenso wie der Kirchenzehnt begann, direkt in die Schatzkammer zu gehen. Dies ermöglichte es Henry, Armee und Marine erheblich zu stärken, neue Festungen und Häfen zu bauen. Natürlich waren nicht alle mit den laufenden Reformen zufrieden. Henry ging jedoch grausam und gnadenlos mit Dissidenten um. In den letzten 17 Jahren seiner Herrschaft wurden mehr als 70.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen und in Gefängnissen getötet.
Nach dem Tod von Jane Seymour beschloss Henry, ein viertes Mal zu heiraten. Er entschied sich für Anna von Klevskaya, die er nur auf dem Porträt von Holbein sah. Als Heinrich sie live sah, war er sehr enttäuscht und rief die „Flanders Stute“ hinter seinem Rücken. Obwohl der Ehevertrag unterzeichnet war und die Hochzeit stattfand, beschloss Henry sofort, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Unter dem Vorwand, dass die Königin keine Jungfrau war, ließ sich die Scheidung leicht arrangieren, und Anna, die eine anständige Entschädigung erhalten hatte, zog sich phlegmatisch vom Gericht zurück.
Henry erwarb schnell eine neue Favoritin, Catherine Howard, die 30 Jahre jünger war als er und bei Gericht für ihre Ausschweifungen bekannt war. Überraschenderweise stimmte Henry zu, sie zu heiraten, und einige Monate später beschuldigte er die Königin des Verrats und brachte sie vor Gericht. Wie im Fall von Anne Boleyn wurde kurz vor ihrer Hinrichtung ihre Ehe mit Henry annulliert, was die Anschuldigungen des Ehebruchs von Catherine gegenstandslos machte. Aber auch hier achtete niemand auf diesen Widerspruch.
Anderthalb Jahre später heiratete Henry eine 30-jährige Witwe, Catherine Parr. Als standhafte und willensstarke Frau könnte Catherine Heinrichs verlässliche Stütze im Alter werden. Ihre religiösen Überzeugungen stimmten jedoch nicht mit den Ansichten von Henry überein, und sie hatte keine Angst, mit ihm über theologische Themen zu streiten. Nach einem dieser Streitigkeiten unterschrieb Henry wütend ihr Urteil, aber im letzten Moment gelang es Catherine, den König um Vergebung zu bitten. Catherine gelang es, Henry mit seinen Töchtern Mary und Elizabeth zu versöhnen, und das Parlament setzte sie durch einen besonderen Akt als Erben nach ihrem Sohn Edward ein.
In den letzten Jahren seines Lebens wurde Heinrich unglaublich dick. Er wurde so dick, dass er sich nicht mehr selbstständig bewegen konnte und in einen Rollstuhl gebracht wurde. Außerdem litt er an Gicht. Vielleicht war sein Tod im Jahr 1547 das Ergebnis einer solchen Fettleibigkeit. Henrys Erbe war Edward, der Sohn von Jane Seymour.
Lesen Sie weiter:
Historische Persönlichkeiten Großbritanniens(Biographischer Führer).
England im 16. Jahrhundert(Zeittafel).
Literatur zur Geschichte Großbritanniens(Listen).
Britisches Geschichtskursprogramm(Methode).
Elisabeth I. Tudor(Elizabeth I) (1533-1603), Tochter von Henry, Königin von England von 1558.
Literatur:
Semenov V. F., Probleme der Politik. Englische Geschichte im 16. Jahrhundert in der Beleuchtung der Moderne Englisch Bourgeois Historiker, "VI", 1959, Nr. 4;
Mackie J. D., The early Tudors, 1485-1558, Oxf., 1952;
Elton G. R., The Tudor Revolution in Government, Camb., 1953;
Elton G. R., England unter den Tudors, N. Y. (1956);
Harrison D., Tudor England, v. 1-2, L., 1953.
Egal wie viel Historiker über den englischen König Heinrich VIII. schreiben, das Interesse an dieser wahrhaft herausragenden Person lässt nicht nach.
Quelle: Ivonin Yu.E., Ivonina L.I. Herrscher über die Geschicke Europas: Kaiser, Könige, Minister des 16. - 18. Jahrhunderts. - Smolensk: Rusich, 2004.
Bei seinem Handeln waren politische und persönliche Motive sehr skurril und auf den ersten Blick widersprüchlich, Heinrich VIII. wurde entweder als König-zhuir dargestellt, der sich wenig um öffentliche Angelegenheiten kümmerte und ständig in einem Strudel höfischer Unterhaltung war (besonders beachtet wird normalerweise sein skandalöses Privatleben), dann ein grausamer und verräterischer Tyrann, dann ein äußerst besonnener, nüchterner Politiker, den Frauen gegenüber gleichgültig, der Ehen nur aus politischen Gründen arrangierte und einen prächtigen Hof nur aus Notwendigkeit, aus Prestigegründen, unterhielt. Einer seiner Biografen glaubte, das Verhalten Heinrichs VIII. bezeuge die paranoiden Neigungen des englischen Monarchen. Natürlich ist diese Meinung umstritten. Viele Einschätzungen des Königs leiden an Einseitigkeit, nur darin sind sich alle Autoren, die über ihn geschrieben haben, uneingeschränkt einig, dass Heinrich VIII. ein Despot war. Tatsächlich verband er auf verblüffende Weise die Züge eines edlen Ritters und eines Tyrannen, aber (S. 115) setzte sich eine nüchterne Berechnung durch, die darauf abzielte, seine eigene Macht zu stärken.
Seine Favoriten, bedeutende Staatsmänner Englands im 16. Jahrhundert, die eigentlich den Grundstein für den englischen Absolutismus legten, waren hauptsächlich in politischen Angelegenheiten tätig - Thomas Bulley und Thomas Cromwell. Zu diesen könnte man den großen englischen Humanisten Thomas More hinzufügen, der von 1529 bis 1532 als Lordkanzler von England diente. Aber erstens war die Zeit seines Dienstes nur von kurzer Dauer, und zweitens bestimmte er mit all seinen brillanten Fähigkeiten nicht nur nicht die Politik des englischen Königreichs, sondern war einfach kein bedeutender Staatsmann, obwohl er sich darin auskannte die geheimen Quellen wichtiger staatlicher Entscheidungen. Trotzdem erlitt More das gleiche traurige Schicksal wie Woolsey und Cromwell: Alle drei gerieten in Ungnade, aber wenn es Booley gelang, eines natürlichen Todes zu sterben und die unvermeidliche Hinrichtung zu vermeiden, dann beendeten More und Cromwell ihre Tage auf dem Schafott.
Sowohl Zeitgenossen als auch Historiker erkennen Heinrich VIII. als Tyrannen an. Ohne Namen zu nennen, hier einige Aussagen verschiedener Autoren: „Heinrich VIII. war ein Tyrann, aber ein brillanter und fähiger Souverän“, „Er wurde definitiv ein Despot, aber in seinem Handeln stand er im Einklang mit dem Willen des Volkes“, „ Er hatte Willenskraft und einen kompromisslosen Charakter, die ihn ungeachtet von Hindernissen zu einem vorgegebenen Ziel führen konnten ... “Eines der charakteristischen Merkmale Heinrichs VIII. Wurde von Thomas More sehr genau festgestellt. Nachdem der König das Haus von More in Chelsea (einem Vorort von London) besucht hatte, drückte der Schwiegersohn des großen Humanisten William Roper seine Bewunderung für die Liebe aus, die Heinrich VIII. für More zeigte. Dazu bemerkte More traurig: „Ich muss Ihnen sagen, dass ich keinen Grund habe, auf meine Beziehung zum König stolz zu sein, denn wenn es auf Kosten meines Kopfes möglich sein wird, mindestens eine Festung in Frankreich zu bekommen, wird der König es tun zögere nicht damit." Schon dem Tode nahe, sagte Kardinal Wolsey, der seinen König gut studiert hatte, zu Sir William Kingston: „Sie müssen sicher sein, was Sie ihm in den Kopf gesetzt haben (S. 116), denn Sie werden es nie zurücknehmen.“ Im Laufe der Jahre wurde Heinrich VIII. noch misstrauischer und rachsüchtiger und zerstörte echte und imaginäre Feinde mit entsetzlicher Grausamkeit.
Die Bildung des Charakters des englischen Königs wurde weitgehend durch die Bedingungen erleichtert, unter denen er aufgewachsen war. Sie erlauben uns, die Frage zu beantworten, warum er sich in seinen reifen Jahren von einer engelhaften Jugend in ein Monster verwandelt hat. Die Situation der ersten Jahrzehnte der Tudor-Herrschaft, als hier und da Unruhen von Anhängern Richard S. Yorks und Anti-Steuerproteste ausbrachen, bestimmte den Wunsch Heinrichs VII., des Vaters des Helden dieses Essays, nicht an der Macht zu verlieren um jeden Preis. Außerdem im letzten (S. 117)
Regierungsjahren zwischen ihm und seinem Sohn, dem späteren Heinrich VIII., kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Der Prinz wollte Katharina von Aragon nicht heiraten, die nach dem Tod ihres ersten Mannes Arthur, des älteren Bruders des Prinzen, in England lebte und auf die Entscheidung ihres Schicksals wartete. Heinrich VII. glaubte, dass die Hochzeit seines Sohnes, des Thronfolgers, und Katharina von Aragon der beste Weg sei, um das Bündnis zwischen England und Spanien zu stärken. In diesem Fall war seiner Meinung nach der Schutz Englands vor einem Angriff Frankreichs gewährleistet. Außerdem war der englische König von Katharinas großer Mitgift sehr angetan, die er sich nicht entgehen lassen wollte. Heinrich VIII. war bekannt für seine Liebe zum Geld. Der junge Prinz war gezwungen, dem Willen seines Vaters zuzustimmen und gehorsam zu lächeln, obwohl hinter seinem Lächeln ein tiefer Hass auf seine Eltern stand. Gleichzeitig behandelte der alte König seine Schwiegertochter, die Witwe von Prinz Arthur, trotzig, als er den Widerwillen der Spanier sah, seinen Sohn Henry und Catherine zu heiraten. Der englische König wollte die Spanier selbst zur Annäherung an London zwingen (S.118). Catherine wurde nicht mehr zu den Gerichtsferien eingeladen. Ihr Tisch war viel schlechter als der der königlichen Familie, sie bekam wenig Geld und schließlich wurde sie über ihre Ehe mit Henry im Dunkeln gehalten. Unterdessen vergnügte sich der junge Prinz mit aller Macht, und Heinrich VII. förderte dies insgeheim.
Zu Beginn des Jahres 1509 erwähnte Heinrich VII., bereits völlig krank (er starb wie sein ältester Sohn Arthur an Tuberkulose), die Hochzeit von Heinrich und Katharina von Aragon nicht einmal. Doch auf seinem Sterbebett sagte er zu seinem Sohn: „Wir wollen den Prinzen nicht unter Druck setzen, wir wollen ihm Entscheidungsfreiheit lassen.“ Und doch waren seine letzten Worte: "Heirate Katharina."
Die Berater des jungen Königs brachten die Angelegenheit schnell zu Ende, und bald war die Ehe geschlossen. So wurde zwischen England, Spanien und den Habsburgern ein äußerst komplexer Knoten von Widersprüchen geknüpft, da der neunjährige Enkel von Ferdinand von Aragon, Karl Habsburg, Katharinas Neffe, der einzige wirkliche Anwärter auf den spanischen Thron war.
Die ersten Regierungsjahre Heinrichs VIII. verliefen in einer Atmosphäre von Hoffesten und militärischen Abenteuern. Die zwei Millionen Pfund, die der geizige Heinrich VII. in der königlichen Schatzkammer hinterlassen hatte, schmolzen mit katastrophaler Geschwindigkeit dahin. Der junge König genoss Reichtum und Macht und verbrachte seine Zeit mit ununterbrochener Unterhaltung. Als hervorragend gebildeter und vielseitiger Mensch weckte Heinrich VIII. zunächst Hoffnungen bei humanistisch orientierten Menschen. Lord William Mountjoy schrieb im Mai 1509 an den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam: „Ich sage ohne Zögern, mein Erasmus: Wenn du hörst, dass derjenige, den wir unseren Octavian nennen könnten, den Thron deines Vaters bestiegen hat, wird deine Melancholie dich verlassen einen Augenblick ... Unser König begehrt nicht Gold, Perlen, Juwelen, sondern Tugend, Ruhm, (S. 119) Unsterblichkeit!“ Heinrich VIII. selbst, der in jungen Jahren zum Schreiben neigte, stellte in einem Lied, das er schrieb und vertonte, seine Lebensweise und sein Ideal so dar:
Ich werde bis in die letzten Tage sein
Einen fröhlichen Freundeskreis lieben -
Neid, aber wage es nicht, einzugreifen
Ich muss Gott mit meinem gefallen
Spiel: schießen
Singen Tanzen -
Hier ist mein Leben
Oder multiplizieren Sie eine Zeile
Ich bin nicht frei zu solchen Freuden?
Aber die größte und unzerstörbare Leidenschaft des zweiten Tudor waren Macht und Ruhm. Der Glanz der Plantagenet-Krone, von deren Wiederherstellung er träumte, drängte ihn zu einem riskanten Krieg im Bündnis mit seinem Schwiegervater Ferdinand von Aragon gegen Frankreich, den die damaligen Einkünfte des englischen Königs nicht zuließen einen so verschwenderischen Lebensstil und eine so großangelegte Politik zu führen. Obwohl das Parlament im Allgemeinen gehorsam war, war es angesichts der jüngsten Anti-Steuerreden nicht sehr bereit, die Erhebung von Notsteuern zuzulassen. Der König war ärmer als alle großen Feudalherren zusammen, aber er gab mehr aus als sie. England hatte keine eigene Flotte - notfalls wurden die Schiffe italienischer und hanseatischer Kaufleute eingesetzt. Die englischen Könige hatten auch keine reguläre Armee. Unter Heinrich VII. wurde eine Abteilung von Arkebusiers geschaffen, und Heinrich VIII. bildete eine Abteilung von Speerkämpfern. In mehreren Grenzfestungen gab es (S. 120) ständige Garnisonen, deren Gesamtzahl der Soldaten 3.000 Personen nicht überstieg. Obwohl sie theoretisch als Kern für die Schaffung eines stehenden Heeres dienen könnten, war dies jedoch zu wenig, und die Tudors konnten nicht ohne ausländische Söldner auskommen.
Die ersten zwanzig Jahre seiner Regentschaft beschäftigte sich Heinrich VIII. hauptsächlich mit außenpolitischen Fragen. Der Ehrgeiz des jungen Königs schien keine Grenzen zu kennen, doch für die Umsetzung grandioser Pläne fehlte das Geld. Erfolgloser Krieg mit Frankreich 1512–1513 kostete die britische Staatskasse 813.000 Pfund. Der Verbündete Ferdinand von Aragon, der mit dem französischen König Ludwig XII. einen Separatfrieden geschlossen hatte, ließ England tatsächlich Frankreich gegenüber. Die Erhebung einer vom Parlament 1514 beschlossenen Subvention von 160.000 Pfund brachte weniger als ein Drittel des erforderlichen Betrags ein. Ohne das Risiko, eine Welle von Antisteuerprotesten auszulösen, war eine Fortsetzung einer aktiven Außenpolitik nicht möglich. Es gab noch einen weiteren wichtigen Grund für die Wende in der Außenpolitik des englischen Königs. Sobald er sich im Krieg mit Frankreich festgefahren hatte, eskalierten sofort die Beziehungen zu Schottland. Am 22. August 1513 zog der schottische König Jakob IV. an der Spitze einer 60.000 Mann starken Armee an die englische Grenze. Er sah Frankreich als Garant für die Unabhängigkeit Schottlands von Englands Übergriffen und handelte oft im Bündnis mit ihm. So geschah es auch dieses Mal. In einem schwierigen Moment wandte sich die französische Krone hilfesuchend an den schottischen König. Aber am 9. September, in der Schlacht von Flodden, erlitten die Schotten, die in der Ebene immer schlecht gekämpft hatten, eine vernichtende Niederlage, und am 10. August 1514 wurde ein Friedensvertrag zwischen Ludwig XII. Und Heinrich VIII. unterzeichnet. Eines der Ziele des englischen Monarchen war es, die Unterstützung Frankreichs zu erhalten, um Kastilien zu übernehmen. Laut dem englischen König sollte es den Töchtern von Ferdinand von Aragon gehören, von denen eine - Catherine - seine Frau war. Heinrich VIII. gab die Hoffnung nicht auf, seinen Besitz zu erweitern. Er sah in der spanischen Ehe ein Mittel, um sein internationales Ansehen zu steigern. (S.121)
Der Nachfolger Ludwigs XII. auf dem französischen Thron, Franz I., der die Italienpolitik seiner Vorgänger aktiv fortsetzte, entschied, dass die englisch-schottischen Konflikte Frankreich, das in Italien militärische Operationen durchführte, nicht in einen Krieg gegen England hineinziehen sollten. Nach den Siegen Franz I. im Herbst 1515 in der Lombardei und dem Tod Ferdinands von Aragon Anfang 1516 veränderten sich die Machtverhältnisse in Westeuropa dramatisch. Spanien geriet schließlich unter die Herrschaft Karls V. Seine Außenpolitik nahm eine klare pro-habsburgische Richtung, was die Beziehung zwischen England und dem Imperium verkomplizierte.
Die Veränderungen, die stattfanden, sollten Albions Position in westeuropäischen Angelegenheiten beeinflussen. England begann, zu der von Heinrich VII. entwickelten Politik des Machtgleichgewichts zurückzukehren, die in der Zeit Heinrichs VIII. vom damaligen Lordkanzler des Königreichs und Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Thomas Wolsey, befürwortet wurde.
Diesem Politiker gelang es, die Regierungsgeschäfte zu einer Zeit zu übernehmen, als Heinrich VI.11 es vorzog, zu tanzen und zu jagen. Wolsey war 15 Jahre lang die zweite politische Figur in England nach dem König. In seiner Biographie, geschrieben von George Cavendish in den Jahren 1554-1558. und erst 1641 veröffentlicht, soll Woolsey in einer Metzgerfamilie in Ipswich, einer Stadt in der Grafschaft Suffolk, geboren worden sein. Er zeigte eine frühe Lernfähigkeit und konnte an der Universität Oxford promovieren. 1503 wurde Wolsey Kaplan von Sir Richard Nanfan, dem Gouverneur von Calais. Der Gouverneur vertraute ihm, und auf seine Empfehlung hin wurde der junge Priester in diplomatischer Mission zu Kaiser Maximilian T. geschickt. Ein erfolgreicher Auftrag trug zum raschen Aufstieg Wolseys in den Rängen bei. Kurz vor seinem Tod empfahl Nengfan seinen Kaplan Heinrich VII. selbst. Nachdem Wolsey die gleiche Position unter dem König eingenommen hatte, erhielt er Zugang zum Hof (S. 122)
Bereits im November 1509 wurde er jedoch zum Mitglied des Geheimen Rates ernannt und hatte nun ständigen Kontakt mit dem jungen König, der fähige und aktive Vollstrecker seines Willens brauchte. Als England 1511 Gerüchte über den bevorstehenden Tod von Papst Julius II. hörte, die sich später als falsch herausstellten, sagte Wolsey seinem Souverän ganz ernsthaft, wie viel Nutzen er daraus ziehen könnte, wenn er ihn zum Kardinal ernannte. Die Kardinalsmütze war ein notwendiger Schritt in Richtung der päpstlichen Tiara. Bald wird Wolsey wirklich zum Kardinal, nachdem er den Erzbischof von York, Kardinal Bainbridge, von seinem Weg entfernt hat (es wird angenommen, dass Wolseys Agenten in Rom ihn vergiftet haben). Dies geschah im Juli 1514. Der Tod von Bainbridge öffnete Wolsey den Weg zum Erzbischof von York und zum Kardinal. Dann wird er Lordkanzler von England und empfängt ab
(S.123) Der Papst willigt ein, Kardinallegat der römischen Kurie in England mit weitreichenden Befugnissen zu sein. In den Fürzen des Metzgersohns steckt enorme Macht: Tatsächlich kontrollierte Wolsey die Außenpolitik Englands und verwaltete die Finanzen des Landes. Ausländische Botschafter wandten sich am häufigsten an ihn. In seinem Haus (er baute bald einen wunderschönen neuen Palast in Lambeth – ein Mann von bescheidener Herkunft war einfach besessen von seiner Sehnsucht nach Luxus) waren immer Menschenmassen, die seine Unterstützung und Hilfe suchten.
Die folgenden Jahre könnten als beredtes Beispiel für Woolseys „Balance of Power“-Politik dienen. Einerseits suchte Franz I. die Freundschaft mit England, andererseits suchte Karl Habsburg durch die Vermittlung von Wolsey das persönliche Treffen mit dem englischen König. Besonders deutlich wurde dies nach der Wahl des letzteren zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Da sich ein direkter Zusammenstoß zwischen Frankreich und dem Imperium anbahnte, suchten beide Seiten nach einem Verbündeten und bemühten sich, wenn nicht um Unterstützung, so doch um die Neutralität Englands. Der Glanz des Treffens der englischen und französischen Könige im Tal von Ard in Nordfrankreich im Frühjahr 1520 kam seinen Ergebnissen nicht gleich. Abgesehen von allgemeinen Liebes- und Freundschaftsbekundungen hörte der französische König nichts Wichtiges von Heinrich VIII. Während des Treffens im Tal von Ard ereignete sich eine merkwürdige Episode. Als Woolsey in seiner Begrüßungsrede, in der er die Titel des englischen Königs aufzählte, zu den Worten „Henry, King of England and France“ kam (die Behauptung war völlig falsch, zeigte aber die Ambitionen des englischen Monarchen), rief er lachend aus : „Entferne diesen Titel!“
Und doch war die Versuchung, seinen Besitz auf Kosten Frankreichs zu erweitern, so groß, dass sich der englische König zu einem Bündnis mit dem Kaiser gegen Franz I. entschloss. Der Krieg gegen Frankreich konnte England teuer zu stehen kommen, doch das hielt den ehrgeizigen Monarchen nicht auf. Er forderte Geld von Woolsey, und zwar so viel wie möglich. 1522–1523 (S. 124) brachte der Lordkanzler 352.231 Pfund an Zwangskrediten auf und versuchte im folgenden Jahr, die Staatskasse durch einen Kredit aufzufüllen, den er "freundliche Subvention" nannte, aber dieses Unterfangen war erfolglos. In einer Reihe von Kreisen war die Situation von bewaffneten Aufständen übersät. All dies löste natürlich Alarm aus, dennoch beschloss Heinrich VIII., gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen.
Er begegnete der Nachricht von der Niederlage der Franzosen bei Pavia mit einem Ausruf: „Alle Feinde Englands sind vernichtet! Schenk mir mehr Wein ein!“ In der Westminster Abbey wurde unter Beteiligung von Woolsey selbst eine feierliche Messe mit dem Gesang von „Thee, O Lord, we Praise!“ gefeiert. Der englische König beeilte sich, ein Glückwunschschreiben an Karl V. zu senden, in dem er versprach, beim Abschluss des italienischen Feldzugs zu helfen, für den er die Abtretung eines Teils der französischen Ländereien (Bretagne, Guyenne und Normandie) an England forderte. Als er diese Behauptungen aufstellte, dachte er völlig unrealistisch. Erstens hatte Karl V. keine Gelegenheit, an die erzielten Erfolge anzuknüpfen; Dies wurde durch den Mangel an Finanzen und den Ausbruch des Bauernkrieges in Deutschland behindert. Zweitens wollte der Kaiser die territorialen Ansprüche Heinrichs VIII. nicht befriedigen. Es waren diese Umstände, die Karls Entscheidung beeinflussten, Heinrichs Tochter Mary nicht zu heiraten. Der Kaiser gab einer portugiesischen Prinzessin mit ihrer Mitgift von 900.000 Dukaten den Vorzug. Außerdem hatte Prinzessin Isabella bereits das heiratsfähige Alter erreicht, und Mary war noch nicht einmal neun Jahre alt.
Vom Kaiser abgelehnt, stand Heinrich VIII. vor einer Alternative. Die Fortsetzung des Bündnisses mit den Habsburgern drohte England in die Position eines ungleichen Partners zu bringen. Andererseits versprach ein Bündnis oder zumindest eine wohlwollende Neutralität gegenüber Frankreich, dem einzigen Land, das dem Kampf gegen die Habsburger standhalten konnte, wirtschaftliche und politische Vorteile, da der Erfolg der Franzosen in der veränderten Situation die Position Heinrichs VIII. stärken könnte . Die Wende zur Annäherung an Frankreich erfolgte jedoch nicht sofort. Erst Ende des Sommers 1525 konnte Wolsey nach Frankreich gehen und dort (S. 125) das von ihm lange ersehnte Abkommen über Frieden und ewige Freundschaft zwischen den beiden Ländern unterzeichnen.
An einem der Feiertage, die der fröhliche Dicke Buley veranstaltete, der es liebte, mit seinem Reichtum anzugeben, traf der König eine Frau, die später eine verhängnisvolle Rolle im Schicksal des Kardinals spielte. Bei aller Klugheit war Heinrich VIII. ein großer Frauenheld und lehnte Liebesabenteuer nicht ab. Bouley stellte ihn der jungen Hofdame der Königin, Anne Boleyn, näher vor. Als Mädchen begleitete sie die Schwester von Heinrich VIII., Mary, die Louis XP heiratete, nach Frankreich. Von 1519 bis 1522 war Anne Boleyn im Gefolge der Frau von Franz I. Claude und kehrte im Alter von 16 Jahren nach England zurück. In Paris eignete sie sich gute Manieren an, lernte Konversation zu führen, Musikinstrumente zu spielen und beherrschte mehrere Fremdsprachen, vor allem Französisch. Anna selbst, fröhlich, charmant und witzig, war eine der attraktivsten Damen am Hofe des jungen (S. 126) Königs. Die Autoren früherer Jahre schreiben normalerweise, dass Heinrich VIII. von ihren riesigen Augen gefesselt war. Doch in den letzten Jahren wurde ganz im Sinne unserer Zeit immer häufiger auf den ausgeprägten Sexappeal von Anne Boleyn verwiesen, die keineswegs als Schönheit galt. Kurz gesagt, Heinrich VIII. verliebte sich leidenschaftlich. Aber die Hauptsache war, dass er vorhatte, sich von Katharina von Aragon scheiden zu lassen und Anne Boleyn zu heiraten. Als Bouley vom König von seinen Absichten erfuhr, kniete er vor seinem Souverän nieder und bat ihn lange, solche Gedanken aufzugeben. Für die Bouleys war die Frage der Scheidung Heinrichs VIII. sehr wichtig, weil sie die Interessen der Kirche berührte.
Bouley verstand, dass es fast unmöglich war, die Zustimmung zur Scheidung des Königs vom Papst zu erhalten, da Katharina von Aragon die Tante des Kaisers war und viel von der Position Karls V. abhing. Eine andere Sache war, als Heinrich VIII. Seine Mätressen nahm, war dies nicht der Fall alles verboten; Übrigens gebar ihm einer von ihnen einen Sohn, dem der König den Titel Earl of Richmond verlieh, und er tat es trotzig, da nur Tochter Maria von Catherines Kindern überlebte (der Rest der Kinder wurde tot geboren). Zukünftig wurde die jüngere Schwester von Anne Boleyn, Mary, auch die Mätresse von Heinrich VIII. Vielleicht hätten die Ereignisse eine andere Wendung genommen, aber die Trauzeugin weigerte sich, eine weitere Favoritin des Königs zu sein, und bestand darauf, dass er sie heiratete. Heinrich VIII., an Widerstand nicht gewöhnt, versuchte, die Dame seines Herzens um jeden Preis zu erobern.
Um den Grund für diese Beharrlichkeit von Anne Boleyn zu verstehen, sagen wir ein paar Worte über ihre Herkunft. Ihr Vater, Sir Thomas Boleyn, war mit Lady Anne Plantagenet, der Halbschwester Heinrichs VII., verheiratet. 1509 wurde er Bettwart von Heinrich VIII. Er erhielt oft verschiedene diplomatische Aufgaben. Thomas Boleyn stammte aus der Londoner Bourgeoisie, schaffte es aber, seine Schwester mit dem Herzog von Norfolk zu verheiraten. So stand hinter dem Rücken des neuen Favoriten einer der mächtigen Führer der alten Aristokratie, der vorhatte, Anna zu einem Druckmittel gegen den König zu machen. In Kenntnis der Natur Heinrichs VIII. (S. 127), der danach strebte, das gewünschte Ziel in irgendeiner Weise zu erreichen, unterstützten Norfolk und seine Unterstützer die Beharrlichkeit von Anne Boleyn.
Die Idee einer Scheidung von Katharina von Aragon entstand vor langer Zeit. Einige Jahre vor der Hochzeit protestierte Henry, damals Prinz von Wales, in einem geheimen Dokument vom 27. Juni 1505 gegen die vorgeschlagene Ehe mit Catherine und stellte ihre Rechtmäßigkeit in Frage, da er selbst noch nicht im heiratsfähigen Alter war. Vielleicht wurde das oben erwähnte Dokument später erstellt, aber niemand konnte es beweisen. Es scheint, dass Heinrich VIII. sehr gute politische Gründe hatte, das Diktat Spaniens loszuwerden, indem er die dynastische Eheunion brach. Als es 1514 zu einer Annäherung zwischen England und Frankreich kam, die durch die Heirat der Schwester des englischen Königs Maria mit Ludwig XII. besiegelt wurde, beabsichtigte Heinrich VIII., offenbar vor allem aus politischen Gründen, sich von Katharina von Aragon scheiden zu lassen. Aber für eine solche Scheidung brauchte es sehr gute Gründe. Bouley etwa schlug als Begründung vor, auf das Fehlen eines männlichen Erben für das Königspaar hinzuweisen – ein aus Sicht der Thronfolge sehr bedeutsames Argument. Der König selbst, der sich in seiner Jugend darauf vorbereitete, den Rang eines Erzbischofs von Canterbury anzunehmen und eine gute theologische Ausbildung erhielt, fand in der Bibel, im Buch Leviticus, einen Satz, der besagte, dass derjenige, der mit der Frau seines Bruders verheiratet ist, sich verpflichtet eine große Sünde. Heinrich VIII. versäumte es nicht, diese Tatsache weithin bekannt zu machen. Die Situation war lächerlich - der König entdeckte nach fast 18 Jahren Familienleben, dass er die ganze Zeit in Sünde gelebt hatte und seine Ehe aus Sicht aller christlichen Gesetze ungültig war. Am 22. Juni 1527 teilte Heinrich VIII. Katharina von Aragon mit, dass seine klügsten und gelehrtesten Berater der Meinung seien, dass er und sie nie Ehemann und Ehefrau gewesen seien und dass Katharina selbst entscheiden solle, wo sie nun sein solle. Die Leidenschaft des Königs für Anne Boleyn wurde jeden Tag intensiver. Er bombardierte Anna mit zärtlichen Liebesbriefen (S. 128), aber sie blieb hartnäckig. Einer der Gründe für ihren Widerstand war, dass die Favoritin zuvor in den jungen Lord Henry Percy verliebt war und kurz davor stand, ihn zu heiraten. Der König wollte das natürlich nicht, und nicht ohne die Hilfe der Bullen wurde der junge Lord nach Nordengland geschickt. Anschließend fand Anna heraus, wer am Scheitern ihrer Mädchenhoffnungen schuld war, und sagte: "Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich dem Kardinal viel Ärger machen." Gleichzeitig flirtete sie mit Sir Thomas Wyatt. Woolsey befand sich in einer schwierigen Lage. Als naher König und zunächst der einzige Mensch, der von der Leidenschaft seines Herrschers wusste, hätte er zur Befriedigung der Wünsche des Monarchen beitragen sollen. Aber in den Tiefen seiner Seele versuchte Wolsey, eine andere Heiratsoption umzusetzen: Als der Kardinal erkannte, dass eine Scheidung von Katharina von Aragon unvermeidlich war (er kannte seinen König sehr gut), entschied der Kardinal, dass die beste Partie für Heinrich VIII. Eine französische Prinzessin sein würde .
Es scheint, dass der Kardinal im Glanze des Ruhms glitzerte, einflussreich und reich war, aber in der Situation, die sich ereignete, geriet er manchmal ins Stocken, zumal er Anne Boleyns kalte Haltung gegenüber ihrer Person spürte. Nachdem sie Percy verloren und nach der Scheidung von Heinrich VIII. eingewilligt hatte, die Frau des Königs zu werden, sah Anne Woolsey als eines der Hindernisse für ihren ehrgeizigen Traum, eine englische Königin zu werden. Sie forderte Henry VIII auf, Wolsey zu verhaften, und drohte, den königlichen Hof zu verlassen.
Heinrich VIII. erwartete, die Erlaubnis zur Scheidung von Katharina von Aragon vom Papst zu erhalten. Aber nach der Niederlage Roms im Mai 1527 schwächten sich die Positionen von Papst Clemens VII., Und als er sich später mit Karl versöhnte, wollte der Papst ihn nicht verärgern, indem er der Scheidung des englischen Königs von der Tante des Kaisers zustimmte.
Inzwischen begann sich die internationale Lage zugunsten Karls V. zu ändern. Nachdem 1528 der größte Teil der französischen Armee bei Neapel an der Pest starb, zeichnete sich ab, dass sich Franz I. mit dem Kaiser einigen würde. Wolseys aufrichtiger Glaube (S. 129), dass ein Bündnis mit Frankreich der einzige Weg sei, den Papst auf diplomatischem Wege zu Kompromissen und Widerstand gegen die Habsburger zu bewegen, erforderte eine bedingungslose Teilnahme an den Feindseligkeiten, aber dies erregte unweigerlich den Unmut des Königs und die Intrigen des Königs feudale Opposition unter Führung von Norfolk. Das anglo-französische Bündnis allein brachte der Tudor-Regierung keine Vorteile, aber ihr anti-habsburgischer Kurs in der Außenpolitik änderte sich nicht. Dies zeigt sich vor allem an der Geschichte der Scheidungsverfahren Heinrichs VIII. und Katharina von Aragoniens: Die in der Literatur oft anzutreffende Meinung, die Scheidung sei der Grund für die Reformation gewesen, bedarf der Klärung, weil in Wirklichkeit alles komplizierter war. Erst im Herbst 1529 wurde es zu einem solchen Anlass. Mit der Verstärkung der antihabsburgischen Richtung in der englischen Außenpolitik erwies sich die Eheschließung Heinrichs VIII. mit Katharina von Aragon nicht nur als unrentabel, sondern auch als äußerst gefährlich, da die Die Tante des Kaisers konnte alle habsburgischen und oppositionellen Elemente gegen Heinrich VIII. um sich vereinen. Die Durchführung einer Scheidung und der Abschluss einer neuen Ehe mit Zustimmung des Papstes wäre zugleich ein Kompromiss mit der päpstlichen Kurie. Der Wunsch des englischen Königs, sich mit dem Papst zu einigen, wurde maßgeblich dadurch bestimmt, dass Clemens VII. in der jüngeren Vergangenheit der Kardinalprotektor Englands war, dh der Verteidiger seiner Interessen in der päpstlichen Kurie. Als das Scheidungsverfahren begann, wurden diese Aufgaben von Lorenzo Campeggio wahrgenommen, der Buley durch langjährige Zusammenarbeit verbunden war. Darüber hinaus glaubte Woolsey, dass die Ankunft von Campeggio in England ein Mittel für den Papst sein würde, um in italienischen Angelegenheiten Druck auf den Kaiser auszuüben. Daher wandten sich der König und der Lordkanzler an Clemens VII. mit der Bitte, aus Rom eine Kommission zur Durchführung des Scheidungsverfahrens zu entsenden. Aber als die Franzosen in Italien Niederlagen zu erleiden begannen und der Papst von der ablehnenden Haltung des Kaisers gegenüber der Scheidungsidee erfuhr, beeilte er sich, Campeggio anzuweisen, „Frieden und Harmonie in der Familie des englischen Königs wiederherzustellen“ und eine Scheidung zu verhindern . (S.130)
Diplomaten der Habsburger versuchten, Wolsey mit einer stattlichen Geldsumme und dem Versprechen des Ranges eines Erzbischofs von Toledo zu bestechen, damit er alles tun würde, um die Beziehungen zwischen England und Frankreich zu verschlechtern. Wolsey, der angeheuert wurde, um eine Kompromisslösung für die Familienprobleme des Königs zu finden, befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Er überzeugte Campeggio wiederholt davon, dass Karl V. den Scheidungsfall wahrscheinlich nicht nutzen würde, um Rom oder England anzugreifen. In der Zwischenzeit bemühte sich die Gruppe, die Anne Boleyn unterstützte, um die Entfernung von Woolsey, der versuchte, dies zu verhindern, und versuchte, seine Position mit Hilfe von außenpolitischen Maßnahmen zu stärken, die auf eine Annäherung an Frankreich abzielten.
Beim Prozess gegen die Kardinäle verhielt sich Katharina von Aragon mit großer Würde. Ihre Hauptverteidigungslinie war, dass sie Heinrich VIII. als Jungfrau heiratete. Wolsey verteidigte natürlich die Position des Königs, aber Campeggio wollte nicht über die Befriedigung des Anspruchs Heinrichs VIII. entscheiden. Damit verließ der päpstliche Gesandte England. Der Herzog von Suffolk sagte über den Hof der Kardinäle: „Seit Grundlegung der Welt hat niemand aus Ihrem Besitz England Gutes getan. Wenn ich König wäre, würde ich euch beide sofort ins Exil schicken. Das ergebnislose Ergebnis des Prozesses gegen die Kardinäle war ein Weckruf für Wolsey. Dies war der Beginn seines Untergangs.
Reformationsgefühle verstärkten sich im Land, und Wolsey blieb Katholik und war ein entschiedener Gegner der Reformation. Sein Reichtum, seine Straflosigkeit und seine Sonderstellung unter dem König, die er in rein mittelalterlichem Geist zur Schau stellte, sorgten lange Zeit für Irritationen in Hofkreisen, was in der englischen Gesellschaft Hass gegen den Kardinal hervorrief. Die Partei von Norfolk und Suffolk forderte mit Hilfe von Anne Boleyn den Rücktritt von Wolsey. Bald wurde der Lordkanzler in voller Übereinstimmung mit den damaligen englischen politischen Traditionen des Hochverrats angeklagt. Im Oktober 1529 zog sich Wolsey aus den politischen Angelegenheiten nach York, dem Sitz seines Erzbischofs, zurück. (S.131) Bemerkenswert ist, dass sein Rücktritt am Vorabend des "Parlaments der Reformation" (1529-1536) erfolgte, das große Kirchenreformen durchführte.
Die Absicht, Reformmaßnahmen „von oben“ durchzuführen, mag unerwartet gewirkt haben. Tatsächlich verliebte sich der König nicht so sehr, dass er wegen einer Scheidung von Katharina von Aragon mit der katholischen Kirche brechen würde! Jedenfalls schien es vielen Zeitgenossen so, und dieser Umstand hat die Meinung der Historiker bis heute beeinflusst. Schließlich wussten viele, dass Heinrich VIII. sich in seiner Jugend darauf vorbereitete, den Rang eines Erzbischofs von Canterbury anzunehmen, theologisch versiert war und dem katholischen Glauben angehörte. Für die gegen Luther gerichtete Abhandlung „Zur Verteidigung der sieben Sakramente“ (die größtenteils von Thomas Morus stammen soll) verlieh ihm Papst Leo X. 1521 den Titel „Verteidiger des Glaubens“. Nicht ohne Wissen des Königs veröffentlichte Bischof John Fisher von Rochester, sein ehemaliger Erzieher und sein zukünftiges Opfer, eine Abhandlung über die Verteidigung des katholischen Glaubens gegen Luthers „babylonische Gefangenschaft“. Zwar wurde 1525 auf Initiative des aus seinem Land vertriebenen ehemaligen dänischen Königs Christian II., der sich um die Unterstützung der deutschen Fürsten bemühte, der Versuch unternommen, Heinrich VIII. und Luther zu versöhnen. Der Reformator schrieb dem englischen König einen Entschuldigungsbrief dafür, dass er im Eifer der Kontroversen als Reaktion auf Heinrich VIII. "Thomistenhure" waren unter ihnen vielleicht die unschuldigsten). Doch Heinrich VIII. antwortete sehr ausweichend – der englische König hielt Luther weiterhin für den Hauptschuldigen am Bauernkrieg in Deutschland.
Die Hauptfrage der königlichen Reformation bestand zunächst darin, zu entscheiden, was Gott und was Caesar, also dem englischen König, gehörte. Eine Krise braute sich zusammen, eine Wende in der Politik war unvermeidlich, und der Sturz von Wolsey wurde zu einer Frage der Zeit. Offensichtlich spürte dies die Partei von Norfolk und Anne Boleyn, die auf den Rücktritt des Lordkanzlers lauerten. „Wie auch immer dieser Fall verlaufen wird“, schrieb der Botschafter des Kaisers, Eustace Chapuis, „diejenigen, die diesen Sturm entfacht haben, werden vor nichts zurückschrecken, bis sie den Kardinal vernichtet haben, wohl wissend, dass sie es selbst sind, wenn er sein verlorenes Ansehen und seine verlorene Macht wiedererlangt wird Kopf zahlen." Der Herzog von Norfolk schwor sogar privat, dass er Wolsey lieber lebendig essen würde, als ihm zu erlauben, wieder aufzuerstehen.
Wolsey des Verrats beschuldigend, sagte Henry VIII, dass er in der päpstlichen Kurie intrigierte, um den englischen König dem Thron von Rom zu unterordnen. Aber auch in York wurde der Kardinal nicht allein gelassen. Norfolks Partei befürchtete, dass der abgesetzte Lordkanzler wieder an der Macht sein könnte. Schließlich waren die Handlungen Heinrichs VIII. oft unvorhersehbar, und die Verschwörer selbst waren sich der Absurdität und Falschheit der Anschuldigungen gegen den Kardinal bewusst. Etwas mehr als ein Jahr nach Woolseys Rücktritt wurde er nach London zurückgerufen. Tower Constable Kingston kam für ihn. Es bedeutete Gerüst. Aber auf dem Weg nach London erkrankte Woolsey, schockiert von der königlichen Missgunst, und er starb am 29. November 1530 in der Abtei von Leicester. In seinem Sterbegeständnis sagte Woolsey, dass er wachsam gegen die lutherische Sekte gekämpft habe, die sich nicht verstärken sollte das Königreich, weil Häretiker großen Schaden an Kirchen und Klöstern anrichten. Hier gab er das Beispiel Böhmens während der Hussitenkriege, wo Ketzer das Königreich eroberten und König und Hof unterjochten. "Es ist unmöglich, ich bitte Sie", wandte sich Wolsey an den König, "dass sich die Gemeinden gegen den König und die Adligen des englischen Königreichs erheben." Dieser Aufruf ist äußerst interessant. Entweder hat Wolsey die Absichten des Königs, die Kirche auszurauben, wirklich nicht verstanden, was die außergewöhnliche Fähigkeit Heinrichs VIII. beweist, seine Ziele zu verbergen, oder er wollte auf diese Weise in Frieden mit der katholischen Kirche sterben. Interessant ist auch das Verhalten Heinrichs VIII. Wolsey wurde bereits in den sicheren Tod nach London gebracht, und der König rief bei Gesprächen im Geheimen Rat aus: „… Jeden Tag merke ich, dass ich den Kardinal von York vermisse!“ (S.133)
Mit diesen Worten konnten Norfolk und Suffolk kein Gefühl der Angst um ihr Leben haben – was, wenn der König es nimmt und Wolsey vor Gericht zurückgibt, aber ein paar Tage später starb er. Die Worte des Königs könnten aber auch bedeuten, dass die Partei von Norfolk Heinrich VIII. des gestürzten Kanzlers nicht ersetzen wird, und dass er selbst dafür sehr wohl Verständnis hat. Übrigens verwendete Heinrich VIII. diese Technik oft, während er diejenigen beschuldigte, die zum Sturz seiner Günstlinge beigetragen hatten. So war es bei Thomas More und bei Thomas Cromwell und bei seiner zukünftigen Frau Anne Boleyn.
In den Regierungsjahren Heinrichs waren Schlüsselpositionen von prominenten Staatsmännern besetzt, die die damalige Politik maßgeblich bestimmten. Bis zu einem gewissen Grad hörte der König auf ihre Meinung und verließ sich auf sie, aber er überließ die endgültige Entscheidung immer sich selbst.
Im Oktober 1529 wurde Thomas More, der große Humanist, zum Lordkanzler ernannt, Verfasser vieler, auch theologischer Schriften, die sich gegen Luther und die englischen Reformatoren richteten. More hatte einst mehrere diplomatische Aufgaben bewundernswert erfüllt, aber keine Neigung zu Staatsangelegenheiten gezeigt, da sie ihn von seinen wissenschaftlichen Beschäftigungen ablenkten. Vielleicht hoffte Heinrich VIII., dass der Wissenschaftler, weit weg von den Angelegenheiten der Staatsverwaltung, sein gehorsames Werkzeug sein und keine unabhängige Politik verfolgen würde. Obwohl More nicht wirklich viel Einfluss auf die Staatsgeschäfte hatte, wurde er kein gehorsames Werkzeug des Königs, insbesondere dort, wo es seine Überzeugungen eines Humanisten und eines treuen Katholiken verletzte, was ihn letztendlich nicht nur die Position des Lordkanzlers (in 1532 ging er in den Ruhestand), aber auch der Kopf. More, der sich weigerte, dem König als Oberhaupt der anglikanischen Kirche den Eid zu leisten, wurde des Hochverrats beschuldigt und im Juni 1535 hingerichtet. Heinrich VIII. war rücksichtslos, wenn es um Widerstand ging, selbst gegenüber den Leuten, die er seine Freunde nannte.
Natürlich konnte Thomas More keine Scheidungsfälle lösen. Aber der englische König war hartnäckig in seinem (S. 134) Wunsch, sich von Katharina von Aragon scheiden zu lassen. Im Juni 1530 wurde im Namen des gesamten englischen Volkes eine Adresse an den Papst gesandt, unterzeichnet von siebzig kirchlichen und weltlichen Lords und elf Mitgliedern des House of Commons, die ihre Besorgnis über das Fehlen eines Thronfolgers in England zum Ausdruck brachten . Die Botschaft deutete an, dass die englische Regierung andere Mittel finden würde, um das Hindernis zu beseitigen, wenn der Papst auf seiner Nichtbereitschaft beharre, die Erlaubnis zur Scheidung zu erteilen. Noch früher entschied der Kongress der englischen Geistlichkeit, dass die Ehe von Katharina von Aragon mit Heinrich VIII. gegen die göttlichen Gesetze verstoße. Nun galt es, eine Person zu finden, die im Scheidungsfall ein Instrument des Königs werden könnte. Sie wurden zum bisher unbekannten Thomas Krenmer, einer der mysteriösesten und kuriosesten Gestalten jener Zeit. Vielleicht hätten wir nie von ihm erfahren, wenn nicht die Scheidung des Königs gewesen wäre, die in verschiedenen Kreisen der englischen Bevölkerung viel diskutiert wurde. Krenmer schlug vor, die Meinungen theologischer Fakultäten europäischer Universitäten zugunsten einer Scheidung einzuholen. Krenmers Vorschlag wurde Heinrich VIII. gemeldet, und von da an begann sein Aufstieg. Tatsächlich standen viele Universitäten auf der Seite des Königs, und nur die Sorbonne sprach sich, wenn auch sehr ausweichend, gegen die Scheidung aus. Der Erfolg bei der Lösung dieses Falls trug zum weiteren Aufstieg von Krenmer durch die Reihen bei. Dieser äußerlich attraktive, elegante, körperlich starke (bis zu seinem 66. Lebensjahr ritt er ausgezeichnet), anzügliche und besonnene Mann wird nach dem Tod des Erzbischofs von Canterbury William Warham im Jahr 1532 Primat, also das Oberhaupt der katholischen Kirche in England. Aufgrund seiner Erhebung zum König erteilt er bald die Erlaubnis zur Scheidung Heinrichs VIII. Von Katharina von Aragon und krönt dann den Monarchen mit Anne Boleyn, die zu diesem Zeitpunkt bereits mit der zukünftigen Königin Elizabeth schwanger war. Seitdem ist Krenmer ein treuer Diener Heinrichs VIII. geworden. Er wird nicht nur den König selbst überleben, sondern auch seinen Sohn Eduard VI. (1547–1553). 1556, während der Herrschaft Marias des Blutigen (S. 135), wird Krenmer Opfer von Repressionen gegen die Protestanten - er wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Der Erzbischof von Canterbury war ein konsequenter Protestant, aber sehr flexibel und vorsichtig. Wo er den entscheidenden Widerstand des Königs sah, wich er zurück. Crenmer war ein Befürworter der Säkularisierung von Klöstern, hatte es aber im Gegensatz zu Thomas Cromwell nicht eilig, sie umzusetzen. Er flehte um Anne Boleyn, als der König sie hinrichten wollte, aber er tat es vorsichtig, mit Bedacht: Er hatte immer eine Lücke zum Rückzug. Heinrich VIII. schätzte diese Qualitäten von Krenmer voll und ganz, und obwohl das Schicksal des letzteren aufgrund der Intrigen von Norfolk und seinen Anhängern mehrmals auf dem Spiel stand, gelang es ihm dennoch, seine Position zu behaupten. Der Erzbischof sah bescheiden und demütig aus, beteiligte sich nicht am Raub der Klöster und bewahrte ihn dadurch vor den Angriffen Heinrichs VIII.
Aber der wichtigste Staatsmann Englands in der Regierungszeit Heinrichs VIII. war zweifellos Thomas Cromwell. Sein Porträt von Hans Holbein dem Jüngeren gibt eine hervorragende Vorstellung vom Charakter dieses Mannes. Kleinwüchsig, kräftig, mit willensstarkem Doppelkinn, kleinen grünen Augen, kurzem Hals, sehr beweglich, war er die Verkörperung von Kraft, Energie und Geschäftstätigkeit. Cromwell zeichnete sich durch Gerissenheit aus, er verstand es, sich genau den Menschen zu nähern, die er brauchte, und seine Stimmungen und Gedanken zu verbergen. Cromwell, ein einfacher Mann (er war der Sohn eines Schmieds), begann seine Karriere als Söldner in Italien, trat dann in die Dienste von Wolsey, war sein Handelsvertreter und wurde später ein Vertrauter. Er heiratete günstig die Tochter eines wohlhabenden Londoner Kaufmanns und wurde bald Mitglied des Parlaments. Als Wolsey fiel, wurde Cromwell sehr alarmiert. Jedenfalls verhielt er sich gegenüber seinem ehemaligen Gönner sehr zurückhaltend und versuchte bald, sich von ihm zu distanzieren. Im Parlament von 1529 erhielt Cromwell bereits dank des Herzogs von Norfolk, der damals die Gunst des Königs genoss, einen Sitz. Die Schirmherrschaft von Norfolk öffnete dem ehrgeizigen jungen Mann die Türen des königlichen Hofes weit. Als das "Parlament der Reformation" seine Arbeit aufnahm und vom 3. November 1529 bis zum 4. April 1536 zusammentrat, begann Cromwell, über sein Programm nachzudenken, dessen Zweck darin bestand, gleichzeitig die königliche Macht in England und seine eigene Erhebung in England zu stärken Reihen. Es gibt eine Legende, die erzählt, wie Cromwell bei Henry VIII in Gunst geriet. Es war bekannt, dass der König in den Morgenstunden gerne alleine im Garten der Westminster Abbey spazieren ging. Cromwell, der dies wusste, versteckte sich in einen schwarzen Umhang gehüllt hinter einem der Bäume. Sobald der König ihn eingeholt hatte, trat Cromwell hinter einem Baum hervor, offenbarte sich ihm und skizzierte seinen Plan, der aus drei wichtigen Punkten bestand: die Durchführung einer Scheidung von Katharina von Aragon, die Säkularisierung von Kirche und Kloster Ländereien und die Umsetzung einer Politik des Gleichgewichts zwischen Frankreich und dem Imperium. Heinrich VIII. mochte dieses Programm sehr und begann bald, Cromwell schnell in seinen Dienst zu stellen, wodurch der ehemalige Agent Wolsey zum ersten Favoriten des Königs wurde.
Cromwells Karriere in der Verwaltung ist bezeichnend: 1533 wurde er Schatzkanzler, 1534 Staatssekretär, was dem modernen Außenminister entspricht, 1535, 1536 Generalvikar, also Leiter der Kirchenangelegenheiten - Lord Privy Seal, 1539 - Lord Chief Ruler of England, 1540 klagt er über den Titel Earl of Essex. In den Händen von Cromwell lagen fast alle Fäden der Regierung – Finanzen, Kirche, Außenpolitik. Er brauchte nicht einmal das Amt des Lordkanzlers, das seit 1532 von dem unbedeutenden und keine ernsthafte Rolle spielenden Sir Thomas Audley bekleidet wurde. Die wichtigsten Ereignisse der königlichen Reformation in England, beginnend mit dem Canterbury Clergy Pardon Act (1532) und endend mit der Säkularisierung von Kirchen- und Klosterland, werden hauptsächlich mit dem Namen Thomas Cromwell in Verbindung gebracht. (S.137)
In Glaubensfragen war Cromwell vor allem ein praktischer Politiker: Er kann nicht als konsequenter Protestant bezeichnet werden, da er die Reformation als Mittel zur Stärkung der staatlichen und königlichen Macht ansah. Die Unterwerfung des Klerus und die Errichtung der königlichen Oberhoheit über die Kirche waren die Hauptziele von Cromwells Religionspolitik. Seine finanziellen Maßnahmen waren jedoch nicht erfolgreich. Infolge der Säkularisierung gelangten die meisten ehemaligen Kloster- und Kirchengüter nicht in den Besitz des Königs, sondern zunächst in den Besitz des Adels und dann durch Spekulation und Weiterverkauf in den Besitz zahlreicher Medien und kleine Adlige (Adel). Die Sache kam zu Kuriositäten. Für einen köstlich zubereiteten Pudding verlieh der König beispielsweise einer Hofdame das Land der größten Abtei von Glastonbury. Es war eine typisch feudale Geste. Auf jeden Fall musste der König seine Großzügigkeit zeigen. Obwohl die "Preisrevolution" gerade erst begonnen hatte, begannen infolge ungünstiger Handelsbedingungen, magerer Jahre und Nahrungsmittelknappheit die Preise zu steigen, die Kosten für die Aufrechterhaltung der Armee, des Staatsapparats und des Gerichts sowie die Verstärkung der Grenzen zu steigen. Daher erhielt die Regierung praktisch nichts.
In den 30er Jahren. die Lehre und Organisation der anglikanischen Kirche wurde gebildet, deren Oberhaupt der englische König war. Trotz aller Schwankungen entweder in Richtung Protestantismus oder in Richtung Katholizismus wurde unter direkter Beteiligung Cromwells ein pragmatischer Mittelweg zwischen Rom und Wittenberg entwickelt – ein Weg, der vor allem der englischen Monarchie entgegenkam, die ihre zu stärken suchte Macht über die Kirche und plündern sie, und am wenigsten anfällig für wesentliche Änderungen in Lehre und Glauben. Unter Cromwell durfte die Bibel auf Englisch veröffentlicht werden. Diese Bibel durfte (S. 138) nur von Herren und wohlhabenden Kaufleuten gelesen werden. Cromwell selbst machte Abweichungen von der orthodoxen Lehre nicht sichtbar, so charakterisierte er beispielsweise die Schriften und Urteile des radikalen Reformers Tyndall in einem Brief an seinen Freund, den berühmten Diplomaten und Kaufmann Stephen Vaughan, als fehlerhaft. Der König, der sich auf das gehorsame Parlament und den von Cromwell geführten Staatsapparat stützte, konnte es sich leisten, allen Anathemen und Exkommunikationen gegenüber, die von der römischen Kurie kamen, gleichgültig zu sein.
Gleichzeitig mit den wichtigsten antikirchlichen Maßnahmen begann Cromwell mit der Reorganisation des Staatsapparats. Der neue Günstling Heinrichs VIII. versuchte, ein starr zentralisiertes, fast despotisches Regierungssystem zu stärken, das vollständig dem König und nicht dem Parlament untergeordnet war. Die Verwaltungsreformen von Thomas Cromwell spielten eine große Rolle bei der Schaffung eines solchen Managementsystems.
Allerdings wurden sie alle nach Bedarf spontan durchgeführt, und vor allem die Anhäufung von Posten und das Vertrauen auf die Gnade des Königs legen nahe, dass es in Cromwells Politik einige typische mittelalterliche Merkmale gab. Einen wirklich konkreten Plan zur Reform des Staatsapparates und klare theoretische Ansichten hatte er nicht. Einer der letzten Plantagenets, Reginald Pohl, der 1536 Kardinal der Römischen Kurie wurde, noch vor seiner endgültigen Abreise nach Italien, sprach mit Cromwell und war schockiert, als er von ihm hörte, dass Plato nur für gelehrte Streitigkeiten existiert, und sah ihn daher als an ein allmächtiger Lieblingsbote des Satans, der den König verführte und die Familie Field zerstörte (1538 wurde die 72-jährige Mutter von Reginald Paul Matilda hingerichtet). Natürlich darf man die Verschärfung der Repression unter Cromwell nicht ignorieren – allein 1532 wurden 1445 Menschen wegen Hochverrats hingerichtet. Der Höhepunkt der Verfolgung kam 1536-1537. Durch zahlreiche Hinrichtungen, die eher auf Initiative des Königs selbst als auf Initiative seines treuen Dieners durchgeführt wurden, erwarb sich Cromwell den Hass vieler Teile der englischen Bevölkerung. (S.139)
Cromwell war am unmittelbarsten in die Eheangelegenheiten Heinrichs VIII. Involviert. Anfang Januar 1536 wurde Anne Boleyn mit einem toten Kind (es war ein Junge) von ihrer Last befreit. Der König beschwerte sich bei einem seiner Vertrauten, dass Gott ihm erneut einen Sohn verweigere. Er, Heinrich, sei angeblich durch die Macht der Hexerei verführt worden und deshalb mit Anna eine Ehe eingegangen, und wenn ja, solle diese Ehe annulliert und der König eine neue Frau nehmen. Im Frühjahr 1536 wurde Anne Boleyns Position erschüttert. Ihre Beziehung zu ihrem Onkel, dem Herzog von Norfolk, wurde ausgesprochen feindselig. Ihr Einfluss auf den König zum Zeitpunkt ihrer Heirat war stark reduziert. Im Frühjahr 1536 begann Heinrich VIII., Jane Seymour anzuziehen, die sich im Allgemeinen durch nichts Besonderes auszeichnete. Die Einstellung des Königs zu diesem Mädchen begann bei Hofe zu sprechen, es wurden sogar Balladen komponiert, wegen denen (S. 140) sie, ihr Bruder Earl of Hertford (der zukünftige Herzog von Somerset, Lord Protector unter Edward VI) und seine Frau wurde auf ihre Ländereien gebracht. Der Botschafter Karls V., Eustace Chapuis, hörte auf, den König und Anna nach der Messe zum Refektorium zu begleiten. Das war schon mal ein schlechtes Zeichen. Anna erkannte, dass sie in den Augen des Kaisers ihre politische Bedeutung verloren hatte. Die Nachricht von der Vorliebe Heinrichs VIII. für Jane Seymour stieß an europäischen Gerichten auf gemischte Kritiken. Der neue Favorit war ein Verwandter des Londoner Bischofs Stokesley, einer der Unterstützer der katholischen Opposition. Der französische König Franz I. begann zu glauben, dass dies schlimme Folgen für das französisch-englische Bündnis haben könnte, und Karl V. schlug vor, dass Heinrich, nachdem er sich von Anna scheiden ließ, sich mit ihm und der römischen Kurie versöhnen würde.
Aber Heinrich VIII. ließ sich von Anne Boleyn nicht nur scheiden, sondern er richtete sie auch hin. Zuerst wurde sie des Ehebruchs beschuldigt (Cromwells Agenten spielten eine herausragende Rolle bei der Vorbereitung der Anklage) und, nachdem sich diese Anklage als unhaltbar herausstellte, des Versuchs auf das Leben des Königs. Nach damaliger Auffassung kam dies einem Hochverrat gleich. Am 19. Mai 1536 wurde Anne Boleyn hingerichtet und Heinrich VIII. heiratete sofort Jane Seymour. Es ist merkwürdig, dass der englische König Cromwell nach einiger Zeit vorwarf, seine zweite Frau verleumdet zu haben. Man kann sich vorstellen, wie dem allmächtigen Minister das Herz in der Brust sank. Aber die Heirat mit Jane Seymour änderte nichts an der Religionspolitik Heinrichs VIII. Als Jane versuchte, ihn von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Klöster wieder aufzubauen, erinnerte der König sie an Anne Boleyns traurige Erfahrung, sich in Staatsangelegenheiten einzumischen.
Aber bald wurde Heinrich VIII. Witwer. Jane Seymour starb bei der Geburt des späteren Königs Eduard VI. am 12. Oktober 1537. Übrigens ließ dieser Umstand in der Seele Kaiser Karls V. die Hoffnung aufkommen, dass dies mit Hilfe verschiedener Optionen möglich sein würde arrangieren die Hochzeit des verwitweten englischen Königs mit einem der Verwandten des Hauses Habsburg. Insbesondere Heinrich VIII. wurde die 16-jährige (S. 141) Witwe des Herzogs von Mailand zur Frau angeboten. Parallel dazu liefen Verhandlungen über die Hochzeit des portugiesischen Prinzen Louis und Mary Tudor. Diese Verhandlungen dauerten die ganze erste Hälfte des Jahres 1538 an. Aber die habsburgischen Diplomaten forderten statt der anfänglich versprochenen 100.000 Mitgiftkronen für die Herzogin von Mailand schließlich die lächerliche Summe von 15.000. Offenbar hat die habsburgische Diplomatie bewusst auf Zeit gespielt und versucht, den erfolgreichen Abschluss der laufenden Verhandlungen zwischen London und Paris und den protestantischen Fürsten Deutschlands zu verhindern.
Verhandlungen mit ihnen nahmen in der Diplomatie Heinrichs VIII. einen besonderen Platz ein. Mit Hilfe eines Bündnisses mit den deutschen Fürsten und Frankreich hofften er und Cromwell, ein mächtiges Gegengewicht zu den Habsburgern zu schaffen. Überhaupt war Thomas Cromwell in Verhandlungen mit den Deutschen äußerst aktiv, da er nicht umsonst im Zusammenschluss mit ihnen ein Mittel zur Stärkung der außenpolitischen Positionen der englischen Monarchie sah. Der Gründung dieser Union standen jedoch erhebliche Hindernisse im Wege. Nach dem Nürnberger Religionsfrieden von 1532 konnten protestantische Fürsten politische Abkommen nur mit jenen Staaten schließen, die die Darlegung der Grundsätze des „Augsburger Bekenntnisses“ von 1530, also des Luthertums oder zumindest des Zwinglianismus, anerkannten. Natürlich war das katholische Frankreich sofort aus dem Spiel. Etwas Hoffnung wurde den Fürsten durch die Reformation in England gegeben, aber sie war, wie bereits erwähnt, weit davon entfernt, im lutherischen Geist zu sein.
Heinrich VIII. strebte keineswegs eine religiöse Einheit mit den deutschen Protestanten an. Geleitet von innenpolitischen Erwägungen wollte er die Vertiefung von Reformprozessen im Land nicht zulassen, wenn das Luthertum als offizielles Dogma anerkannt wurde. Außenpolitisch befand sich die englische Krone auf den ersten Blick in einer recht günstigen Lage, da Frankreich, das Reich und die protestantischen Fürstentümer Deutschlands gleichzeitig ein Bündnis mit ihr suchten. Zu Beginn des Sommers 1538 wartete der englische König in Nizza auf die Verhandlungsergebnisse. Es war klar, dass der Kaiser (S. 142) einen langen Waffenstillstand anstrebte, um erneut zu versuchen, die lutherischen Fürsten ihrer Macht zu unterwerfen. Aber eine solche Wendung würde sich zwangsläufig auf die Politik Englands und des Schmalkaldischen Bundes auswirken und vielleicht sogar zu ihrer Annäherung beitragen. Die Demonstration der französisch-imperialen Annäherung in Form von Manövern der vereinigten Flotte an der Scheldemündung, die acht Monate nach Abschluss des zehnjährigen Waffenstillstands in Nizza folgte, alarmierte Heinrich VIII., obwohl die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Politik bestand des "Machtgleichgewichts" verblaßte nicht, während die Situation in Westeuropa eskalierte.
Die Drohung einer antienglischen Expedition wurde immer greifbarer. Am 21. Februar 1539 wurden alle englischen Schiffe in den niederländischen Häfen verhaftet, die französischen und spanischen Botschafter wurden aus London zurückgerufen. Die Royal Navy wurde in Alarmbereitschaft versetzt, die Befestigungen an der Südküste bereiteten sich dringend darauf vor, die feindlichen Landungen abzuwehren. Doch bald war der Vorfall vorbei. Die Flotte Karls V. in Antwerpen wurde aufgelöst, und die Botschafter kehrten nach London zurück. Offensichtlich würde niemand England ernsthaft angreifen, schon gar nicht der französische König. Es spielte auch eine Rolle, dass sowohl Karl V. als auch Franz I. in Zukunft auf verbündete Beziehungen zu Heinrich VIII. setzten und erkannten, dass der Konflikt zwischen dem Reich und Frankreich bald mit neuer Kraft wieder aufgenommen werden könnte.
Aus den Ereignissen in London wurden Schlussfolgerungen gezogen. Cromwell überzeugte Heinrich VII.! das Bündnis mit den protestantischen Fürsten festigen, indem sie sich eine Frau aus irgendeinem deutschen Fürstenhaus nehmen. Vielleicht zeigte der Minister hier übertriebene Ungeduld, die ihn später teuer zu stehen kam. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es nachvollziehbar. Cromwell war es leid, darauf zu warten, dass die französische Krone oder die kaiserlichen Behörden endlich einer Beteiligung Englands an ihren Angelegenheiten zustimmten, und damit das Land nicht in politische Isolation geriet, beschloss er, sich erneut an die deutschen Protestanten zu wenden. (S.143)
In dieser Situation nahm schließlich die Option „Kleve“ Gestalt an, die auf der Idee basierte, dynastische Ehen zwischen den Tudors und den Herzögen von Jülich-Kleve, den Besitzern eines kleinen, aber strategisch wichtigen, im Unterlauf gelegenen Herzogtums, zu schließen des Rheins. Protestantische Führer hätten den jungen Herzog Wilhelm auch in Zukunft kaum vor den Ansprüchen Karls V. schützen können, der damit drohte, Gelderland von Jülich-Kleve zu übernehmen. Daher unternahmen sie einen Versuch, die englische Krone mit der Aussicht zu interessieren, Prinzessin Mary mit William und seine ältere Schwester Anna mit Heinrich VIII. selbst zu heiraten. Dies ließ auf die Gewinnung gleich zweier Verbündeter hoffen, nämlich den Schmalkaldischen Bund und Jülich-Kleve, ohne einen religiösen Kompromiss zu erzielen.
Cromwell gefiel die Idee sehr gut, denn nun war es nicht nötig, die Theologen zu einer Einigung zu bringen, England wurde kraft dynastischer Eheschließungen ein Verbündeter von Julich-Cleve, und da dieses Herzogtum wiederum ein Verbündeter der protestantischen Fürsten von war Deutschland bedeutete dies die eigentliche politische Annäherung Englands an den Schmalkaldischen Bund. Ein außenpolitischer Erfolg, wie Cromwell hoffte, würde es ihm ermöglichen, hart gegen die Opposition vorzugehen. Der Minister wies den König unmissverständlich darauf hin: In den laufenden Verhandlungen stört die englische Regierung nichts, ihre Forderungen werden nicht zurückgewiesen, weil die Schmalkaldier sich nicht gegen Kaiser und Papst geschlagen geben wollen; außerdem haben die Vertreter Karls V. noch keine Antwort gegeben, ob er damit einverstanden ist, dass England die Rolle eines Vermittlers in den Beziehungen zwischen Frankreich und dem Reich spielt. Wäre es nicht besser, rechtzeitig die Unterstützung der deutschen Fürsten zu gewinnen, als sich plötzlich den vereinten Kräften Frankreichs und des Imperiums gegenüberzustehen!
Der König, überzeugt von der Logik und dem Angriff Cromwells, gab nach, und der Minister begann, seine Agenten zu drängen, damit sie so schnell wie möglich eine positive Antwort von den Vertretern des Schmalkaldischen Bundes erhielten. Cromwell war sich jedoch nicht ganz sicher, ob er Heinrich VIII. endgültig (S. 144) überzeugt hatte. Der Einsatz in diesem politischen Spiel war zu hoch!
Wie sich herausstellte, hatte Cromwell es eindeutig eilig. Er war erschrocken über die unwahrscheinliche Drohung eines gemeinsamen Vorgehens des Reiches und Frankreichs gegen Albion (für letzteres wäre dies gleichbedeutend mit der Anerkennung der politischen Abhängigkeit von Karl V.) und unternahm daher den falschen Schritt. Gerüchte über die Kriegsvorbereitungen des Kaisers machten ihm damals große Sorgen. Der König, der sowohl im Ehebruch als auch im Bruch politischer Vereinbarungen bereits über große Erfahrung verfügte, konnte ein Bündnis mit den protestantischen Fürsten immer dann ablehnen, wenn sich neue Optionen für politische Verbindungen mit Frankreich und den Habsburgern ergaben. Außerdem wurde die eigentliche Vereinigung nicht durch eine förmliche Vereinbarung besiegelt.
Im Oktober 1539 wurde ein Vertrag über die Eheschließung zwischen Heinrich VIII. und Anna von Kleve geschlossen. Natürlich war die Lösung der Ehefrage rein politischer Natur. Doch dem englischen König, der für seine 48 Jahre schon ziemlich dick und schwabbelig war und außerdem an einer Fistel im Bein litt, waren weibliche Reize immer noch nicht gleichgültig. Bevor er Anna heiratete, wollte er ihr lebensgroßes Porträt sehen. Ein solches Porträt, in Eile gemalt von dem berühmten Künstler Hans Holbein dem Jüngeren, wurde nach London geliefert. Der englische Diplomat Wallop bewies dem König, dass Anna hübsch und ein Musterbeispiel aller Tugenden war, doch das Porträt bezeugte etwas anderes: Obwohl der berühmte Künstler dem Original ein wenig schmeichelte, konnte er dennoch die vielen Makel im Erscheinungsbild der Braut nicht verbergen. Nach den damaligen Vorstellungen war Anna von Klevskaya ein überreifes Mädchen von 24 Jahren, nicht gut erzogen, groß (Heinrich VIII. liebte Frauen mit anmutiger Statur) und großen, hässlichen Gesichtszügen. Als der englische König dieses Porträt sah, sagte er den berühmten Satz: „Das ist ein westfälisches Pferd!“ Trotzdem gab es keinen Rückzug, und am 6. Januar 1540 traf Anna von Kleve in London ein. Heinrich VIII. küsste sie zärtlich, sie heirateten, und am Abend gestand er einem seiner Höflinge, dass er (S. 145) den ekelhaftesten Tag seiner Regierung fast überlebt habe. Das war schon ein schlechtes Zeichen für Cromwell. Bald nach der Heirat begann Heinrich VIII., auf einer Scheidung von Anna von Kleve zu bestehen, unter dem Vorwand, dass sie vor ihm eine Beziehung mit dem Sohn des Herzogs von Lothringen hatte, aber solche Aussagen waren unbegründet. Cromwell konnte die Umsetzung der Pläne des Königs vorübergehend verlangsamen.
Heinrich VIII. schickte den Herzog von Norfolk in diplomatischer Mission nach Paris, dessen Aufgabe es war, die Zustimmung Frankreichs zur Teilnahme an einem neuen antiimperialen Bündnis zu erhalten. Norfolk meldete bald nach London, Franz I. könne kaum einen Krieg gegen den Kaiser beginnen, da er nun wegen des Herzogtums Mailand mit ihm verhandele und auf Zugeständnisse hoffe.
Natürlich wären ohne die Hilfe Frankreichs Militäroperationen gegen Karl V. für England einfach undenkbar gewesen. Dadurch wurde das Bündnis mit den deutschen Protestanten für den englischen (S. 146) König völlig unnötig. Aber es gab den Wunsch, den Habsburgern näher zu kommen. Die Verärgerung des Königs über ein großes außenpolitisches Versagen und die Heirat mit Anna von Kleve, die er nach eigenen Angaben nie anrührte, wandte sich gegen Cromwell. Bald sanktionierte Heinrich VIII. heimlich die Verhaftung seines Günstlings. Der Sturz Cromwells war nicht nur das Ergebnis von Misserfolgen auf internationaler Ebene, sondern auch das Ergebnis eines kurzfristigen Erstarkens der feudalkatholischen Opposition, die seine Fehler ausnutzte. Unzufriedenheit erregte er auch damit, dass er sich einen beträchtlichen Teil des säkularisierten Klosterbesitzes aneignete. Nach nicht ganz genauen Angaben erhielt er Vermögen in Höhe von etwa 100.000 Pfund. Krenmer schrieb nicht ohne Bosheit an den König: "Ich bin sicher, dass andere die besten Ländereien erhalten haben, und nicht Ihre Majestät."
Am 10. Juni 1540 wurde der bis dahin allmächtige Günstling bei einer Sitzung des Geheimen Rates des Hochverrats angeklagt und verhaftet. Es geschah so. Gegen drei Uhr nachmittags gesellte sich Cromwell zu den anderen Ratsmitgliedern, um die Nachmittagssitzung zu beginnen. Er fand sie um einen Tisch herumstehen, zu dem Cromwell ging, um Platz zu nehmen. „Sie haben es eilig, meine Herren, fangen wir an“, sagte er. Als Antwort sagte der Oppositionsführer Norfolk mit lauter Stimme: „Cromwell, Sie dürfen hier nicht sitzen. Verräter sitzen nicht neben Gentlemen." Norfolks Worte waren ein herkömmliches Zeichen, mit dem die Offiziere der Wache hinter dem Vorhang hervorkamen. Cromwell wurde festgenommen und in den Tower gebracht. Einer der Hauptvorwürfe gegen ihn war die Förderung der Protestanten. Im Turm entschied Cromwell, dass sein Sturz durch eine Rückkehr zum Katholizismus verursacht wurde, begann den König um Vergebung zu bitten und erklärte dann stolz, dass er bereit sei, im katholischen Glauben zu sterben. Heinrich VIII. war eine so verschwiegene, schlaue und unberechenbare Person, dass selbst Cromwell, der ihn gut kannte und fast immer die Stimmung des Königs einzuschätzen wusste, nicht verstand, dass die königliche Reformation in England auf Initiative und auf Initiative durchgeführt wurde Geheiß Heinrichs selbst, war kein Zufall, sondern (S. 147) ein ganz natürliches Phänomen, das nur scheinbar das Aussehen eines Spielzeugs bewahrte, das nach Lust und Laune des Herrn zuerst in die eine, dann in die andere Richtung gezogen werden kann.
Cromwell, der noch nicht all seiner Titel und Ämter beraubt war, genehmigte direkt im Tower die Scheidung Heinrichs VIII. Von Anna von Cleves, die sofort mit ihrem lebenden Ehemann zur Königinwitwe erklärt wurde. (Dies war jedoch bereits die zweite Königinwitwe; die erste war Katharina von Aragon, die am 8. Januar 1536 starb.) Es ist merkwürdig, dass Anna von Kleve in England blieb: Sie erhielt eine anständige Zulage und einen Palast, in dem sie lebte den Rest ihres Lebens, völlig unsichtbar, braucht niemand.
Am 28. Juni 1540 fand die Hinrichtung des einstigen Günstlings statt. Einen Tag später wurden sechs weitere Menschen hingerichtet – drei der Häresie angeklagte Protestanten und drei des Hochverrats angeklagte Katholiken. Damit zeigte Heinrich VIII. gewissermaßen, dass er keineswegs beabsichtigte, seine Kirchenpolitik zu revidieren, indem er auf einem Mittelweg zwischen Rom und Wittenberg festhielt.
Nach einiger Zeit, entweder in Erinnerungen schwelgend oder die administrativen Fähigkeiten von Cromwell wirklich zu schätzen, erklärte Henry VIII einmal bei einer Sitzung des Geheimen Rates, dass er nie wieder einen solchen Diener wie Cromwell haben würde. Mit diesen Worten warnte er jedoch die Führer der feudalen Opposition sozusagen, dass das traurige Schicksal des in Ungnade gefallenen Ministers auf sie warten könnte.
In den letzten Jahren seiner Regentschaft war Heinrich VIII. nicht mehr auf die Hilfe von Günstlingen angewiesen. Wolsey und Cromwell gehörten dem Reich der Schatten an, während Norfolk und Gardiner brillante Höflinge und kluge Intriganten, aber keineswegs große Staatsmänner waren. Übrigens war ihr Schicksal auch nicht beneidenswert. Selten gelang es einer der bedeutenden Persönlichkeiten am Hofe (S. 148) von Heinrich VIII., Gefängnis oder Hinrichtung zu vermeiden. Kurz vor seinem Tod beschuldigte der König Norfolk und seinen Sohn, den Earl of Surrey, damals ein bekannter Dichter, der Verschwörung gegen ihn und damit des Verrats. Surrey wurde hingerichtet, und Norfolk wurde nur durch den Tod des Despotenkönigs vom Schafott gerettet. Er verbrachte alle Jahre der Regierungszeit von Edward VI. (1547-1553) im Tower - sie vergaßen ihn einfach - nur die Thronbesteigung der Katholikin Mary Tudor (in der protestantischen Tradition - Bloody Mary) rettete ihn vor dem Unvermeidlichen Tod im Gefängnis. Er verließ den Tower als sehr schwacher alter Mann und spielte keine Rolle mehr in politischen Angelegenheiten. Gardiner musste auch einige Zeit in Gefangenschaft im Tower unter dem jungen Edward VI verbringen, für den die Protektoren Somerset und Northumberland, Anhänger des Protestantismus, regierten. Während der Regierungszeit Mariens (1533-1558) diente er als Lordkanzler und verfolgte eine sehr vorsichtige und listige Politik, aber er blieb nicht lange in diesem Amt.
In den letzten Jahren seines Lebens nahmen das Misstrauen und Misstrauen Heinrichs VIII. dramatisch zu. Überall schien er Verschwörungen, Anschläge auf sein Leben und auf den Thron zu sehen. Verdachtsmomente, die den König quälten, veranlassten ihn, seine wirklichen und imaginären Feinde anzugreifen, bevor sie etwas tun konnten. Das beste Beispiel dafür ist die Hinrichtung von Surrey und die Inhaftierung von Norfolk. Prinz Edward wuchs als schwacher und kränklicher Junge auf, und in dem Bemühen, den Thron für die Tudor-Dynastie zu sichern, änderte der König das Testament mehrmals. In der letzten Version war die Reihenfolge der Thronfolge wie folgt: Edward, im Falle seines Todes - Mary, ebenfalls kränklich und willensschwach, und nach ihr, im Falle ihres Todes, ihre Tochter aus ihrer Ehe an Anna Boleyn Elizabeth.
Ab Februar 1545 begann Heinrich VIII. erneut, Beziehungen zu den protestantischen Fürsten Deutschlands aufzunehmen, die befürchteten, Karl V. würde bald einen Krieg gegen sie beginnen. Am Ende wurde zwischen Franz I. und Heinrich VIII. am 7. Juni 1546 ein Friedensvertrag geschlossen, der ein wichtiger Schritt zur Bildung einer neuen Anti-Habsburg-Koalition sein könnte. Aber der englische König selbst schwächelte bereits deutlich. (S.149)
Während der Friedenszeremonie mit Frankreich, schrieben Augenzeugen, habe er sich ständig an Krenmers Schulter gelehnt, während Heinrich VIII. den Protestanten in England selbst Zugeständnisse gemacht habe. Crenmer durfte die Hauptgebete und Psalmen ins Englische übersetzen. Um die Streitigkeiten über die Thronfolge zu beenden (da Eduard schwach und kränklich war, bestanden die Katholiken darauf, Maria als rechtmäßige Erbin anzuerkennen, und die Protestanten - Elizabeth), erließ das Parlament ein Dekret, das dem König die Exklusivität gewährte Recht, die Krone durch eine besondere Urkunde oder ein Testament an jemand anderen zu übertragen. Auf der Grundlage dieses Dekrets wurde im November 1546 ein Testament errichtet, das bereits oben erwähnt wurde.
In den 40er Jahren. der alte König heiratete noch zweimal. Zuerst mochte er die zwanzigjährige Nichte des Herzogs von Norfolk, Catherine Howard. Onkel tat sein Bestes, um sie zur Königin zu machen. Aber bald entdeckte Henry VIII, dass Catherine Howard ihm untreu war, vor allem hatte er Angst vor dem zunehmenden Einfluss von Norfolk. Catherine wurde des Ehebruchs beschuldigt und hingerichtet. Der König heiratete dann die Witwe von Lord Latimer, Catherine Parr, die vor dieser Ehe bereits drei Ehemänner überlebt hatte. Sie mischte sich nicht in politische Angelegenheiten ein, was Heinrich VIII. jedoch nicht daran hinderte, sie vor Gericht zu bringen, aber der Tod des Königs, der am 26. Januar 1547 folgte, rettete Catherine Parr vor dem Schafott, das sie bedrohte. Sie überlebte ihren vierten Ehemann.
Als Heinrich VIII. starb, wagten die Höflinge es nicht sofort zu glauben. Sie dachten, der verdammte König tue nur so, als würde er schlafen und lauschte, was sie über ihn sagten, um aufzustehen und sich an ihnen für ihre Unverschämtheit und Aufsässigkeit zu rächen. Und erst als die ersten Anzeichen der Verwesung des Körpers auftauchten, wurde klar, dass der Tyrann nicht mehr aufstehen würde.
Was ist bemerkenswert an der Herrschaft und Politik dieses Königs? Zunächst einmal scheint mir, dass in den Jahren seiner Regierung die Grundsteine (S. 150) der absoluten englischen Monarchie gelegt und die Grundprinzipien der „Balance of Power“-Politik in internationalen Angelegenheiten entwickelt wurden, die zeichnete England für viele nachfolgende Jahrhunderte aus. Aber all dies wurde durch äußerst despotische Methoden geschaffen. Der heimtückische, misstrauische und grausame König war nicht nur rücksichtslos gegenüber seinen wahren Feinden, sondern auch gegenüber denen, die das Gebäude des englischen Absolutismus errichteten (Wolsey, Cromwell), und gegenüber denen, die den Weltruhm Englands jener Jahre ausmachten ( Thomas Mehr).
In der Politik Heinrichs VIII. spürte man sowohl das Erbe des Mittelalters als auch die Keime der nationalen Politik nachfolgender Epochen.
______________________________
1 Richard III. von York ist der letzte König der Yorker Dynastie. Der Krieg der scharlachroten und weißen Rosen (1455-1485) zwischen den Anhängern der Yorks und der Lancasters endete mit einem Sieg für die letzteren, und Henry Tudor, ein Verwandter der Lancasters, bestieg den Thron.
2 Dies bezieht sich auf Octavian Augustus, ab 27 v. e. bis 14 n. Chr Princeps des römischen Staates, und tatsächlich der Kaiser (daher der Name seiner Herrschaft - das Prinzipat des Augustus). Er bevormundete Schriftsteller und Historiker.
3 Die Dynastie, die England von 1154 bis 1399 regierte. Durch die Heirat der englischen Königin Matilda, Tochter des englischen Königs Heinrich 1. (1100-1135), und des Grafen von Anjou, Geoffroy Plantagenet, entstand eine riesige Macht, die , neben England, enthalten Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou. Ihr erster Herrscher war der Sohn aus dieser Ehe, König Heinrich 11. (1154-1189), der die Gräfin Allenore von Aquitanien heiratete (ihr erster Ehemann war der französische König Ludwig VII.). Als Ergebnis dieser dynastischen Vereinigung kam der Südwesten Frankreichs unter die Herrschaft des englischen Königs.
4 Ein Kaplan ist ein Priester, der in einer Kapelle, einer kleinen Privatkirche, dient.
5 Der Privy Council ist das höchste Beratungsgremium unter den englischen Königen, dem die wichtigsten Würdenträger angehörten.
6 Tiara ist eine Kopfbedeckung, die von Päpsten bei feierlichen Zeremonien getragen wird.
7 Ein Kardinalslegat ist ein Vertreter des Papstes in einem Land.
8 „Thomistisch“ aus „Thomismus“ – die Lehre des Thomas von Aquin (1226-1274), sowie das von ihm entwickelte philosophische und theologische System, offiziell von der katholischen Kirche anerkannt.
9 Säkularisation ist die Umwandlung von Kloster- und Kircheneigentum in Staatseigentum.
10 „Preisrevolution“ – was im 16. Jahrhundert in Westeuropa geschah. Ein starker Preisanstieg (im Durchschnitt 4-5-mal) aufgrund der Abwertung von Gold und Silber aufgrund eines Anstiegs des Imports aus den amerikanischen Kolonien Spaniens, des Wachstums der städtischen Bevölkerung und der Verlagerung der Haupthandelsrouten von Mittelmeer und Ostsee bis zum Atlantik.
11 Der Schmalkaldische Bund ist ein im Dezember 1530 gegründeter religiöser und politischer Zusammenschluss der protestantischen Landesherren Deutschlands, der sich gegen die katholischen Fürsten und den Heiligen Römischen Kaiser Karl V.
Die schillernde Gestalt des englischen Königs Heinrich VIII. Tudor (1491-1547) zieht längst nicht nur die Aufmerksamkeit gebildeter Leser, Fachhistoriker und Schriftsteller, sondern auch Psychiater und Ärzte auf sich. Die Aufgabe, diese schillerndste Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts zu enträtseln, ist zu reizvoll. Vielleicht ist die Wissenschaft endlich nahe daran, die Geheimnisse des englischen Monarchen zu lüften, der durch seine Polygamie und die Reformation berühmt wurde, die in einem Streit mit dem Papst und der Proklamation Heinrichs zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche endete.
Heinrich VIII. Tudor
1993 veröffentlichte die Oxford-Historikerin Vivian Hubert Howard Green Mad Kings, wo im Kapitel über Henry (Big Harry) die folgende Schlussfolgerung steht: „Während es offensichtlich lächerlich wäre, zu argumentieren, dass die Persönlichkeit von Henry VIII die gestörten Gene von Henry VIII zeigt der wahnsinnige französische König, zeigt es Anzeichen von geistigem und emotionalem Ungleichgewicht. Der Autor impliziert, dass Big Harry der Ururenkel des französischen schizophrenen Königs Charles VI war. Also liegt die ganze kurze Zeit vielleicht nicht in den Genen, sondern im Blut? „Blut ist ein Saft von ganz besonderer Qualität“, wie Goethe zu Recht feststellte.
Achtzehn Jahre später veröffentlichten seine Kollegen in der Cambridge Historical Gazette historische Zeitschrift die Ergebnisse Ihrer Recherche. Die Bioarchäologin Catrina Banks Whitley, eine Doktorandin an der Southern Methodical University (USA), und die Anthropologin Kyra Kramer argumentieren, dass die wiederholten Fehlgeburten, die bei den Ehefrauen des Königs auftraten, darauf zurückzuführen sein könnten, dass der König im Blut Kell-Antigen hatte.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Kell-Antigene (oder Kell-Faktoren) Proteine sind, die auf der Oberfläche roter Blutkörperchen zu finden sind. Es gibt ungefähr 24 von ihnen, aber zwei sind am häufigsten - K und k. Darüber hinaus ist letzteres bei fast allen Menschen vorhanden, ersteres ist jedoch weniger verbreitet. Dementsprechend können Menschen je nach Vorhandensein oder Fehlen in drei Blutgruppen eingeteilt werden: Kell-positiv (KK), Kell-neutral (Kk) und Kell-negativ (kk). Unter Europäern sind Vertreter der letzteren Gruppe häufiger, aber neutrale und positive "Kellovite" sind äußerst selten (laut einigen Quellen gibt es nur neun Prozent von ihnen).
Grundsätzlich kann eine Frau, die nur ein negatives Kell-Antigen im Blut hat, ein gesundes Kind von einem Mann mit einem positiven Kell-Antigen gebären. Während der ersten Schwangerschaft produziert ihr Körper jedoch Antikörper, die während der folgenden Schwangerschaften in die Plazenta gelangen und den Fötus mit einem positiven Kell-Antigen angreifen. Infolgedessen können Babys an überschüssiger Flüssigkeit im Gewebe, Anämie, Gelbsucht, einer vergrößerten Milz oder Herzinsuffizienz leiden, was häufig zu einer Fehlgeburt zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche führt. So viel zum "blauen Blut" des Monarchen!
Katharina von Aragon war fünf Jahre älter als ihr Mann. Ihre Erstgeborene, eine Tochter, wurde tot geboren. Das zweite Kind, Henry, Prince of Wales, geboren 1511, lebte sieben Wochen. Die restlichen vier Kinder wurden entweder tot geboren oder starben unmittelbar nach der Geburt. Das einzige überlebende Kind war Maria, geboren 1516. Sie wurde 1553 Königin von England und ging als die Blutige in die Geschichte ein.
Sie versuchten, die Frühgeburt als einen mentalen Schock zu erklären, der durch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Henry und dem Vater der Königin verursacht wurde. Angeblich habe der Monarch Katharina den Verrat an König Ferdinand von Aragon endlos vorgeworfen und "seine Unzufriedenheit an ihr ausgelassen".
1518 gebar ihm eine der Hofdamen seiner Frau, Elizabeth Blount, einen Sohn, den späteren Herzog von Richmond. Sie wurde durch Mary Boleyn ersetzt und dann durch ihre Schwester Anna, eine kultivierte und belesene Dame, die „Sex ausstrahlt“. Es war die Ehe mit Anne Boleyn, die zum Grund für die "Scheidung" vom Thron von St. Peter wurde. Der Papst erlaubte einem lüsternen englischen Autokraten nicht, sich von einer legitimen spanischen Prinzessin scheiden zu lassen. Als Hochburg des Katholizismus verfasste Henry persönlich starke Einwände gegen Luthers Lehren. Der englische Monarch rebellierte erst gegen das Diktat Roms, nachdem der Papst sich geweigert hatte, seine zweite Ehe zu genehmigen.
Am 29. Januar 1536 erlitt Anna eine Fehlgeburt eines männlichen Kindes. Es wurde sogar vermutet, dass der Fötus wahrscheinlich ein Freak war. Heinrich ließ sich einreden, Anna habe ihn verhext, um ihn zu heiraten. Boleyn wiederum führte die Fehlgeburt auf den Schock zurück, den sie erlebte, als sie die Nachricht von Henrys Sturz bei einem Ritterturnier erhielt. Anna war nicht nur um das Leben ihres Mannes besorgt, sondern auch, weil ihr Mann sie nicht liebte, sondern seine neue Leidenschaft - Jane Seymour.
Wenn Henry auch am Macleod-Syndrom erkrankt war, dann ist dies der Grund für die kardinalen physischen und psychischen Veränderungen im physischen und moralischen Erscheinungsbild von Henry VIII. Das McLeod-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die für Menschen mit einem positiven Kell-Antigen charakteristisch ist, das sich auf dem X-Chromosom widerspiegelt. Die Krankheit ist typisch für Männer und manifestiert sich ab dem 40. Lebensjahr. Begleitet von Symptomen wie Herzerkrankungen, Bewegungsstörungen und großen psychischen Symptomen, einschließlich Paranoia und geistiger Beeinträchtigung.
Es gibt keine Informationen in schriftlichen Quellen über andere Symptome, die dem Macleod-Syndrom entsprechen würden. Es gibt keine Hinweise auf anhaltende Muskelkontraktionen (Ticks, Krämpfe oder Krämpfe) oder abnormale Zunahme der Muskelaktivität (Überfunktion). Wissenschaftler glauben jedoch, dass auch bedeutende psychische Metamorphosen für ihre Diagnose sprechen: Heinrichs geistige und emotionale Labilität nahm in den Jahren vor seinem Tod deutlich zu. Forscher neigen dazu, es als Psychose zu diagnostizieren.
In den ersten Jahren seiner Regierungszeit (Henry wurde 1509 zum König gesalbt) zeichnete sich der zweite der Tudors auf dem Thron durch sein schönes Aussehen, seine große Energie und seine Ausstrahlung aus. Humanisten setzten große Hoffnungen in diesen vielseitig gebildeten Menschen, einen brillanten Sportler und Spieler sowie einen begnadeten Musiker. Später wurde Henrys schlechter Gesundheitszustand durch Unterernährung erklärt, wodurch er Skorbut und Trauer entwickelte. In den 1540er Jahren hatte der König bereits so viel Gewicht zugenommen, dass er die Treppen nicht mehr hinauf- und hinuntergehen konnte und mit Hilfe spezieller Vorrichtungen gehoben und gesenkt werden musste.
„Er aß zu viel Fleisch, im Winter oft mit Gewürzen oder Essiggurken, zu wenig Obst und frisches Gemüse und litt daher unter einem akuten Mangel an Ascorbinsäure oder Vitamin C“, sagte Vivian Green ganz den charakteristischen Symptomen von Skorbut entsprechen: Beingeschwüre mit sich schnell ausbreitenden Tumoren, Schmerzen und Wunden, Mundgeruch, Müdigkeit, Gehschwierigkeiten, Kurzatmigkeit, ödematöse Tumore, rote Gesichtsfarbe, Reizbarkeit und Depression aufgrund von Unterernährung.“
Es wurde auch angenommen, dass Heinrich VIII. Diabetes, Syphilis und ausgedehnte Gicht hatte. Alle diese Diagnosen sind jedoch unbewiesen. Weder er noch seine Kinder zeigten Anzeichen von Syphilis, und es gibt keine Erwähnung in den Aufzeichnungen über die Verwendung von damals gängigen Medikamenten gegen diese Geschlechtskrankheit, wie Quecksilber.
Sobald die breite Öffentlichkeit Zeit hatte, sich mit den Ergebnissen einer Studie an zwei Amerikanerinnen vertraut zu machen, ließ die Kritik dagegen nicht lange auf sich warten. Retha Warnicke von der Arizona State University, Autorin von The Rise and Fall of Anne Boleyn: Family Politics at the Trial of Henry VIII, sagte, dass es ohne genetische Analyse kaum eine Chance gibt, die Wahrheit herauszufinden.
Eine große Anzahl von Fehlgeburten in der Familie des englischen Monarchen lässt sich durch andere Faktoren erklären. Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatten Hebammen keine Ahnung von elementarer Hygiene. Aus diesem Grund starben zur Zeit Heinrichs VIII. bis zur Hälfte aller Kinder vor Erreichen der Pubertät. Kardinale Veränderungen in der Persönlichkeit des Königs lassen sich durch Hypodynamie erklären - Bewegungsmangel, hektischer Appetit, der zu Fettleibigkeit und damit verbundenen Krankheiten führte.
Im Allgemeinen wird eine bemerkenswerte Welle des wissenschaftlichen Denkens (die Blutvermutung) von Traditionalisten mit "moosigen" Ideen über die Geistesstörung des Souveräns wieder ausgelöscht.